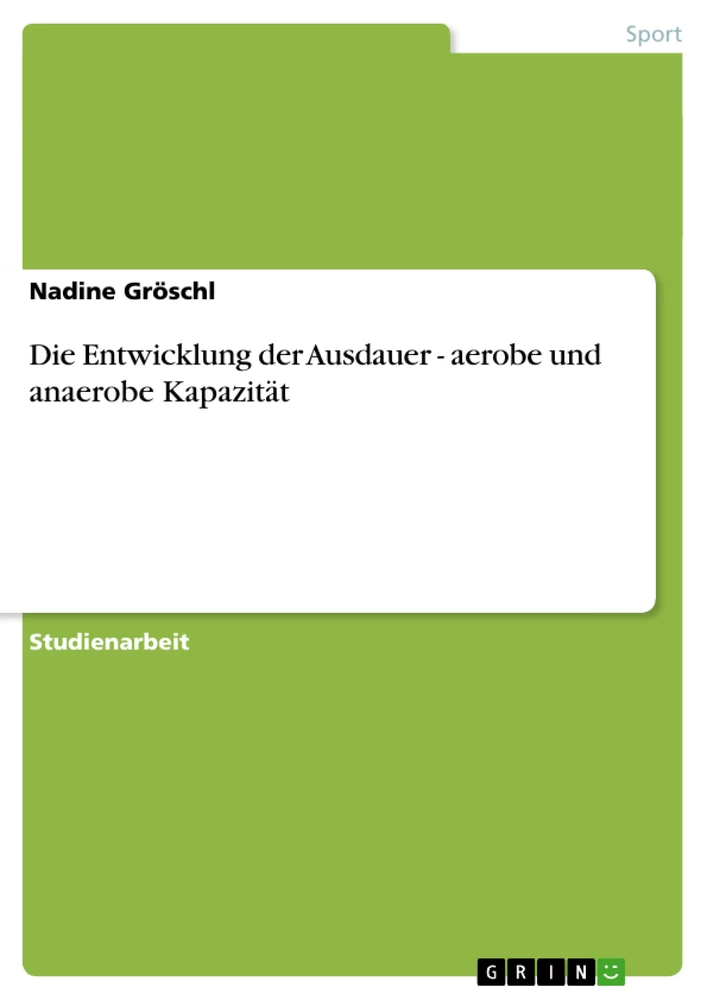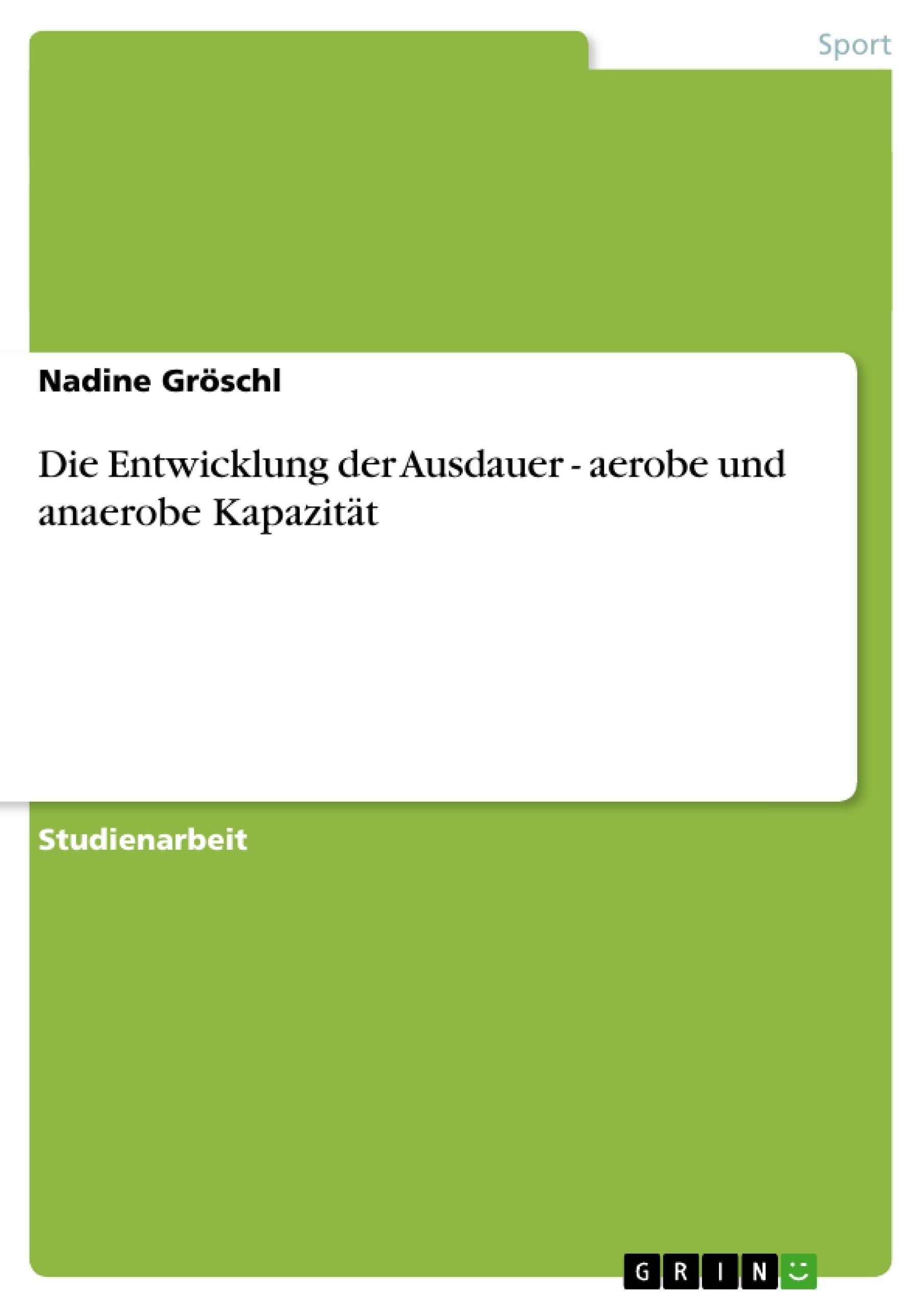Die folgende Arbeit beschreibt die Entwicklung der Ausdauer über das gesamte Leben, sowohl bei Trainierten als auch bei Untrainierten und inwiefern sich die Trainierbarkeit im Laufe des Lebens ändert. Unterschieden wird dabei zwischen aerober und anaerober Kapazität, auf beide Ausdauerarten wird eingegangen.
Verwendet wurden sechs deutsche und fünf englische wissenschaftliche Quellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Begriffsbestimmung Ausdauer
- 2. Die Entwicklung der aeroben Kapazität
- 2.1 Leistungsbestimmende Faktoren und Messverfahren
- 2.2 Die Entwicklung bei Untrainierten
- 2.3 Die Entwicklung bei Trainierten
- 2.4 Die Entwicklung der Trainierbarkeit
- 3. Die Entwicklung der anaeroben Kapazität
- 3.1 Leistungsbestimmende Faktoren und Messverfahren
- 3.2 Die Entwicklung bei Untrainierten
- 3.3 Die Entwicklung bei Trainierten
- 3.4 Die Entwicklung der Trainierbarkeit
- 4. Fazit
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Entwicklung der Ausdauerfähigkeit, sowohl der aeroben als auch der anaeroben Kapazität, über die Lebensspanne. Der Fokus liegt auf den leistungsbestimmenden Faktoren, den Messverfahren und dem Vergleich der Entwicklung bei trainierten und untrainierten Personen. Die Arbeit beleuchtet zudem die Veränderungen der Trainierbarkeit im Laufe des Lebens.
- Begriffsbestimmung und Unterscheidung von aerober und anaerober Ausdauer
- Entwicklung der aeroben Kapazität im Kindes- und Erwachsenenalter
- Entwicklung der anaeroben Kapazität im Kindes- und Erwachsenenalter
- Einfluss von Training auf die Ausdauerentwicklung
- Veränderungen der Trainierbarkeit im Laufe des Lebens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Begriffsbestimmung Ausdauer: Dieses Kapitel definiert Ausdauer als die Fähigkeit, eine Leistung über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten, unterteilt in physische und psychische Komponenten. Es wird die Unterscheidung zwischen aerober und anaerober Ausdauer anhand der Energiebereitstellung (oxidativ vs. anoxidativ) erläutert. Die verschiedenen Phasen der anaeroben Energiebereitstellung (alaktazid und laktazid) werden beschrieben, sowie der Übergang zur dominierenden aeroben Energiegewinnung bei längerer Belastung. Der Unterschied zwischen den Energielieferanten (Phosphate, Glukose, Glykogen, Fette) in den verschiedenen Phasen wird hervorgehoben, und die Überlappung der Energiebereitstellungsprozesse wird betont. Das Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel, die sich mit der Entwicklung der aeroben und anaeroben Kapazität befassen.
2. Die Entwicklung der aeroben Kapazität: Dieses Kapitel widmet sich der Entwicklung der aeroben Kapazität, beginnend mit der Beschreibung der leistungsbestimmenden Faktoren (oxydative Phosphorylierung, Herz-Kreislauf-System, Atmungssystem, Blut, vegetative und hormonelle Steuermechanismen). Es erläutert verschiedene Messverfahren wie die maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max) mittels Spirometer oder Laufbandtests (Cooper-Test) und Wettkampfleistungen. Die Entwicklung bei untrainierten Personen wird anhand von Studien (Hollmann et al., 1950er Jahre) dargestellt, die einen raschen Anstieg im Kindesalter, einen Höhepunkt im Jugendalter (früher bei Mädchen) und einen allmählichen Abfall im Erwachsenenalter zeigen. Geschlechtsunterschiede und Altersunterschiede in der maximalen Sauerstoffaufnahme werden detailliert beschrieben, inklusive der Erklärungen für die Unterschiede. Die Analyse beleuchtet den deutlichen Leistungsrückgang im Alter, besonders bei Männern.
3. Die Entwicklung der anaeroben Kapazität: Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung der anaeroben Kapazität. Es beginnt mit der Definition leistungsbestimmender Faktoren und Messverfahren, die sich von denen der aeroben Kapazität unterscheiden. Ähnlich wie im vorherigen Kapitel wird die Entwicklung der anaeroben Kapazität bei trainierten und untrainierten Personen im Laufe des Lebens analysiert, wobei die Veränderungen der anaeroben Leistungsfähigkeit im Alter untersucht werden. Der Fokus liegt auf den physiologischen Prozessen und den Auswirkungen des Trainings auf die anaerobe Energiebereitstellung. Der Text beschreibt detailliert die Veränderungen der anaeroben Kapazität und die möglichen Gründe für diese. Der Zusammenhang zwischen der anaeroben Kapazität und verschiedenen Sportarten wird erklärt und mit Beispielen aus der Literatur untermauert.
Schlüsselwörter
Ausdauer, aerobe Kapazität, anaerobe Kapazität, maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max), Trainierbarkeit, Altersentwicklung, Geschlechtsunterschiede, Leistungsfähigkeit, Energiebereitstellung, Messverfahren, Sport, Untrainierte, Trainierte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Entwicklung der Ausdauerfähigkeit
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Entwicklung der Ausdauerfähigkeit, sowohl der aeroben als auch der anaeroben Kapazität, über die gesamte Lebensspanne. Dabei werden leistungsbestimmende Faktoren, Messverfahren und der Vergleich der Entwicklung bei trainierten und untrainierten Personen betrachtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Veränderungen der Trainierbarkeit im Laufe des Lebens.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit beinhaltet eine Begriffsbestimmung von Ausdauer, die Unterscheidung zwischen aerober und anaerober Ausdauer, die Entwicklung der aeroben und anaeroben Kapazität im Kindes- und Erwachsenenalter, den Einfluss von Training auf die Ausdauerentwicklung und die Veränderungen der Trainierbarkeit im Alter. Die Kapitel befassen sich detailliert mit den leistungsbestimmenden Faktoren, den jeweiligen Messverfahren und analysieren die Unterschiede zwischen trainierten und untrainierten Personen.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 definiert den Begriff Ausdauer und differenziert zwischen aeroben und anaeroben Prozessen. Kapitel 2 und 3 befassen sich jeweils mit der Entwicklung der aeroben und anaeroben Kapazität, inklusive leistungsbestimmender Faktoren, Messverfahren und dem Vergleich trainierter und untrainierter Personen. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen, und Kapitel 5 enthält das Literaturverzeichnis.
Welche Methoden zur Messung der aeroben und anaeroben Kapazität werden beschrieben?
Für die aerobe Kapazität werden Methoden wie die maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max) mittels Spirometer oder Laufbandtests (z.B. Cooper-Test) und Wettkampfleistungen beschrieben. Für die anaerobe Kapazität werden ebenfalls entsprechende, aber differenzierte Messverfahren erläutert, die im Text detailliert dargestellt werden.
Wie entwickeln sich die aerobe und anaerobe Kapazität über die Lebensspanne?
Studien zeigen einen raschen Anstieg der aeroben Kapazität im Kindesalter, einen Höhepunkt im Jugendalter (früher bei Mädchen) und einen allmählichen Abfall im Erwachsenenalter. Ähnliche Entwicklungsmuster, jedoch mit unterschiedlichen Parametern und physiologischen Grundlagen, werden für die anaerobe Kapazität beschrieben. Geschlechts- und Altersunterschiede werden detailliert analysiert.
Welchen Einfluss hat Training auf die Ausdauerentwicklung?
Die Seminararbeit untersucht den Einfluss von Training auf die Entwicklung sowohl der aeroben als auch der anaeroben Kapazität in allen Altersgruppen. Die Veränderungen der Trainierbarkeit im Laufe des Lebens werden ebenfalls analysiert und die Auswirkungen auf die jeweilige Leistungsfähigkeit diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Ausdauer, aerobe Kapazität, anaerobe Kapazität, maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max), Trainierbarkeit, Altersentwicklung, Geschlechtsunterschiede, Leistungsfähigkeit, Energiebereitstellung, Messverfahren, Sport, Untrainierte und Trainierte.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das Literaturverzeichnis am Ende der Seminararbeit bietet weitere Quellen für vertiefende Informationen zu den behandelten Themen.
- Quote paper
- Nadine Gröschl (Author), 2010, Die Entwicklung der Ausdauer - aerobe und anaerobe Kapazität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154170