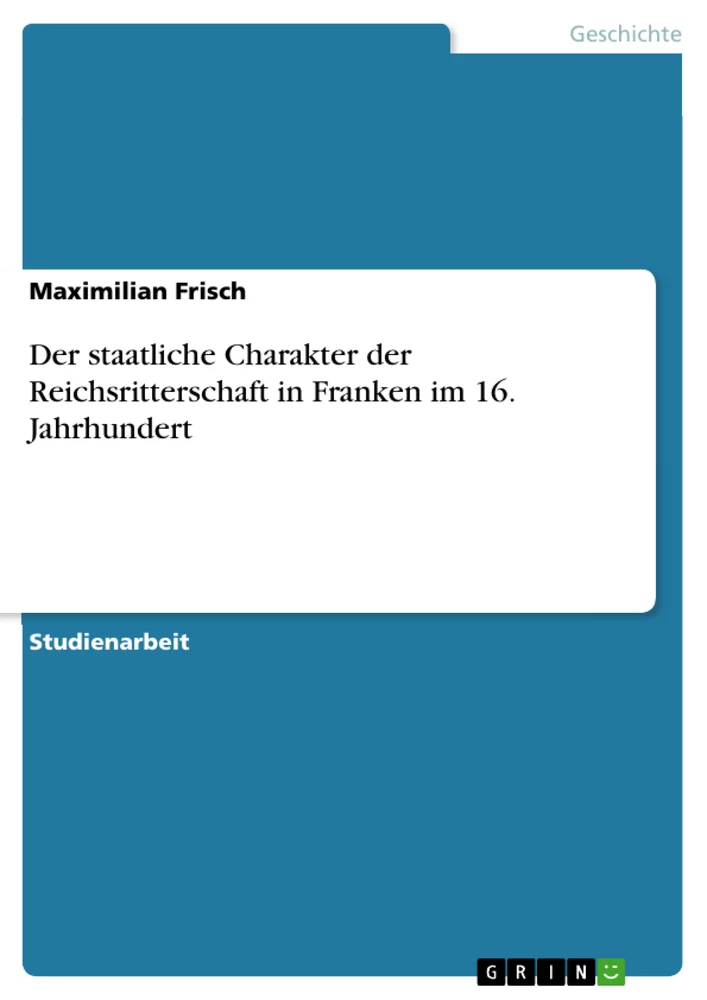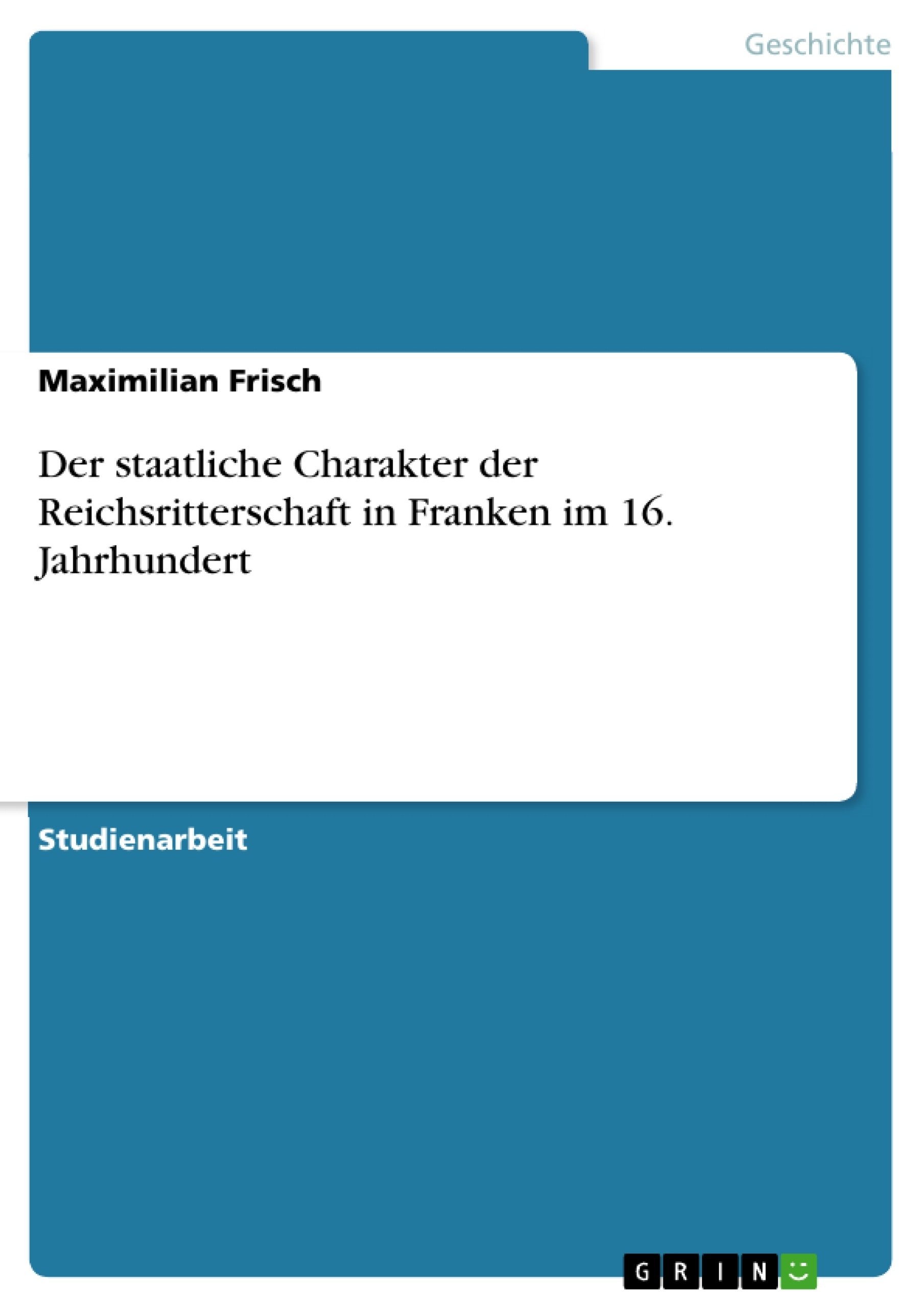Die Reichsritter gehörten zu eben jenen „Edelleuten [die] von ihren Burgen, Schlössern und Sitzen aus über die umliegenden Dörfer [gebieten]“ und die für Hofmann zu einem „durchaus `fragmentarischen Charakter'“ des Staatsaufbaus erheblich beitrugen. Mit der Einnahme einer „Zwitterstellung zwischen niederem und hohen Adel“ stand der Ritterstand in adeliger Opposition4 zur Landeshoheit, die die Reichsstände in ihren Territorien langsam durchzusetzen versuchten. Reichsritter verfügten in den Gebieten von Fürsten, Grafen, Bischöfen und nicht zuletzt der Reichsstädte über Grundherrschaften und Gerichtsbarkeiten, Lehensrechte und Steuerhoheit und entzogen sich so den entstehenden Territorialstaaten. Trotzdem die Reichsritter insbesondere im 16. Jahrhundert über die Reichsunmittelbarkeit und eine Vielzahl von Privilegien einen besonderen Status erreichten, waren sie eben kein Reichsstand; folglich fehlte eine Vertretung über den Reichstag und der Zugriff auf die Hochgerichtsbarkeit war zumindest erschwert. Und selbst der errungene und durch verschiedene Kaiser geförderte wie gefestigte Status war Anfechtungen der Reichsstände ausgesetzt.
Ist der Ritterstand also trotz seiner Wehrhaftigkeit gegen die Mediatisierung durch die Reichsstände angrenzender Territorien zu einer Art Staatlichkeit gelangt? Die Frage nach dem staatlichen Charakter der Reichsritterschaft führt durch die nachfolgende Arbeit. Es soll untersucht werden, inwiefern die Reichsritterschaft in Franken im 16. Jahrhundert Kriterien erfüllt, anhand derer Staatlichkeit im späten Mittelalter und zu Beginn der Frühen Neuzeit attestiert werden kann. Hierzu werden zunächst die Begrifflichkeiten erläutert, die im Rahmen der Arbeit verwendet werden und bei denen es Klärungsbedarf gibt. Anschließend werden die Bedingungen vorgestellt, denen Staatlichkeit im Mittelalter folgt. Schließlich werden eben diese Bedinungen an der Reichsritterschaft als Korporation überprüft, sodass am Ende dieser Arbeit Aussagen über den staatlichen Charakter getroffen werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Staatlichkeit wider Willen? Die Opposition der Reichsritterschaft
- 2. Zu den Begrifflichkeiten
- 3. Staatlichkeit in Franken im 16. Jahrhundert
- 4. Der Staatliche Charakter der Reichsritterschaften in ihren Territorien anhand der herrschaftlichen Rechte
- 4.1 Aktiver Gerichtsstand
- 4.2 Passiver Gerichtsstand
- 4.3 Rechte und Privilegien
- 5. Die staatlichen Kompetenzen der Korporation
- 6. Die besonderen Bedingungen der Staatlichkeit in Franken
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den staatlichen Charakter der Reichsritterschaft in Franken im 16. Jahrhundert. Ziel ist es zu klären, inwieweit die Reichsritterschaft Kriterien erfüllt, die im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit als Indikatoren für Staatlichkeit galten. Die Analyse basiert auf der Untersuchung der herrschaftlichen Rechte und Kompetenzen der Reichsritterschaft als Korporation.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Staatlichkeit“ im Kontext des frühen Neuzeitlichen Reichs
- Die Rolle der Reichsritterschaft im fränkischen Raum und ihre Opposition zur Landeshoheit
- Die herrschaftlichen Rechte und Gerichtsbarkeiten der Reichsritter
- Die Organisation und Kompetenzen der Reichsritterschaft als Korporation
- Die besonderen Bedingungen der Staatlichkeit in Franken im Vergleich zu anderen Regionen des Reiches
Zusammenfassung der Kapitel
1. Staatlichkeit wider Willen? Die Opposition der Reichsritterschaft: Das Kapitel untersucht die Position der Reichsritterschaft in Franken im 16. Jahrhundert, die sich zwischen niederem und hohem Adel bewegte. Trotz ihrer Reichsunmittelbarkeit und Privilegien fehlte ihnen eine Reichstagevertretung und der Zugang zur Hochgerichtsbarkeit war erschwert. Ihre Grundherrschaften und Gerichtsbarkeiten in Gebieten von Fürsten und Bischöfen stellten eine Opposition zur aufkommenden Territorialherrschaft dar. Die Frage nach ihrem staatlichen Charakter wird im Kontext ihrer Organisation und ihrer Positionierung im Reich gestellt. Der Autor Rüdiger Teuner wird zitiert, der argumentiert, dass die Reichsritterschaft kein im Niedergang befindliches Konstrukt war, sondern über korporative Organe mit einigen Kompetenzen verfügte.
2. Zu den Begrifflichkeiten: Dieses Kapitel widmet sich der Klärung wichtiger Begriffe. „Staatlichkeit“ wird im Kontext der frühen Neuzeit differenziert betrachtet, wobei die Transformation von personalen zu territorial geprägten Staaten im 13. Jahrhundert hervorgehoben wird. Die Synonyme „Landesherrschaft“ und „Landeshoheit“ werden unterschieden, wobei letztere die nicht mehr direkt vom Reich abgeleiteten Regalien und Privilegien beinhaltet. In der Arbeit wird „Staatlichkeit“ mit „Landeshoheit“ gleichgesetzt, genauer mit den Teilrechten der Landeshoheit, über die die Ritterschaft verfügte. Der Begriff „Ritterschaft“ wird auf den Stand der Reichsritter seit Mitte des 15. Jahrhunderts eingegrenzt, wobei auf andere Angehörige des Niederadels nur kurz hingewiesen wird. Die Entstehung der Reichsritterschaft wird an das Privileg Kaiser Sigmunds von 1422 geknüpft, und der Widerstand gegen den ewigen Landfrieden und den gemeinen Pfennig sowie die Ritterordnungen des 16. Jahrhunderts als relevante Kontextfaktoren genannt.
Schlüsselwörter
Reichsritterschaft, Franken, 16. Jahrhundert, Staatlichkeit, Landeshoheit, Landesherrschaft, Territorialstaat, Reichsunmittelbarkeit, Privilegien, Korporation, Adel, Opposition, Gerichtsbarkeit, Grundherrschaft.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Staatlichkeit wider Willen? Die Opposition der Reichsritterschaft in Franken im 16. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den staatlichen Charakter der Reichsritterschaft in Franken im 16. Jahrhundert. Sie analysiert, inwieweit die Reichsritterschaft Kriterien für Staatlichkeit im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit erfüllte, basierend auf der Untersuchung ihrer herrschaftlichen Rechte und Kompetenzen als Korporation.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Definition von „Staatlichkeit“ im Kontext des frühen Neuzeitlichen Reichs, der Rolle der Reichsritterschaft in Franken und ihrer Opposition zur Landeshoheit, den herrschaftlichen Rechten und Gerichtsbarkeiten der Reichsritter, der Organisation und den Kompetenzen der Reichsritterschaft als Korporation, sowie den besonderen Bedingungen der Staatlichkeit in Franken im Vergleich zu anderen Regionen des Reiches.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel 1 untersucht die Opposition der Reichsritterschaft; Kapitel 2 klärt wichtige Begriffe wie „Staatlichkeit“, „Landesherrschaft“ und „Landeshoheit“; Kapitel 3 behandelt die Staatlichkeit in Franken im 16. Jahrhundert; Kapitel 4 analysiert den staatlichen Charakter der Reichsritterschaften anhand ihrer herrschaftlichen Rechte (Gerichtsstand, Rechte und Privilegien); Kapitel 5 untersucht die staatlichen Kompetenzen der Korporation; Kapitel 6 betrachtet die besonderen Bedingungen der Staatlichkeit in Franken; und Kapitel 7 enthält das Literaturverzeichnis.
Wie wird der Begriff „Staatlichkeit“ definiert?
Der Begriff „Staatlichkeit“ wird im Kontext der frühen Neuzeit differenziert betrachtet. Die Arbeit hebt die Transformation von personalen zu territorial geprägten Staaten im 13. Jahrhundert hervor und setzt „Staatlichkeit“ mit „Landeshoheit“, genauer mit den Teilrechten der Landeshoheit, die die Ritterschaft besaß, gleich.
Welche Rolle spielte die Reichsritterschaft?
Die Reichsritterschaft in Franken im 16. Jahrhundert bewegte sich zwischen niederem und hohem Adel. Trotz Reichsunmittelbarkeit und Privilegien fehlte ihnen eine Reichstagevertretung und der Zugang zur Hochgerichtsbarkeit war erschwert. Ihre Grundherrschaften und Gerichtsbarkeiten stellten eine Opposition zur aufkommenden Territorialherrschaft dar. Die Arbeit untersucht, ob sie trotz ihrer Opposition als staatliches Gebilde betrachtet werden kann.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Untersuchung der herrschaftlichen Rechte und Kompetenzen der Reichsritterschaft als Korporation. Konkrete Quellenangaben sind im Literaturverzeichnis (Kapitel 7) zu finden.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Reichsritterschaft, Franken, 16. Jahrhundert, Staatlichkeit, Landeshoheit, Landesherrschaft, Territorialstaat, Reichsunmittelbarkeit, Privilegien, Korporation, Adel, Opposition, Gerichtsbarkeit, Grundherrschaft.
Wer wird in der Arbeit zitiert?
Der Autor Rüdiger Teuner wird zitiert, der argumentiert, dass die Reichsritterschaft kein im Niedergang befindliches Konstrukt war, sondern über korporative Organe mit einigen Kompetenzen verfügte.
- Quote paper
- Maximilian Frisch (Author), 2010, Der staatliche Charakter der Reichsritterschaft in Franken im 16. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/154024