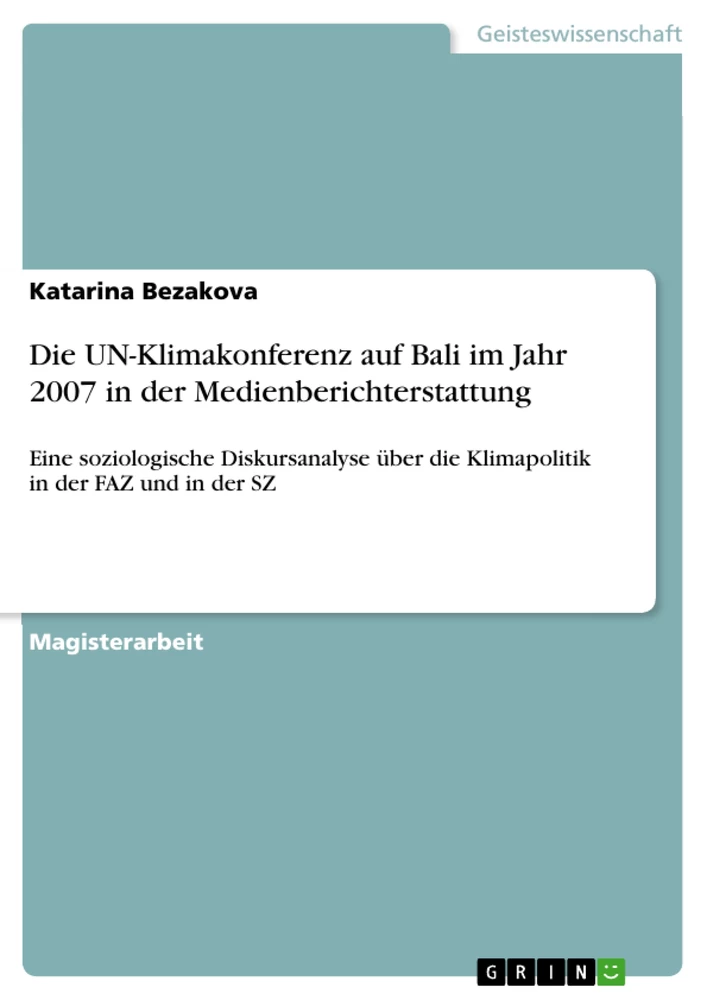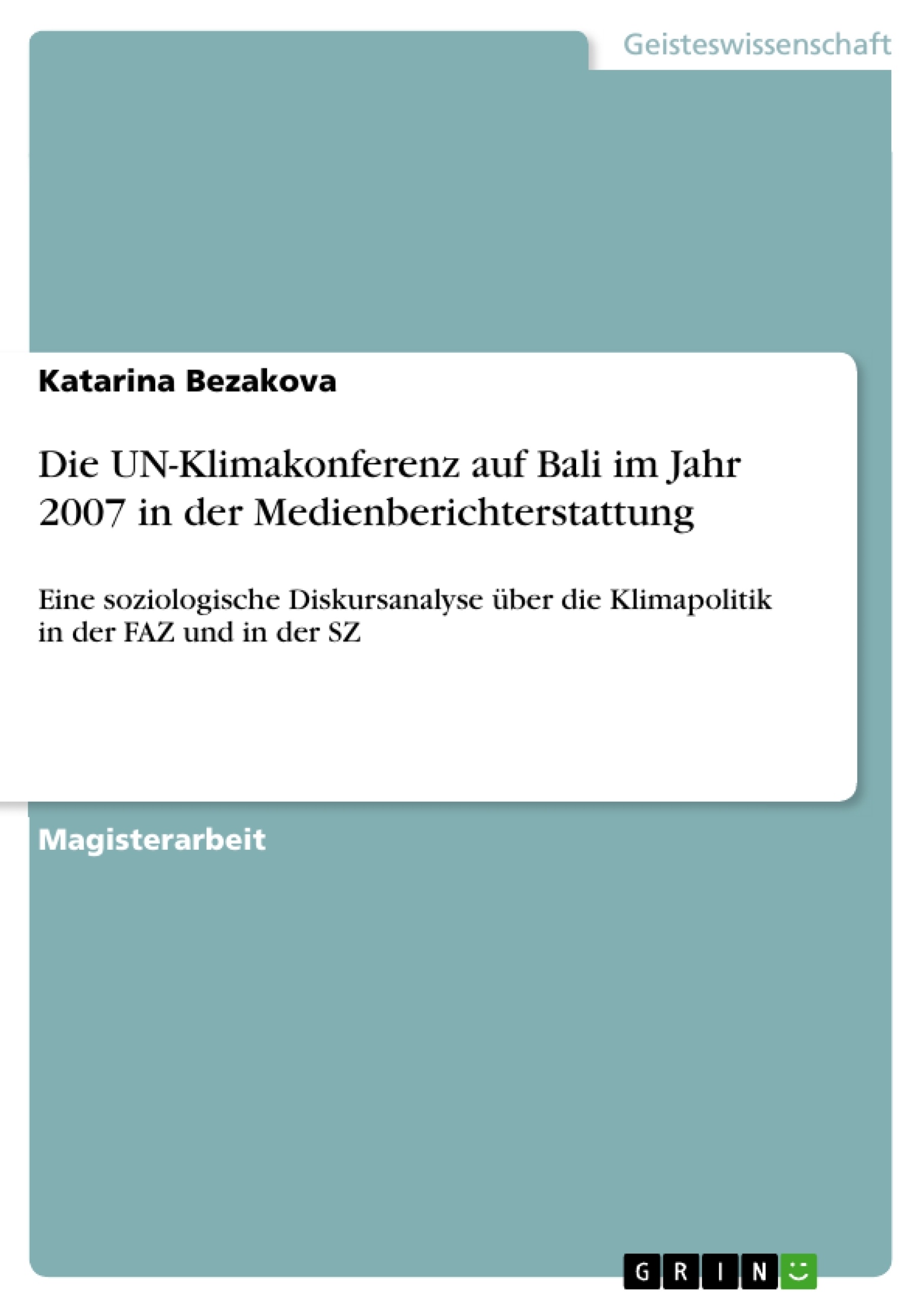Der Klimawandel ist ein globales Problem, das von Jahr zu Jahr wächst und allgemein als weltweite Bedrohung wahrgenommen wird. Der wissenschaftliche Konsens über die anthropogenen Einflüsse auf das Klimasystem führt zu weitreichenden gesellschaftlichen
Reaktionen auf dieses Problem. Aufgrund der sehr langfristigen Wirkungszusammenhänge und der ungerechten Verteilung seiner Auswirkungen über die Welt ist der Klimawandel eine echte Herausforderung für die gesamte Menschheit. Die klimatischen Veränderungen und ihre Folgen sind nicht mehr zu vermeiden. Derzeit ist es nur wichtig, die klimatischen Entwicklungen auf dem erreichten Standpunkt zu halten, so dass es sich nicht verschlimmert. Die Folgen des Klimawandels lassen sich nur dann in Grenzen halten, wenn die Oberflächentemperatur der Erde im Vergleich zur vorindustriellen Zeit um nicht mehr als 2°C steigt. Hierfür müssten die Treibhausgas-Emissionen bis 2050 im Vergleich
zu 1990 weltweit halbiert werden. Dies stellt ein Appell für die Klimapolitik dar. Da das Weltklima ein Gemeinschaftsgut ist, kann eine Klimapolitik auch nur dann funktionieren, wenn sie global umgesetzt wird. Die Staaten müssen sich in einer sehr engen
Zusammenarbeit mit der Klimaproblematik auseinandersetzen.
Eine der wichtigsten Stationen auf dem Weg zur erfolgreichen Klimapolitik war die UN-Klimakonferenz auf Bali, die im Dezember 2007 in Nusa Dua stattfand. Sie kann als Höhepunkt des klimapolitisch außerordentlich aktiven Jahres 2007 angesehen werden. Delegierte aus beinahe allen Ländern der Welt berieten über ein neues Nachfolgeklimaabkommen zum 2012 auslaufenden völkerrechtlich verbindlichen Kyoto-Protokolls. Es sollten neue, noch umfassendere politische Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel ergriffen werden. Der zentrale Bezugspunkt der politischen Diskussion war die Frage, ob man sich auf feste Zielvereinbarungen festlegen sollte. Diese Frage brachte Befürworter und Gegner einer Reformierung der Klimamaßnahmen hervor. Mit unterschiedlichen Argumenten und Strategien versuchten Akteure ihre Interessen zu vertreten und ihre Positionen und Deutungen zur Klimafrage als allgemein verbindlich durchzusetzen und damit Einfluss auf die weltweite Klimaregelung zu nehmen.
Vor allem durch Impulse aus der Wissenschaft und dann auch aus der Politik wurde seit den 80er Jahren die drohende Klimaveränderung zu einem Thema der öffentlichen und politischen Diskussion auf nationaler und internationaler Ebene.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Diskurs über den Klimawandel
- 2.1. Die Ursachen des Klimawandels
- 2.2. Die Risiken und die Folgen des Klimawandels
- 2.3. Die Anpassungsmaßnahmen an die Auswirkungen des Klimawandels
- 2.4. Die Charakteristika der Klimaproblematik
- 2.5. Der Klimawandel als ein massenmediales Thema
- 3. Die internationale Klimapolitik
- 3.1. Die politische Verantwortung
- 3.2. Die Entwicklung der internationalen Klimapolitik
- 3.3. 2007 Bali: Was kommt nach 2012?
- 4. Die politische Kommunikation in den Massenmedien
- 4.1. Was bedeutet die politische Kommunikation?
- 4.2. Das intermediäre System: Medien
- 4.3. Die Medien als Gatekeeper, Diskurskonstrukteure und Diskursproduzenten
- 5. Die klimapolitischen Interessen
- 5.1. Die Diskrepanzen der Klimaproblemlösung
- 5.2. Das Interessendreieck in der Klimapolitik
- 5.3. Die strategische Interaktion der Akteure
- 6. Die methodische Konzeption: das Untersuchungsdesign
- 6.1. Über die Zeitungen SZ und FAZ
- 6.2. Die Ereignishaftigkeit der Berichterstattung
- 7. Die quantitative Inhaltsanalyse der Zeitungsartikel
- 7.1. Alle Artikel als Codiereinheit
- 7.2. Ausgewählte Artikel als Codiereinheit
- 7.3. Zwischenfazit
- 8. Die qualitative Inhaltsanalyse der Zeitungsartikel – Leitfragenanalyse
- 8.1. Die Analyse der Akteure im öffentlichen Diskurs
- 8.2. Das Standing der Akteure: Akteure als Sprecher
- 8.3. Die empirische Auswertung der Zeitungsartikel in der FAZ und SZ anhand des Interessendreiecks in der Klimapolitik
- 8.3.1. EU
- 8.3.2. Deutschland
- 8.3.3. USA
- 8.3.4. Andere Industrieländer: Australien und Kanada
- 8.3.5. Entwicklungsländer
- 8.3.6. Schwellenländer
- 8.3.7. UNO
- 8.3.8. Akteure aus NGOs
- 8.3.9. Wissenschaftsakteure
- 8.3.10. Wirtschaftsakteure
- 8.4. Zwei Hauptkonflikte der klimapolitischen Interessenkonstellation in den Medien
- 8.4.1. Nord-Nord-Konflikt
- 8.4.2. Nord-Süd-Konflikt
- Die Bedeutung der internationalen Klimapolitik
- Die Rolle der Medien in der politischen Kommunikation
- Die Interessen verschiedener Akteure in der Klimapolitik
- Die Konstruktion von Diskursen in der Medienberichterstattung
- Die Einflussnahme von Medien auf öffentliche Meinungsbildung
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt den Klimawandel als globale Herausforderung dar und betont die Bedeutung der UN-Klimakonferenz in Bali als entscheidende Station im Kampf gegen den Klimawandel. Sie hebt die Rolle der Medien in der öffentlichen Debatte hervor.
- Kapitel 2: Der Diskurs über den Klimawandel: Dieses Kapitel beleuchtet die Ursachen, Risiken und Folgen des Klimawandels. Es analysiert die Anpassungsmaßnahmen und die Charakteristika der Klimaproblematik, sowie die Rolle der Medien in der öffentlichen Wahrnehmung.
- Kapitel 3: Die internationale Klimapolitik: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Entwicklung der internationalen Klimapolitik, der politischen Verantwortung der Staaten und der Bedeutung der UN-Klimakonferenz in Bali für zukünftige Maßnahmen.
- Kapitel 4: Die politische Kommunikation in den Massenmedien: Dieses Kapitel definiert die politische Kommunikation und analysiert die Rolle der Medien als Gatekeeper, Diskurskonstrukteure und Diskursproduzenten.
- Kapitel 5: Die klimapolitischen Interessen: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Interessen der Akteure in der Klimapolitik und analysiert die Diskrepanzen bei der Klimaproblemlösung. Es stellt das Interessendreieck in der Klimapolitik und die strategische Interaktion der Akteure dar.
- Kapitel 6: Die methodische Konzeption: das Untersuchungsdesign: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit und stellt die Zeitungen SZ und FAZ als Untersuchungsgegenstand vor. Es erläutert die Ereignishaftigkeit der Berichterstattung und die gewählten Methoden der Inhaltsanalyse.
- Kapitel 7: Die quantitative Inhaltsanalyse der Zeitungsartikel: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der quantitativen Inhaltsanalyse der Zeitungsartikel und untersucht die Häufigkeit und den Inhalt der Berichterstattung.
- Kapitel 8: Die qualitative Inhaltsanalyse der Zeitungsartikel – Leitfragenanalyse: Dieses Kapitel führt eine qualitative Inhaltsanalyse der Zeitungsartikel durch und analysiert die verschiedenen Akteure im öffentlichen Diskurs, ihr Standing und ihre Positionen im Interessendreieck der Klimapolitik.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Medienberichterstattung der UN-Klimakonferenz in Bali im Jahr 2007, indem sie eine soziologische Diskursanalyse der Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und der Süddeutschen Zeitung (SZ) durchführt. Die Arbeit zielt darauf ab, die Konstruktion von Klimapolitik in den Medien zu beleuchten und den Einfluss der Medien auf den öffentlichen Diskurs zu analysieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Klimawandel, UN-Klimakonferenz, Bali, Medienberichterstattung, Diskursanalyse, politische Kommunikation, Akteure, Interessen, Medienlogik, Gatekeeper, Diskurskonstruktion, Interessendreieck, FAZ, SZ, quantitative Inhaltsanalyse, qualitative Inhaltsanalyse.
- Quote paper
- Katarina Bezakova (Author), 2009, Die UN-Klimakonferenz auf Bali im Jahr 2007 in der Medienberichterstattung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153996