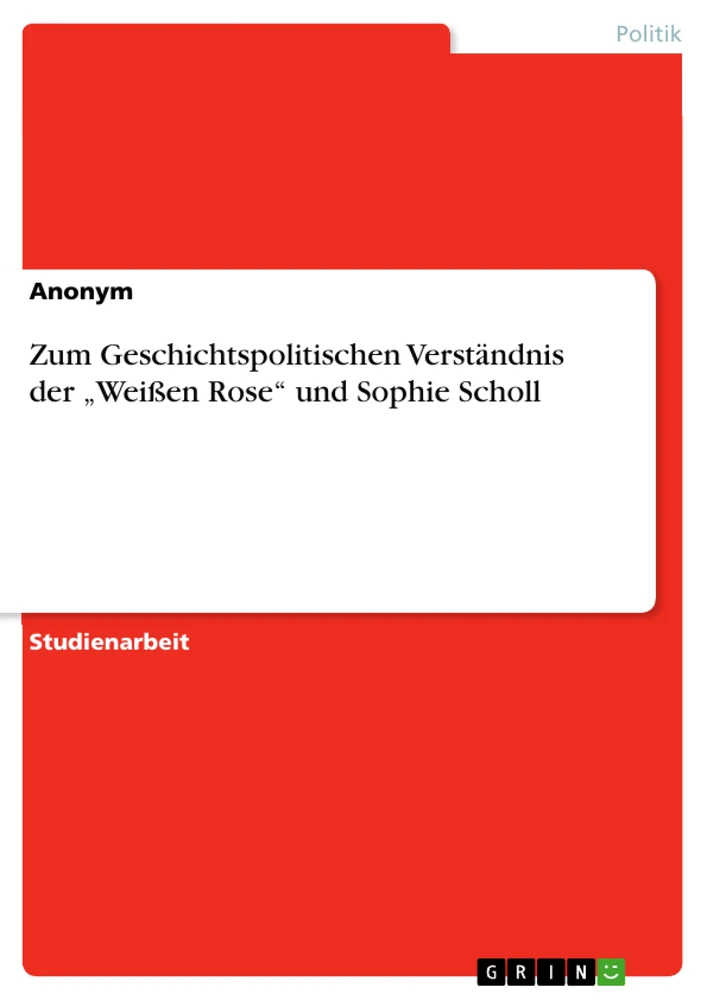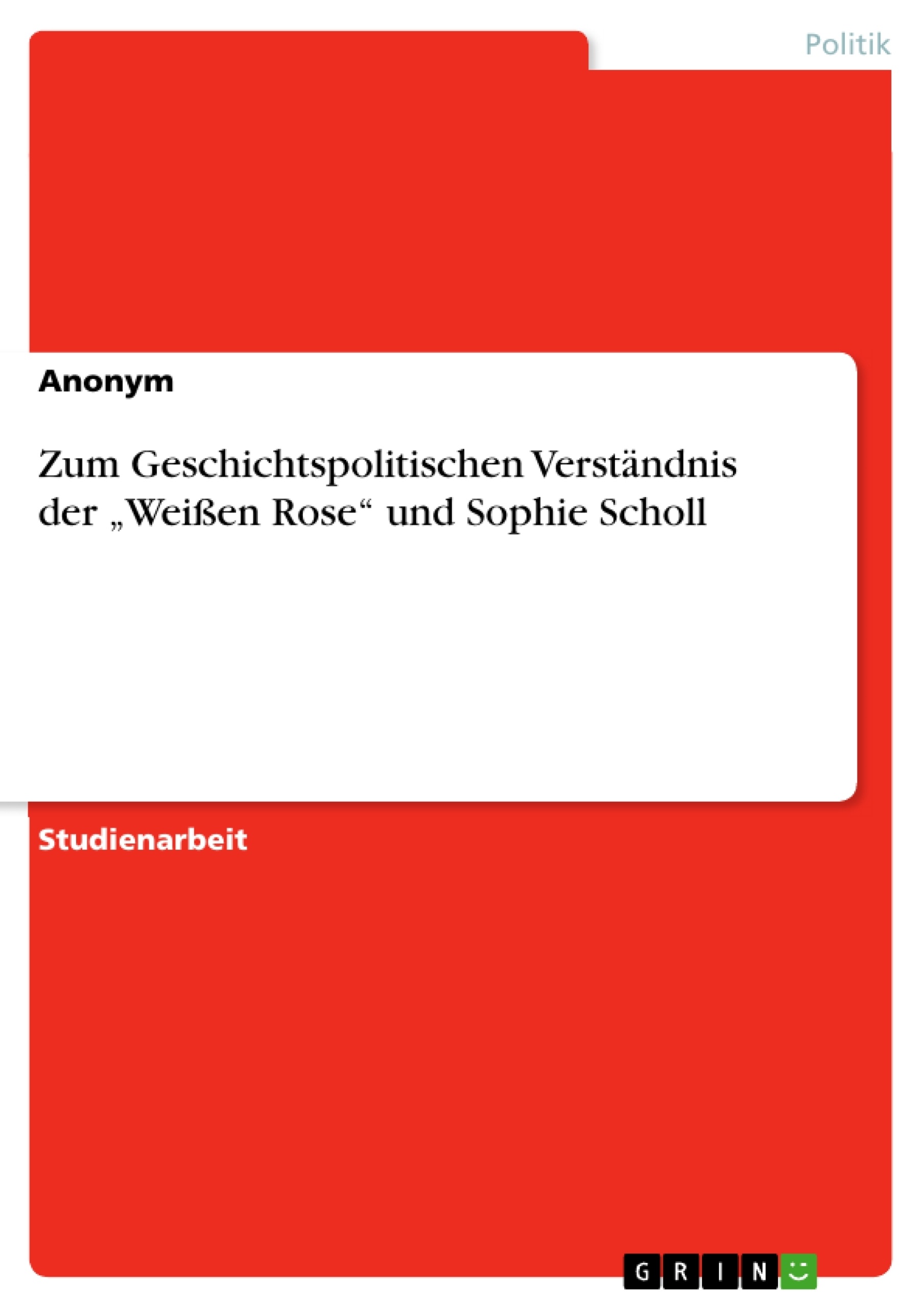Peter Steinbach definiert Widerständler im Dritten Reich als jene, „[…] die sich persönlich
und häufig allein für sich selbst nationalsozialistischen Zumutungen an Geist, Vernunft und
Gefühl widersetzten, die geistige Freiheit des Glaubens, des wissenschaftlichen Arbeitens, des
künstlerischen Schaffens, der berufsspezifischen Ethik beanspruchten und dadurch
nationalsozialistischer Politik eine Grenze wiesen“ (Steinbach 2001, 66). Die Motive für den
Widerstand im Nationalsozialismus waren also vielfältig, was dazu führte, dass gegen Hitler
keine geschlossene Front von überzeugten Regimegegnern stand. Zudem war das Risiko nicht
nur für den einzelnen, sondern auch für seine Angehörigen äußert hoch, denn auf
„Vorbereitung zum Hochverrat“, „Feindbegünstigung“ und „Wehrkraftzersetzung“ stand
Freiheitsstrafe und im schlimmsten Fall die Todesstrafe. (Bald 2004b, 48)
Die tatsächlich aktiv gewordenen Widerständler wurden nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs mit Heldenmythen versehen und bekamen den Status von Märtyrern
zugeschrieben. Märtyrer zeichnen sich oft dadurch aus, dass sie zu jeder Sekunde über die
symbolische Wirkung ihres Handelns im Klaren sind. Sophie Scholl, berühmtes Mitglied der
studentischen Widerstandsgruppe „Weiße Rose“, wusste, dass ihr Schicksal Bedeutung für
die wenigen hatte, die sich gemeinsam mit ihr dem NS-Terror widersetzten, aber auch für die
vielen, die nicht aktiv wurden.
In der Nachkriegszeit kreierte die geschichtspolitische Aufarbeitung von Widerstand unter
dem NS-Regime einen Heldenmythos, der besonders Sophie Scholl erfasste. Ihre
Sonderstellung scheint sachlich betrachtet wenig gerechtfertigt zu sein, da die Taten stets von
weiteren Mitgliedern der Gruppe mitgetragen, wenn nicht sogar initiiert wurden. „Die alte
Legende, mit dem Namen ‚Weisse Rose’ sofort und nur ‚Geschwister Scholl’ zu assoziieren,
als seien Hans und Sophie Scholl allein zentral für die Gruppe gewesen und als hätten sie die
‚Flugblätter der Weissen Rose’ verfaßt, hat eine lange Wirkungsgeschichte“ (Bald 2004, 16).
Es soll im Folgenden daher erörtert werden, inwieweit es gerechtfertigt ist, in Sophie Scholl
eine Schlüsselfigur des organisierten Widerstandes zu sehen. Dazu wird ihr biographischer
Hintergrund, die geschichtspolitische Relevanz der „Weißen Rose“ im Verlauf der letzen 60
Jahre, sowie die Sonderstellung von Sophie Scholl in der deutschen Erinnerungskultur
betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sophie Scholl - Die Biografie
- Widerstand gegen das NS-Regime
- Die „Weiße Rose“ um Sophie Scholl
- Das Selbstverständnis der Gruppierung im Wandel
- Wirken in Münchner Studentenkreisen
- Geschichtspolitische Relevanz der „Weißen Rose“
- Erste Phase: 1943-1948/49
- Zweite Phase: 1948/49 bis 1955
- Dritte Phase: 1955-1968
- Vierte Phase: 1968-1988
- Fünfte Phase: 1989 bis heute
- Sophie Scholl - Der Mythos
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit setzt sich zum Ziel, Sophie Scholl als Schlüsselfigur des organisierten Widerstands im Nationalsozialismus zu analysieren. Dabei wird ihr biographischer Hintergrund, die geschichtspolitische Bedeutung der „Weißen Rose“ im Laufe der letzten 60 Jahre und die Sonderstellung von Sophie Scholl in der deutschen Erinnerungskultur beleuchtet.
- Die Biografie von Sophie Scholl und ihre Entwicklung zur Widerstandskämpferin
- Die verschiedenen Formen des Widerstands im Nationalsozialismus
- Die historische Relevanz der „Weißen Rose“ und ihre Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft
- Die Rolle des Heldenmythos um Sophie Scholl in der deutschen Erinnerungskultur
- Die Bedeutung von Sophie Scholl als Symbolfigur für Mut, Widerstand und Zivilcourage
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext des Widerstands im Dritten Reich dar und erläutert die besonderen Herausforderungen, die mit diesem Widerstand verbunden waren. Sie führt den Leser in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor.
Kapitel 2 zeichnet ein biografisches Porträt von Sophie Scholl, beleuchtet ihre Jugend und die prägenden Einflüsse, die ihre Entwicklung zu einer Widerstandskämpferin beeinflussten. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der Weg zum Engagement in der „Weißen Rose“ werden detailliert geschildert.
Kapitel 3 untersucht den Widerstand gegen das NS-Regime im Allgemeinen und widmet sich im Anschluss der „Weißen Rose“ als eine besondere Form des Widerstands. Die verschiedenen Stufen des Widerstands werden beleuchtet, und die Entstehung und Entwicklung der „Weißen Rose“ werden mit Blick auf das Selbstverständnis der Gruppe und ihre Aktivitäten im Münchner Studentenkreis dargestellt.
Kapitel 4 erörtert die geschichtspolitische Relevanz der „Weißen Rose“ in der deutschen Erinnerungskultur. Die Entwicklung der Rezeption und die unterschiedlichen Phasen der Interpretation des Widerstands der Gruppe werden analysiert.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen Widerstand, Nationalsozialismus, „Weiße Rose“, Sophie Scholl, Heldenmythos und Erinnerungskultur. Sie untersucht den Widerstand im Dritten Reich, die Motivationen und Herausforderungen der Widerstandskämpfer, die Rolle der „Weißen Rose“ als studentischer Widerstandsgruppe sowie die Bedeutung von Sophie Scholl als Symbolfigur für Mut und Zivilcourage.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2005, Zum Geschichtspolitischen Verständnis der „Weißen Rose“ und Sophie Scholl, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153849