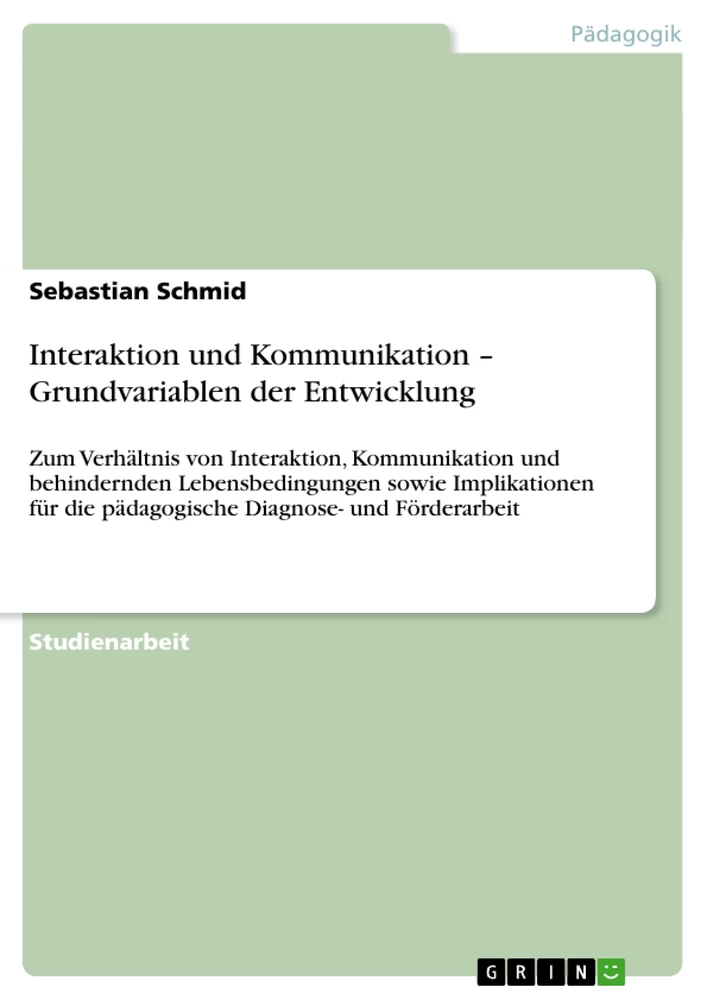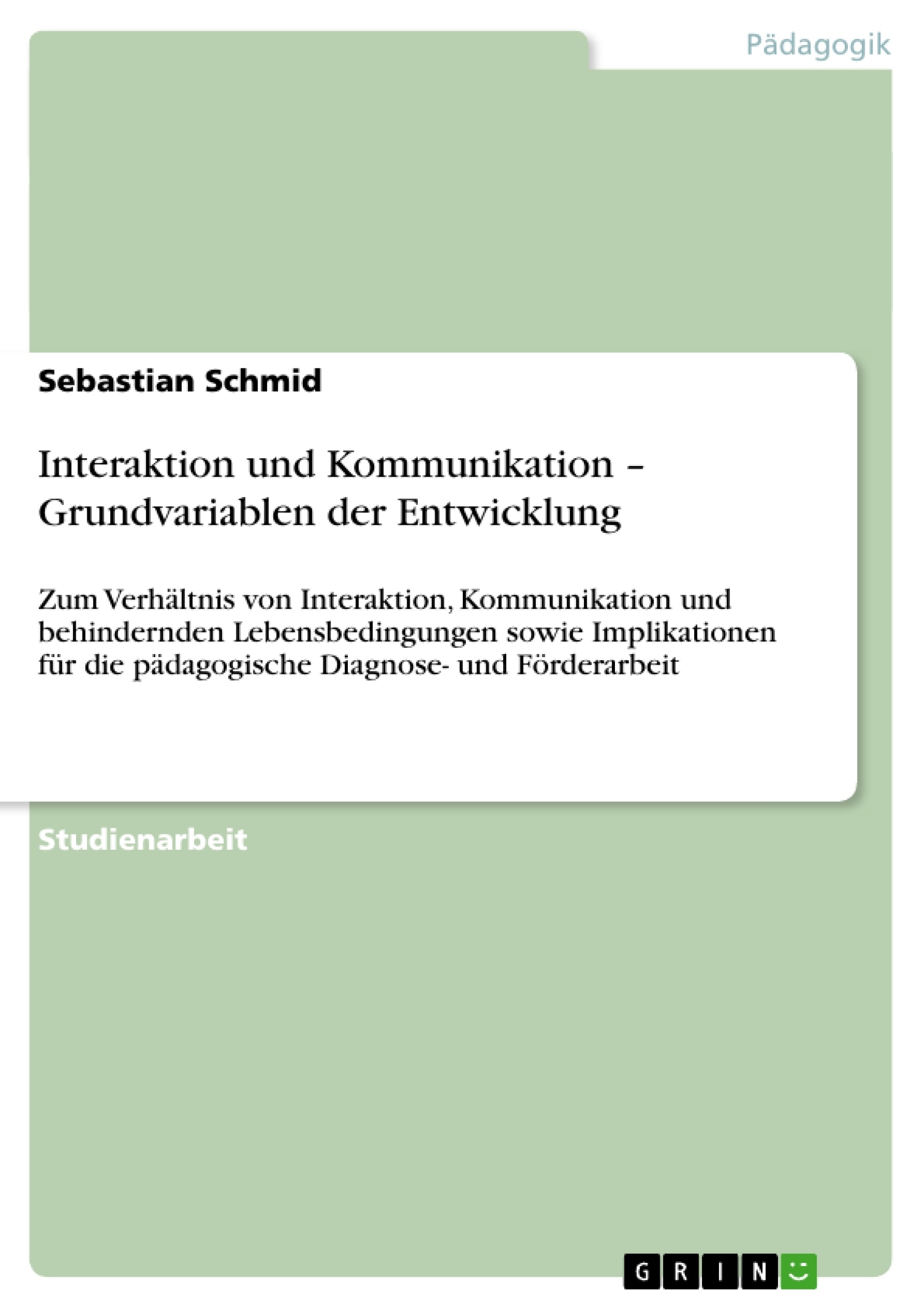„Alles was wir sind, sind wir in Kommunikation.“ Dieser Satz des deutschen Philosophen Karl Jaspers (zit. nach Fröhlich 1998, 22) markiert den Stellenwert, den die menschliche Kommunikationsfähigkeit im allgemeinen und die gesprochene Sprache im besonderen innerhalb der individuellen Lebensgeschichte jedes Einzelnen, aber auch in der Gesellschaft und generell in der menschlichen Zivilisationshistorie einnimmt. Auch Ausdrücke wie „Informations- oder Kommunikationsgesellschaft“ (Retter 2002, 10) belegen die außerordentliche Bedeutung und das global Konstituierende dieses Prozesses.
Der universelle Anspruch der Kommunikation resultiert aus der Tatsache, dass sowohl unsere persönliche Entwicklungsgeschichte wie auch unser gegenwärtiges Sein in hohem Maße durch soziale Erfahrungen und interpersonale Austauschprozesse bestimmt sind.
Die Charakterisierung des Menschen als „physiologische Frühgeburt“ (Portmann 1969, 58) weist beispielsweise auf die ausgeprägte Abhängigkeit von Bezugspersonen in der frühen Lebensphase hin.
Sozialisation und Erziehung als typisch menschliche Institutionen sind Ausdruck der gegenseitigen Interdependenz und können als solche wiederum nur vor dem Hintergrund kommunikativer Prozesse ablaufen. Denn eine humanitäre und dem demokratischen Menschenbild entsprechende Erziehung kann sich niemals durch aktives Tun auf der einen Seite und passives Erleiden auf der anderen auszeichnen, sondern geschieht auf der Basis gemeinsamer Verständigung, eines steten Aushandelns, der Arbeit an einer ‚gemeinsamen Daseinsgestaltung’. Sie ist ein ‚gegenseitiger Wandlungs- und Gestaltungsprozess’, der sich in ‚kreisförmigen interaktionalen Austauschprozessen’ vollzieht, an denen Erzieher und zu Erziehender gleichermaßen beteiligt sind (vgl. Kobi 2004, 73ff).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung: Was versteht man unter Kommunikation bzw. Interaktion?
- Alltagsverständnis von Kommunikation und damit verbundene Probleme
- Der Ansatz Watzlawicks
- Der handlungstheoretische Ansatz
- Der Ansatz von Niklas Luhmann
- Begriffliche und wissenschaftstheoretische Grundlagen
- Kommunikation kommuniziert: Die Sichtweise der Systemtheorie
- Syntheseversuch
- Die Voraussetzungslosigkeit von Kommunikation
- Fazit
- Differenzierter Blick auf die systemtheoretische Sichtweise
- Die Unwahrscheinlichkeit von Kommunikation
- Medien
- Medium Sprache
- Medium Sinn
- Struktur und Erwartung
- Erwartungsaggregationen
- Erwartungsunsicherheit
- Entwicklung von Erwartungen und Normen
- Themen
- Interpenetration durch Synchronisation
- Inklusion/Exklusion
- Beobachtung
- Zusammenfassung
- Kritische Würdigung
- Fachspezifische Erweiterungen und Ergänzungen systemtheoretischer Denkansätze
- Belastungen der Interaktion im Kontext geistige Behinderung im Hinblick auf systemtheoretische Gesichtspunkte
- Zu den Problemfeldern
- Zur prinzipiellen Selbstreferenz
- Zu den Medien
- Probleme der Synchronisation
- Zur Entwicklung
- Grundlagen und Voraussetzungen
- Stufen der kommunikativen Entwicklung
- Bedeutung der frühen Interaktion
- Merkmale und Elemente des frühen Dialogs
- Prodromale Fähigkeiten
- Individuelle Unterschiede und Besonderheiten
- Sozial-kommunikative Unterschiede
- Auswirkungen verschiedener (körperlicher) Einschränkungen
- Einfluss von Schwierigkeiten in der Wahrnehmung
- Fazit
- Behinderung als Phänomen gestörter struktureller Kopplung
- Der Einfluss der sozialen Adresse
- Zwischenresümee: Agenda pädagogische Interaktion
- Interaktionsanalyse - Weg zum gegenseitigen Verstehen
- Bedeutung des Verstehens
- Grundsätzliches zur diagnostischen Beobachtung
- Möglichkeiten der Interaktionsbeobachtung
- Die Interaktionsanalyse als diagnostisches Handwerkszeug
- Videotechnik als Forschunginstrumentarium
- Allgemeine Fragen der Analyse
- Grenzen
- Forschungsgeschichtliche Entwicklung der Lehrer-Schüler Interaktion
- Führungsstilforschung nach Lewin bzw. Tausch
- Kausalattribuierung
- Komplexe Ideen der Lehrer-Schüler Interaktion
- Ausblick: Förderliches Verhalten der Bezugspersonen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Verhältnis von Interaktion und Kommunikation im Kontext von hindernden Lebensbedingungen, insbesondere im Hinblick auf pädagogische Diagnose und Förderung. Ziel ist es, ein differenziertes Verständnis dieser Zusammenhänge zu entwickeln und Implikationen für die Praxis abzuleiten.
- Begriffsdefinitionen von Interaktion und Kommunikation
- Systemtheoretische Betrachtung von Kommunikation und Interaktion
- Einfluss von Behinderung auf Interaktions- und Kommunikationsprozesse
- Pädagogische Interaktionsanalyse als Instrument der Diagnose und Förderung
- Förderliches Verhalten von Bezugspersonen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die zentrale Bedeutung von Kommunikation und Interaktion für die menschliche Entwicklung und Sozialisation. Sie unterstreicht die Notwendigkeit von gemeinsamer Verständigung und Aushandeln in pädagogischen Kontexten und den engen Zusammenhang zwischen positiver Beziehungsgestaltung und kommunikativen Prozessen. Die Arbeit wird als Beitrag zum Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen Kommunikation, Interaktion und hindernden Lebensbedingungen vorgestellt.
Begriffsbestimmung: Was versteht man unter Kommunikation bzw. Interaktion?: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen theoretischen Ansätzen zur Definition von Kommunikation und Interaktion. Es werden die Konzepte von Watzlawick, dem handlungstheoretischen Ansatz und der Systemtheorie nach Luhmann verglichen und kritisch beleuchtet. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Analyse von Kommunikation und Interaktion im Kontext von Behinderung. Die unterschiedlichen Perspektiven werden systematisch einander gegenübergestellt und im Hinblick auf ihre jeweiligen Stärken und Schwächen analysiert.
Differenzierter Blick auf die systemtheoretische Sichtweise: Dieses Kapitel vertieft die systemtheoretische Perspektive auf Kommunikation. Es beleuchtet die Unwahrscheinlichkeit von Kommunikation, die Rolle von Medien (Sprache und Sinn), die Bedeutung von Struktur und Erwartung, sowie die Themen Inklusion und Exklusion. Der Fokus liegt auf der Beschreibung von Kommunikation als ein komplexes, dynamischen Prozess, geprägt von Unsicherheiten und der ständigen Aushandlung von Bedeutung. Die Konzepte werden mit zahlreichen Beispielen erläutert.
Fachspezifische Erweiterungen und Ergänzungen systemtheoretischer Denkansätze: Dieses Kapitel erweitert die systemtheoretischen Ansätze auf den Kontext von geistiger Behinderung. Es analysiert die Belastungen der Interaktion unter diesem Aspekt, insbesondere die Herausforderungen der Synchronisation und die Bedeutung der frühen Interaktion für die Entwicklung. Es werden individuelle Unterschiede und die Auswirkungen verschiedener Einschränkungen auf die Kommunikation beleuchtet.
Zwischenresümee: Agenda pädagogische Interaktion: Dieses Kapitel fasst die bisherigen Ergebnisse zusammen und leitet zur Interaktionsanalyse als Methode der pädagogischen Diagnose und Förderung über. Es betont die Bedeutung des Verstehens in der pädagogischen Interaktion und stellt verschiedene Möglichkeiten der Interaktionsbeobachtung vor, wie zum Beispiel die Videotechnik. Die Grenzen der Methode werden ebenso kritisch diskutiert.
Schlüsselwörter
Interaktion, Kommunikation, Behinderung, Systemtheorie, Pädagogische Diagnose, Förderarbeit, Inklusion, Exklusion, frühe Interaktion, Kommunikative Entwicklung, Interaktionsanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Systemtheoretische Betrachtung von Kommunikation und Interaktion im Kontext von Behinderung
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Verhältnis von Interaktion und Kommunikation im Kontext hindernder Lebensbedingungen, insbesondere im Hinblick auf pädagogische Diagnose und Förderung. Ziel ist ein differenziertes Verständnis dieser Zusammenhänge und die Ableitung von Implikationen für die Praxis.
Welche theoretischen Ansätze werden zur Definition von Kommunikation und Interaktion herangezogen?
Die Arbeit vergleicht und analysiert verschiedene theoretische Ansätze, darunter den Ansatz von Watzlawick, den handlungstheoretischen Ansatz und vor allem die Systemtheorie nach Luhmann. Die unterschiedlichen Perspektiven werden systematisch einander gegenübergestellt und hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen bewertet.
Wie wird die Systemtheorie Luhmanns angewendet?
Die systemtheoretische Perspektive wird vertieft, indem Konzepte wie die Unwahrscheinlichkeit von Kommunikation, die Rolle von Medien (Sprache und Sinn), die Bedeutung von Struktur und Erwartung, sowie Inklusion und Exklusion beleuchtet werden. Kommunikation wird als komplexer, dynamischer Prozess beschrieben, der von Unsicherheiten und der Aushandlung von Bedeutung geprägt ist.
Wie wird der Kontext geistiger Behinderung in die Analyse einbezogen?
Die Arbeit erweitert die systemtheoretischen Ansätze auf den Kontext geistiger Behinderung. Es werden die Belastungen der Interaktion, Herausforderungen der Synchronisation und die Bedeutung der frühen Interaktion für die Entwicklung analysiert. Individuelle Unterschiede und die Auswirkungen verschiedener Einschränkungen auf die Kommunikation werden beleuchtet.
Welche Rolle spielt die Interaktionsanalyse?
Die Interaktionsanalyse wird als Methode der pädagogischen Diagnose und Förderung vorgestellt. Die Bedeutung des Verstehens in der pädagogischen Interaktion, verschiedene Möglichkeiten der Interaktionsbeobachtung (z.B. Videotechnik) und die Grenzen der Methode werden diskutiert.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselkonzepte umfassen Interaktion, Kommunikation, Behinderung, Systemtheorie, pädagogische Diagnose, Förderarbeit, Inklusion, Exklusion, frühe Interaktion, kommunikative Entwicklung und Interaktionsanalyse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Begriffsbestimmung von Kommunikation und Interaktion (inkl. verschiedener theoretischer Ansätze), differenzierter Betrachtung der systemtheoretischen Sichtweise, fachspezifischen Erweiterungen im Kontext geistiger Behinderung, Zwischenresümee zur pädagogischen Interaktion, Interaktionsanalyse und Ausblick auf förderliches Verhalten von Bezugspersonen.
Welche Ziele werden mit der Arbeit verfolgt?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein differenziertes Verständnis der Zusammenhänge zwischen Kommunikation, Interaktion und hindernden Lebensbedingungen zu entwickeln und daraus Implikationen für die Praxis abzuleiten. Es geht um die Verbesserung der pädagogischen Diagnose und Förderung.
- Quote paper
- Sebastian Schmid (Author), 2010, Interaktion und Kommunikation – Grundvariablen der Entwicklung , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153840