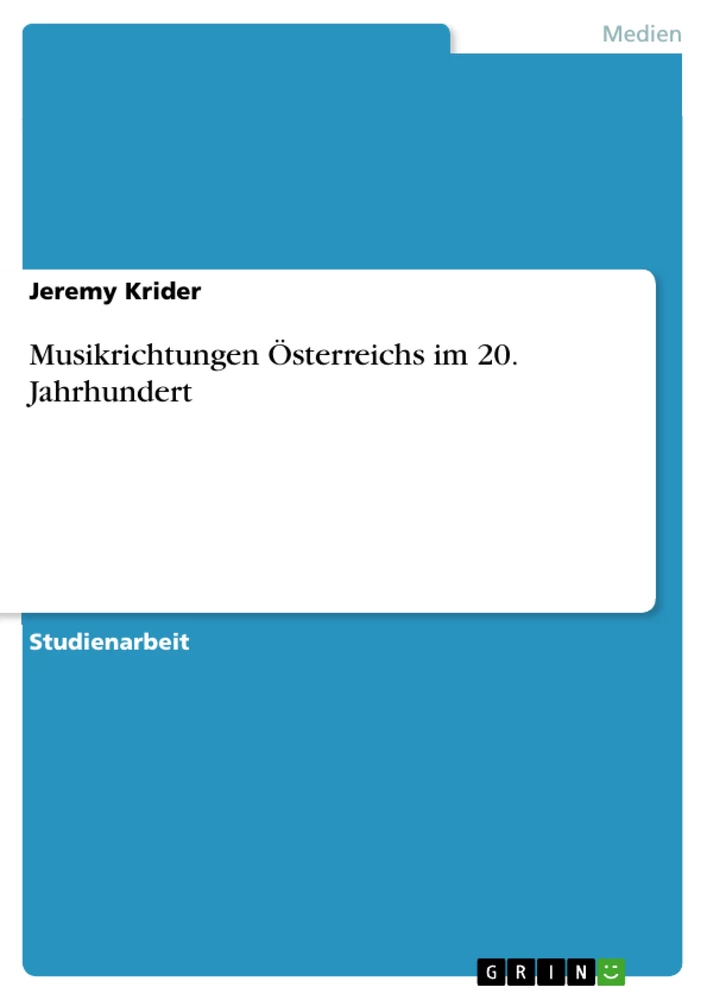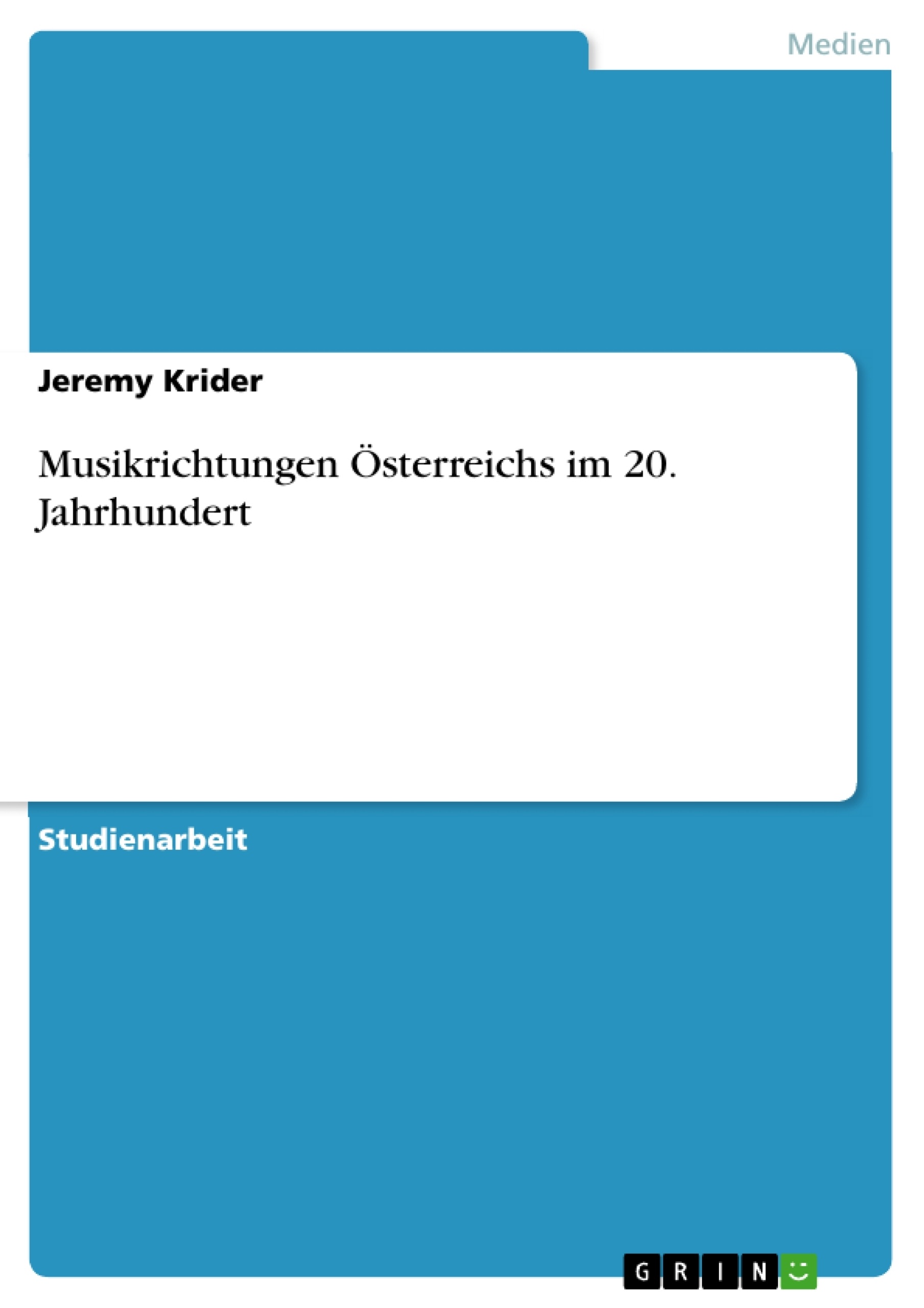Diese Arbeit beleuchtet das Spektrum der Musik Österreichs im 20. Jahrhundert, um zu zeigen, wie komplex und abweichend eine österreiche Identität durch Musik sein kann. In der Geschichte Österreichs im 20. Jahrhundert sehen wir verschiedene Musikrichtungen und Versuche, zwischen der ,,ernsten“ und der ,,Unterhaltungsmusik“ eine österreichische Identität zu etablieren. Einst wurden die Walzer als mindwertig betrachtet, aber irgendwann wurden sie auch vom Adel genossen. Die Brüder Schrammel spielten Volksmusik mit Geige, picksüßem Hölzl und Schifferklavier, und jetzt kann man diese Volksmelodien in Mahlers Symphonien und Militärmärschen hören.
In demselben Land wurden Almschrei, Alpsegen, Juchzer und Jodler sowie tonale, atonale, Zwölfton- und Austropopmusik gehört. Obwohl die Musik von den Nationalsozialisten verboten wurde bzw. ein Ruf nach Rückkehr zu klassischer und romantischer Musik laut wurde, sehen wir ein Land mit verschiedenen Musiktraditionen, die alle unter den Namen ,,österreichisch“ fallen könnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die Musikwende der Jahrhundertwende
- I. Die Wiener Schule und das Experimentieren
- II. Die Erneuerung von klassischer und romantischer Musik
- III. Rock 'n' Roll und der Anfang des Austropops
- IV. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung verschiedener Musikrichtungen in Österreich im 20. Jahrhundert und deren Beitrag zur österreichischen Identität. Sie analysiert den Wandel von der traditionellen Musik hin zu experimentellen Formen und beleuchtet den Einfluss von gesellschaftlichen und politischen Ereignissen auf die musikalische Landschaft.
- Die Wiener Schule und ihre experimentellen Kompositionstechniken
- Die Entwicklung und der Einfluss der klassischen und romantischen Musik
- Der Aufstieg von Unterhaltungsmusik und die Entstehung des Austropops
- Der Einfluss politischer Ereignisse auf die österreichische Musik
- Die komplexe und vielschichtige Natur der österreichischen musikalischen Identität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Musikwende der Jahrhundertwende: Die Einleitung beschreibt den Wandel in der Musik des 19. Jahrhunderts, der durch einen veränderten Zugang zum Musikverständnis der Bevölkerung gekennzeichnet war. Der Fokus verlagerte sich vom Verständnis komplexer Kompositionstechniken hin zum emotionalen Erlebnis und zur Atmosphäre der Musik. Es wird die Unterscheidung zwischen ernster und Unterhaltungsmusik hervorgehoben, und die Arbeit kündigt die Untersuchung der Suche nach einer österreichischen musikalischen Identität im 20. Jahrhundert an, die sich zwischen diesen Polen bewegt.
I. Die Wiener Schule und das Experimentieren: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Zweite Wiener Schule (Schönberg, Berg, Webern) und deren experimentellen Ansatz zur Harmonie, Melodik, und Form. Es wird der Bruch mit der traditionellen Tonalität beschrieben, sowie die Herausforderungen und die neuen Möglichkeiten, die sich für die Komponisten daraus ergaben. Die Arbeit vergleicht die Zweite Wiener Schule mit der Ersten, die Haydn, Mozart und Beethoven umfasst, und hebt den Einfluss des Romantismus hervor. Beispiele wie Bergs atonale Oper "Wozzeck" und Schönbergs "Erwartung" und "Pierrot Lunaire" mit ihren innovativen Techniken wie Sprechstimme und Klangfarbenmelodie werden diskutiert und im Kontext der Suche nach einer neuen musikalischen Identität analysiert.
Schlüsselwörter
Österreichische Musik, 20. Jahrhundert, Wiener Schule, Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern, Atonalität, Zwölftonmusik, Klassische Musik, Romantische Musik, Unterhaltungsmusik, Austropop, nationale Identität, musikalische Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Arbeit: "Die Musikwende der Jahrhundertwende und die Entwicklung der österreichischen Musik im 20. Jahrhundert"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Musik in Österreich im 20. Jahrhundert und deren Beitrag zur österreichischen Identität. Sie analysiert den Wandel von traditioneller Musik zu experimentellen Formen und den Einfluss gesellschaftlicher und politischer Ereignisse.
Welche Epochen und Musikstile werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die Wiener Schule (Schönberg, Berg, Webern), die klassische und romantische Musik, Unterhaltungsmusik und den Austropop. Sie analysiert den Übergang von der Tonalität zur Atonalität und den Einfluss des Romantismus.
Welche zentralen Themen werden untersucht?
Zentrale Themen sind die experimentellen Kompositionstechniken der Wiener Schule, die Entwicklung der klassischen und romantischen Musik in Österreich, der Aufstieg von Unterhaltungsmusik und Austropop, der Einfluss politischer Ereignisse auf die Musik und die Frage nach einer österreichischen musikalischen Identität.
Welche Komponisten werden besonders hervorgehoben?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Komponisten der Zweiten Wiener Schule: Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton Webern. Ihre Werke und deren innovative Techniken (z.B. Atonalität, Zwölftonmusik, Sprechstimme) werden im Detail analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, vier Kapiteln und einem Schluss. Die Einleitung beschreibt den Wandel in der Musik um die Jahrhundertwende. Die Kapitel behandeln die Wiener Schule, die Weiterentwicklung klassischer und romantischer Musik, den Aufstieg von Unterhaltungsmusik und Austropop. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entwicklung der österreichischen Musik im 20. Jahrhundert zu verstehen und deren Einfluss auf die österreichische Identität zu analysieren. Sie beleuchtet die komplexen Wechselwirkungen zwischen musikalischen Innovationen, gesellschaftlichen Veränderungen und politischen Ereignissen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Österreichische Musik, 20. Jahrhundert, Wiener Schule, Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern, Atonalität, Zwölftonmusik, Klassische Musik, Romantische Musik, Unterhaltungsmusik, Austropop, nationale Identität, musikalische Identität.
Welche konkreten musikalischen Beispiele werden genannt?
Beispiele wie Bergs atonale Oper "Wozzeck" und Schönbergs "Erwartung" und "Pierrot Lunaire" werden im Kontext der Suche nach einer neuen musikalischen Identität analysiert.
Wie wird der Einfluss des Romantismus behandelt?
Die Arbeit hebt den Einfluss des Romantismus auf die Entwicklung der Musik im 20. Jahrhundert hervor, insbesondere im Vergleich zwischen der Ersten und Zweiten Wiener Schule.
Welche Kapitelzusammenfassung wird gegeben?
Die Arbeit bietet detaillierte Zusammenfassungen jedes Kapitels, beginnend mit der Einleitung, die den Wandel im Musikverständnis des 19. Jahrhunderts beschreibt, bis hin zu den einzelnen Kapiteln, die sich jeweils mit den spezifischen Entwicklungen der jeweiligen Musikepochen auseinandersetzen.
- Quote paper
- Jeremy Krider (Author), 2006, Musikrichtungen Österreichs im 20. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153797