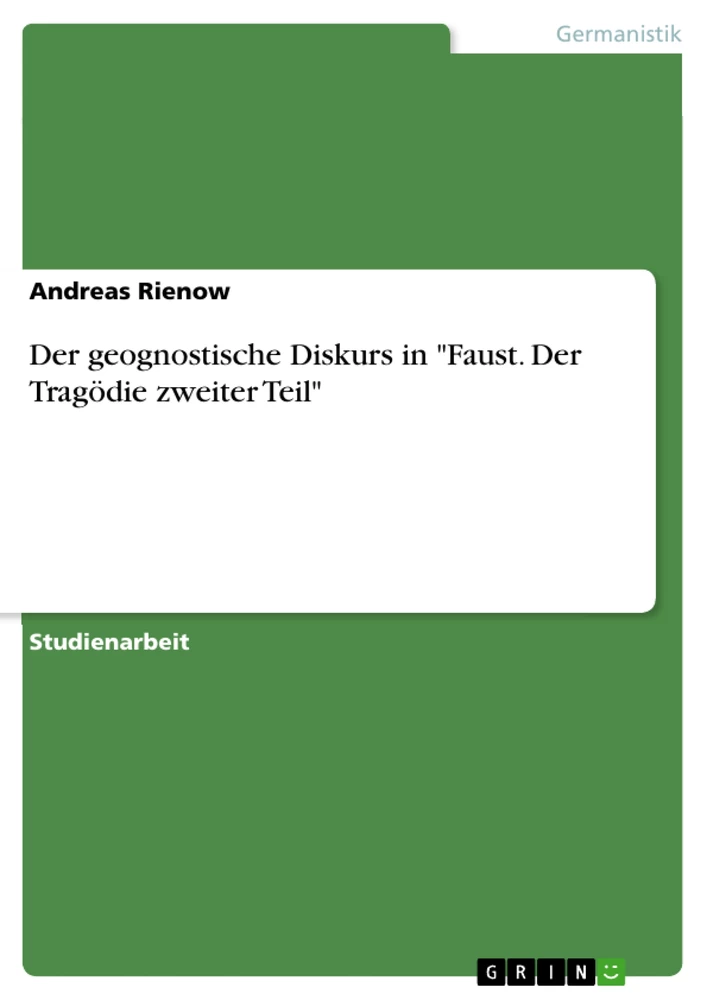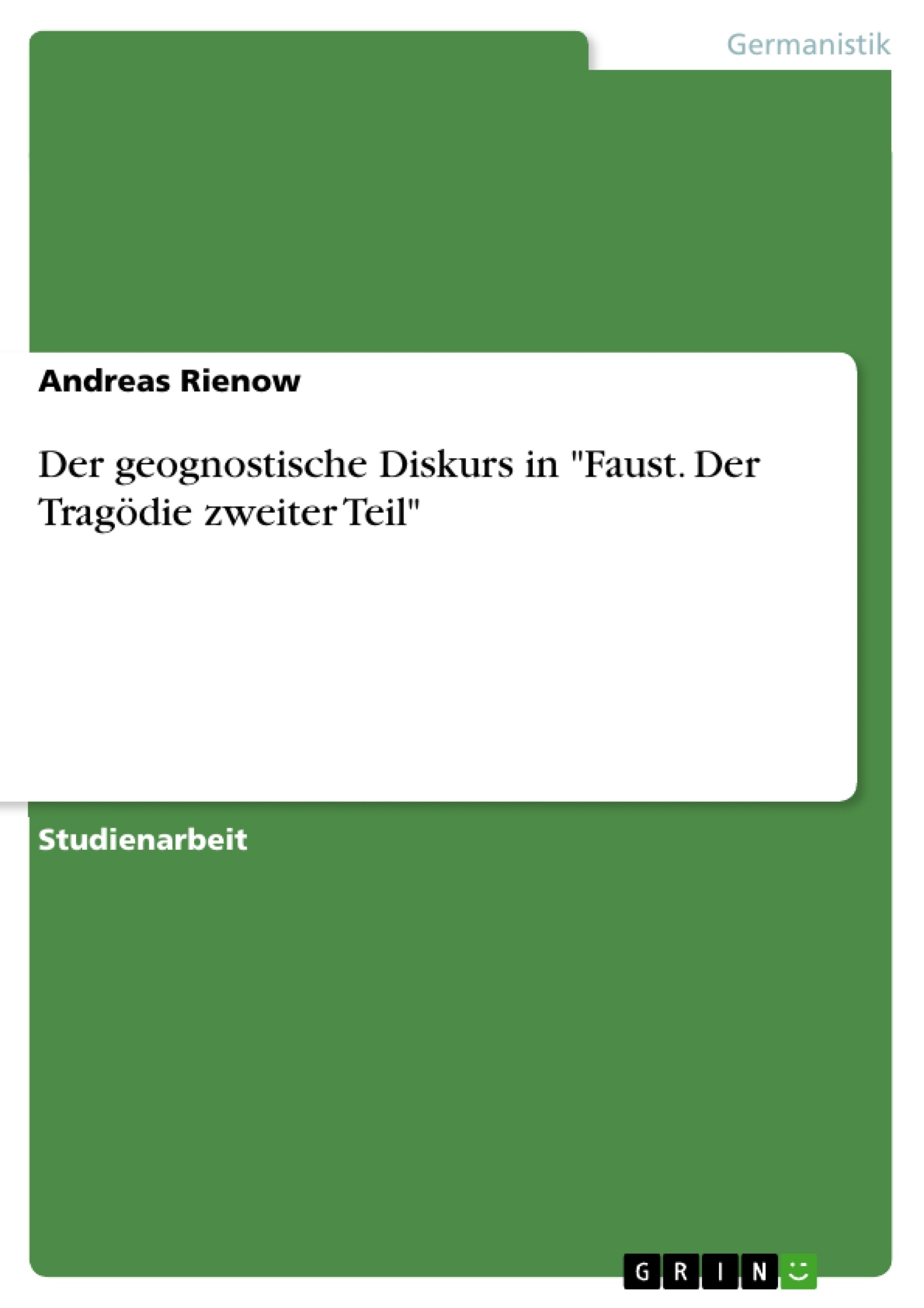Die vorliegende Studienarbeit beschäftigt sich mit dem geognostischen Diskurs in Johann Wolfgang von Goethes „Faust – der Tragödie zweiter Teil“. Anhand der Debatte zwischen Thales und Anaxagoras in der „Klassischen Walpurgisnacht“ im zweiten Akt und der Auseinandersetzung zwischen Faust und Mephistopheles in der Hochgebirgsszene des vierten Akts werden die unterschiedlichen Positionen über die Erdentstehung hinsichtlich ihrer Vertreter, ihrer sprachlichen Darstellung und ihrer Bedeutung für den Gesamtzusammenhang der Handlung analysiert.
Damit jedoch die eigentliche Dimension des Diskurses in ihrem gesamten Ausmaß annähernd erfasst werden kann, gilt es neben der werkimmanenten Interpretation auch intertextuelle Bezüge zu Fragen und Kontroversen der Entstehungszeit mit einzubeziehen. Ein Hauptaugenmerk wird auf die geognostischen Paradigmen von Plutonismus und Neptunismus gelegt, deren Vertreter zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine intensive Debatte in der Fachwissenschaft ausfochten. Dabei soll den Fragen nachgegangen werden, inwieweit sich die divergierenden Positionen in „Faust II“ wiederfinden lassen und inwiefern sie mit Goethes naturphilosophischen, ästhetischen, und gesellschaftlichen Konzeptionen korrelieren.
Als Einführung in die Thematik werden ein kurzer Überblick über den aktuellen Forschungsstand sowie ein Abriss der Partizipation Goethes an den Ideenkreisen von Neptunisten und Plutonisten gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorwort
- Aktueller Forschungsstand
- Goethe und die Lehren von der Natur
- Die Neptunismus-Plutonismus Kontroverse
- Goethes Naturphilosophie in Geognosie und Dichtung
- Die geognostischen Dispute in „Faust II“
- Geognostische Antagonismen in der „Klassischen Walpurgisnacht“
- Ereigniskontext
- Thales vs. Anaxagoras, Neptunismus vs. Plutonismus
- Der Geognostische Disput zwischen Mephistopheles und Faust
- Reflexe des geognostischen Diskurses
- Ursprung im Werden - Polarität und Steigerung
- Geognosie und Entwicklung in der „Klassischen Walpurgisnacht“
- Erdwissenschaft und Entstehung in „Hochgebirg“
- Lineare Evolution contra zyklische Revolution
- Transformationsgedanke in der „Klassischen Walpurgisnacht“
- Transformationsgedanke in „Hochgebirg“
- Schlussbemerkung - Goethe im geognostischen Diskurs?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den geognostischen Diskurs in Goethes „Faust II“, insbesondere die Auseinandersetzungen um die Entstehung der Erde. Sie analysiert die Debatte zwischen Thales und Anaxagoras in der „Klassischen Walpurgisnacht“ und den Disput zwischen Faust und Mephistopheles, um die verschiedenen Positionen, ihre sprachliche Darstellung und ihre Bedeutung für die Handlung zu beleuchten. Dabei werden intertextuelle Bezüge zu den geognostischen Kontroversen des frühen 19. Jahrhunderts, insbesondere zwischen Neptunisten und Plutonisten, berücksichtigt und Goethes naturphilosophische, ästhetische und gesellschaftliche Konzeptionen in Bezug gesetzt.
- Der geognostische Diskurs in Goethes „Faust II“
- Die Kontroverse zwischen Neptunismus und Plutonismus
- Goethes naturphilosophische Positionen
- Die sprachliche Darstellung geognostischer Ideen in „Faust II“
- Der Einfluss des geognostischen Diskurses auf die Handlung von „Faust II“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des geognostischen Diskurses in Goethes „Faust II“ ein. Sie gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand, der den Diskurs oft nur am Rande behandelt, und nennt wichtige Wissenschaftler wie Wolfgang von Engelhardt, Katharina Mommsen, Michaela Haberkorn und Aeka Ishihara, deren Werke sich mit Goethe und der Geologie bzw. der Naturwissenschaft seiner Zeit befassen. Die Einleitung skizziert auch den historischen Kontext, die Neptunismus-Plutonismus-Kontroverse, und erläutert die Methode der Arbeit, die sowohl werk-immanente als auch intertextuelle Ansätze verfolgt.
2. Die geognostischen Dispute in „Faust II“: Dieses Kapitel analysiert die geognostischen Auseinandersetzungen in „Faust II“, insbesondere in der „Klassischen Walpurgisnacht“ und der Hochgebirgsszene. Es untersucht die gegensätzlichen Positionen der beteiligten Figuren und stellt diese in den Kontext der damaligen wissenschaftlichen Debatte zwischen Neptunisten und Plutonisten. Die sprachliche Gestaltung der Dispute und deren Bedeutung für den Handlungsverlauf werden im Detail betrachtet.
3. Reflexe des geognostischen Diskurses: Kapitel 3 untersucht die Reflexionen des geognostischen Diskurses in „Faust II“. Es beleuchtet die Konzepte von Ursprung, Werden, Polarität und Steigerung und setzt diese in Beziehung zu den gegensätzlichen Vorstellungen von linearer Evolution und zyklischer Revolution. Die Analyse betrachtet die „Klassische Walpurgisnacht“ und die Hochgebirgsszene, um den Transformationsgedanken in Goethes Werk zu verdeutlichen und seine naturphilosophischen Positionen zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Goethe, Faust II, Geognosie, Neptunismus, Plutonismus, Erdentstehung, Naturphilosophie, „Klassische Walpurgisnacht“, Hochgebirgsszene, wissenschaftliche Debatte, Intertextualität, Transformationsgedanke, Evolution, Revolution.
Häufig gestellte Fragen zu: Goethes geognostischer Diskurs in "Faust II"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den geognostischen Diskurs in Goethes "Faust II", insbesondere die Debatten um die Entstehung der Erde. Der Fokus liegt auf den Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen geognostischen Positionen, ihrer sprachlichen Darstellung in Goethes Werk und ihrer Bedeutung für die Handlung von "Faust II".
Welche geognostischen Kontroversen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Kontroverse zwischen Neptunismus und Plutonismus, die im frühen 19. Jahrhundert die geologische Wissenschaft prägte. Im Zentrum stehen die gegensätzlichen Ansichten über die Entstehung der Erde und wie diese in "Faust II" – insbesondere in der "Klassischen Walpurgisnacht" und der Hochgebirgsszene – literarisch umgesetzt werden.
Welche Figuren und Szenen aus "Faust II" werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die "Klassische Walpurgisnacht", wo die Debatte zwischen Thales und Anaxagoras als Metapher für den Neptunismus-Plutonismus-Konflikt interpretiert wird, und den geognostischen Disput zwischen Faust und Mephistopheles. Die Hochgebirgsszene wird ebenfalls untersucht, um die Reflexionen des geognostischen Diskurses zu beleuchten.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verfolgt sowohl werk-immanente als auch intertextuelle Ansätze. Sie analysiert die sprachliche Gestaltung der geognostischen Ideen in "Faust II" und setzt diese in Beziehung zu den historischen geognostischen Kontroversen und Goethes naturphilosophischen, ästhetischen und gesellschaftlichen Konzeptionen.
Welche Wissenschaftler werden im Zusammenhang mit Goethe und der Geologie erwähnt?
Die Arbeit nennt und bezieht sich auf die Werke wichtiger Wissenschaftler, die sich mit Goethe und der Naturwissenschaft seiner Zeit befassen, darunter Wolfgang von Engelhardt, Katharina Mommsen, Michaela Haberkorn und Aeka Ishihara.
Welche Konzepte werden im Zusammenhang mit dem geognostischen Diskurs untersucht?
Die Arbeit beleuchtet Konzepte wie Ursprung, Werden, Polarität, Steigerung, lineare Evolution und zyklische Revolution und untersucht, wie diese in "Faust II" im Kontext der geognostischen Debatte dargestellt werden.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die den Forschungsstand und die Methode beschreibt, ein Kapitel zur Analyse der geognostischen Dispute in "Faust II", ein Kapitel zu den Reflexionen des Diskurses und eine Schlussbemerkung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Faust II, Geognosie, Neptunismus, Plutonismus, Erdentstehung, Naturphilosophie, "Klassische Walpurgisnacht", Hochgebirgsszene, wissenschaftliche Debatte, Intertextualität, Transformationsgedanke, Evolution, Revolution.
- Quote paper
- Andreas Rienow (Author), 2009, Der geognostische Diskurs in "Faust. Der Tragödie zweiter Teil" , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153744