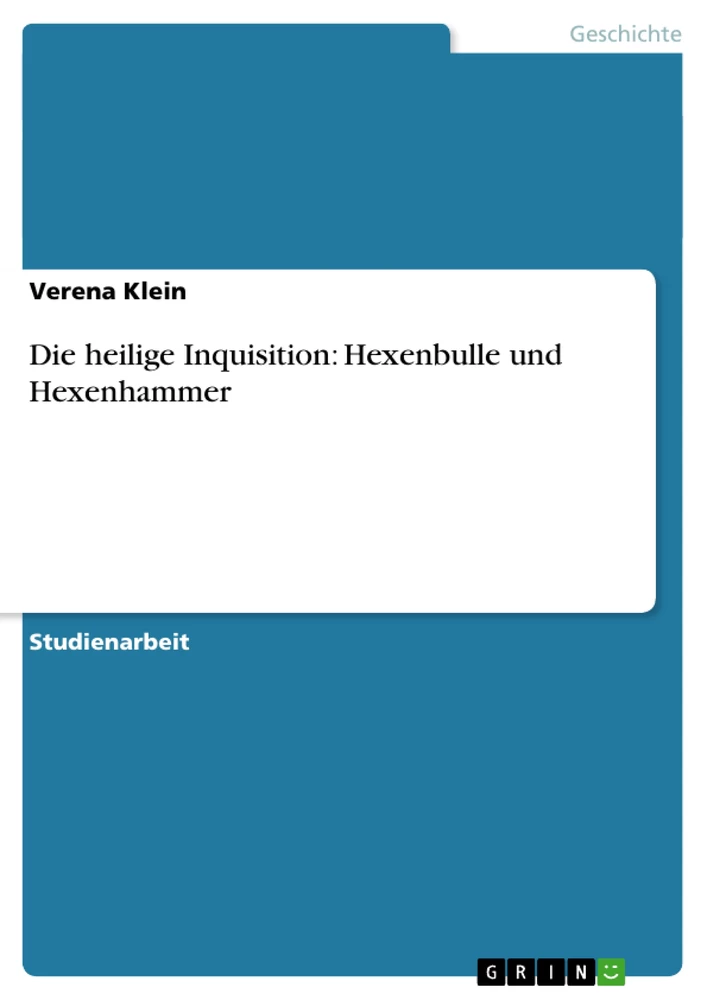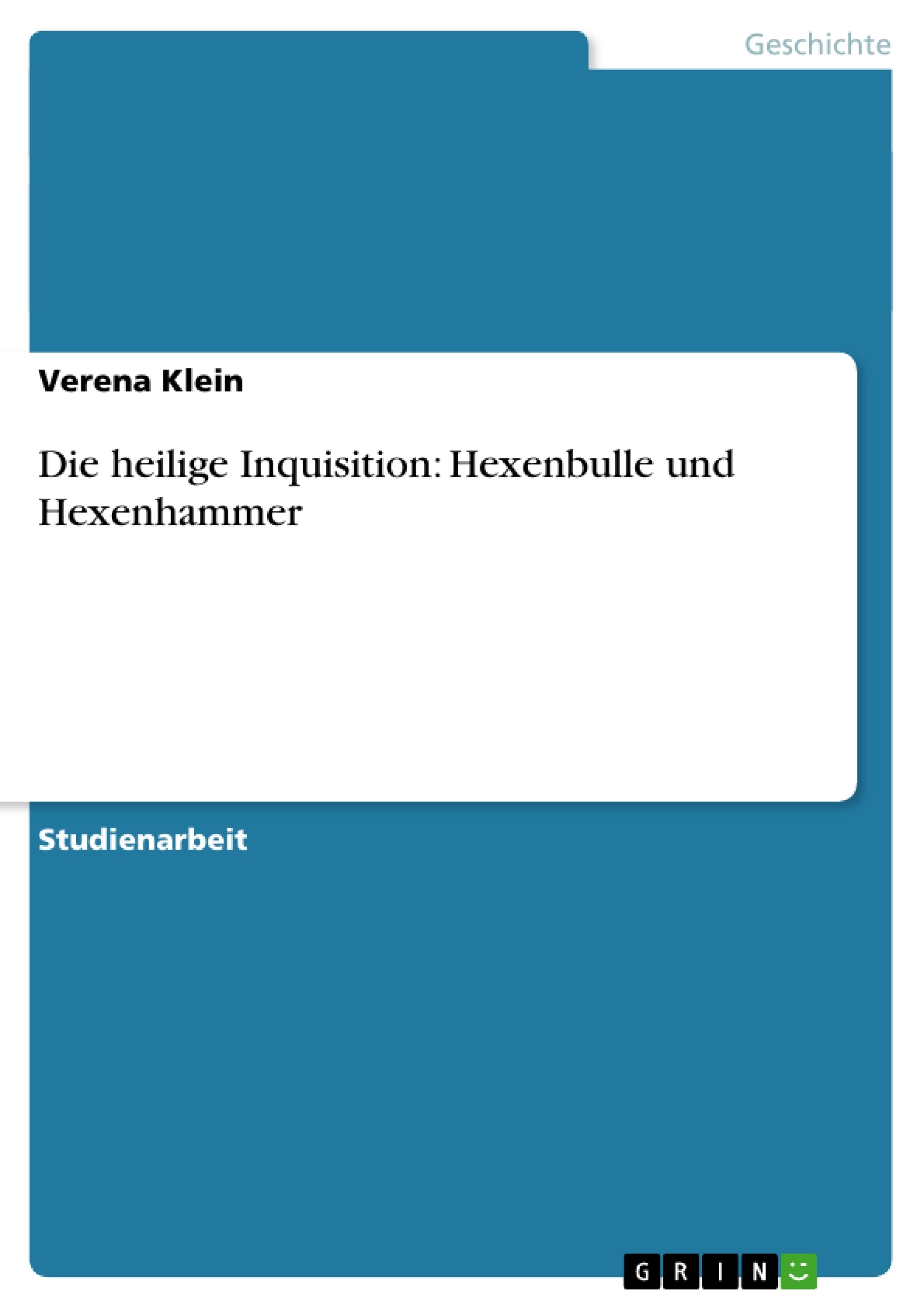Jeder von uns hat wohl eine bestimmte Vorstellung wenn es um den Begriff Hexe
geht. In nahezu jedem Märchen beispielsweise taucht als Pendant zum Guten,
Reinen, das „Böse“ auf, entweder in Form des Teufels selbst, oder eben der Hexe.
Der Begriff „Hexe“ ist ein Sammelbegriff, der zum Teil auf sehr altem Zauber- und
Gespensterglauben beruht.
Unzählige Gestalten aus Märchen, Sagen und Mythen haben Teil am Bild der Hexe.
Schon die Germanen hatten komplexe Vorstellungen von ganzen Götterwelten und
–hierarchien, und damit auch von Wesen, die durch Zauber Schaden bringen.
Die Hexe stellt ein solches Wesen weiblichen Geschlechts dar.
Diese Auffassungen wurden innerhalb der Christianisierungsprozesse strikt
abgelehnt ( von seiten der Missionare) und versucht durch kirchliche Elemente zu
ersetzen.
Somit galt der Volksaberglaube nun als Missachtung des ersten Gebotes: Du sollst
keine Götter haben neben mir.
Trotzdem blieb das Bild des Bösen erhalten, jedoch wurde von nun an die
Bezeichnung „Teufel“ verwendet.
Bereits in den germanischen Hexensagen wird davon gesprochen, dass Hexen
dreierlei schädigende Tätigkeiten ausüben:
Sie fahren nachts aus, sie zaubern Wetter, sie verderben Felder und sie behexen
Menschen und Tiere mit Siechtum.
Aus Furcht, ihre soziale Stellung zu verlieren, verwandelt sich die Hexe z.B.
in Tiergestalten, nimmt Scheingestalten an oder besucht die Kirche, um nicht
erkannt zu werden.
Der Hexenglaube verdichtete sich im Spätmittelalter zu einer eigenen Lehre, wonach
die Hexe mit dem Teufel Buhlschaft trieb. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1.) Der Hexereivorwurf
- 1.1) Was galt als Indiz für Ketzerei
- 2.) Die Hexenbulle
- 3.) Der Hexenhammer
- 3.1) Die Verfasser des Hexenhammers
- 3.2) Der historische Hintergrund des Hexenhammers
- 4.) Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Hexereivorwurfs und die Rolle der Hexenbulle und des Hexenhammers im konfessionellen Zeitalter. Sie beleuchtet die historischen Hintergründe und die Methoden der Hexenverfolgung. Der Fokus liegt auf dem Wandel des Hexenbildes und der Rechtfertigung der Hexenprozesse.
- Der Wandel des Hexenbildes im Laufe der Geschichte
- Die Indizien und Methoden zur Überführung von Hexen
- Die Rolle der Kirche und des Staates bei der Hexenverfolgung
- Der Einfluss der Hexenbulle auf die Hexenprozesse
- Der historische Kontext und die Bedeutung des Hexenhammers
Zusammenfassung der Kapitel
1.) Der Hexereivorwurf: Dieses Kapitel erörtert die Entwicklung des Begriffs „Hexe“ von germanischen Vorstellungen über Zauberwesen bis hin zur systematischen Hexenlehre des Spätmittelalters. Es wird deutlich, wie das Bild der Hexe im Kontext der Christianisierung transformiert wurde, wobei der Volksglaube als Missachtung des ersten Gebotes interpretiert wurde. Der Text beschreibt die gängigen Vorstellungen von schädlichen Hexentätigkeiten (Wetterzauber, Verderben von Feldern, Krankheiten) und die Strategien von Hexen, um ihre soziale Stellung zu schützen. Die Zusammenfassung der verschiedenen regionalen Auffassungen und die Entwicklung der Hexenlehre im Spätmittelalter als Grundlage für die Hexenprozesse bilden den krönenden Abschluss des Kapitels.
1.1) Was galt als Indiz für Ketzerei?: Dieses Unterkapitel listet detailliert verschiedene Indizien auf, die im Kontext der Hexenverfolgung als Beweis für Ketzerei galten. Diese reichen von Verhaltensweisen wie ungewöhnlichem Kirchenbesuch oder auffälligem Auftreten bis hin zu physischen Merkmalen wie einem „hexenhaften“ Aussehen oder einem Hexenmal (Stigma diabolicum). Der Abschnitt beschreibt verschiedene Hexenproben, wie die Wasserprobe oder die Feuerprobe, die oft zu Ungunsten der Angeklagten ausfielen. Die Beschreibung absurder Methoden der damaligen Rechtspflege, inklusive Folter, unterstreicht die Ungerechtigkeit des Systems.
2.) Die Hexenbulle: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entstehung und die Bedeutung der Hexenbulle von Papst Innozenz VIII. Es beschreibt den Kontext der zunehmenden Hexenverfolgung in Deutschland und die Ablehnung der Inquisitoren Sprenger und Institoris durch deutsche Fürsten und Bischöfe. Die Bulle vom 5. Dezember 1484 wird als moralische und faktische Grundlage für die Ausweitung der Hexenprozesse in Deutschland dargestellt. Das Kapitel hebt die Schlüsselrolle des Papstes bei der Legitimierung der Hexenverfolgung hervor.
Schlüsselwörter
Hexenverfolgung, Hexenbulle, Hexenhammer, Inquisition, Ketzerei, Mittelalter, Spätmittelalter, Volksglaube, Hexenproben, Folter, Stigma diabolicum, Papst Innozenz VIII, Jacob Sprenger, Heinrich Institoris.
Häufig gestellte Fragen zum Text "Der Hexereivorwurf, die Hexenbulle und der Hexenhammer"
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über den Hexereivorwurf, die Hexenbulle und den Hexenhammer im konfessionellen Zeitalter. Er untersucht die Entwicklung des Hexenbildes, die Methoden der Hexenverfolgung, die Rolle der Kirche und des Staates sowie den historischen Kontext und die Bedeutung der genannten Schlüsselwerke. Der Text enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und ein Stichwortverzeichnis.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind der Wandel des Hexenbildes im Laufe der Geschichte, die Indizien und Methoden zur Überführung von Hexen, die Rolle der Kirche und des Staates bei der Hexenverfolgung, der Einfluss der Hexenbulle auf die Hexenprozesse und der historische Kontext sowie die Bedeutung des Hexenhammers. Der Text beleuchtet auch die Entwicklung des Begriffs "Hexe" von germanischen Vorstellungen bis zur systematischen Hexenlehre des Spätmittelalters.
Was ist die Hexenbulle und welche Bedeutung hat sie?
Die Hexenbulle von Papst Innozenz VIII. (5. Dezember 1484) wird als moralische und faktische Grundlage für die Ausweitung der Hexenprozesse in Deutschland dargestellt. Der Text beschreibt den Kontext der zunehmenden Hexenverfolgung und die Ablehnung der Inquisitoren Sprenger und Institoris durch deutsche Fürsten und Bischöfe. Die Bulle wird als Schlüsselrolle des Papstes bei der Legitimierung der Hexenverfolgung hervorgehoben.
Was ist der Hexenhammer (Malleus Maleficarum)?
Der Text behandelt den Hexenhammer als ein zentrales Werk zur Hexenverfolgung. Er beschreibt die Verfasser (Jacob Sprenger und Heinrich Institoris), den historischen Hintergrund und die Bedeutung des Werkes für die Ausweitung und Rechtfertigung der Hexenprozesse. Der Text beleuchtet den Inhalt und die Auswirkungen des Buches auf die Praxis der Hexenverfolgung.
Welche Indizien galten als Beweis für Ketzerei im Kontext der Hexenverfolgung?
Der Text listet detailliert verschiedene Indizien auf, die als Beweis für Ketzerei galten. Dazu gehören ungewöhnlicher Kirchenbesuch, auffälliges Auftreten, ein "hexenhaftes" Aussehen, ein Hexenmal (Stigma diabolicum) und verschiedene Verhaltensweisen. Auch die Beschreibung absurder Methoden der damaligen Rechtspflege, inklusive Folter, wird thematisiert.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in jedem Kapitel?
Der Text gliedert sich in die Kapitel "Der Hexereivorwurf" (mit dem Unterkapitel "Was galt als Indiz für Ketzerei?"), "Die Hexenbulle" und "Der Hexenhammer". Das erste Kapitel erörtert die Entwicklung des Begriffs "Hexe" und die gängigen Vorstellungen von schädlichen Hexentätigkeiten. Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Hexenbulle und ihre Bedeutung für die Hexenverfolgung. Das dritte Kapitel behandelt den Hexenhammer, seine Verfasser und seinen historischen Kontext.
Welche Schlüsselwörter sind im Text relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Hexenverfolgung, Hexenbulle, Hexenhammer, Inquisition, Ketzerei, Mittelalter, Spätmittelalter, Volksglaube, Hexenproben, Folter, Stigma diabolicum, Papst Innozenz VIII, Jacob Sprenger, Heinrich Institoris.
Für wen ist dieser Text bestimmt?
Der Text ist für akademische Zwecke konzipiert und eignet sich zur Analyse der Themen Hexenverfolgung, Hexenbulle und Hexenhammer. Er dient der strukturierten und professionellen Auseinandersetzung mit diesen historischen Themen.
- Quote paper
- Verena Klein (Author), 2003, Die heilige Inquisition: Hexenbulle und Hexenhammer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15369