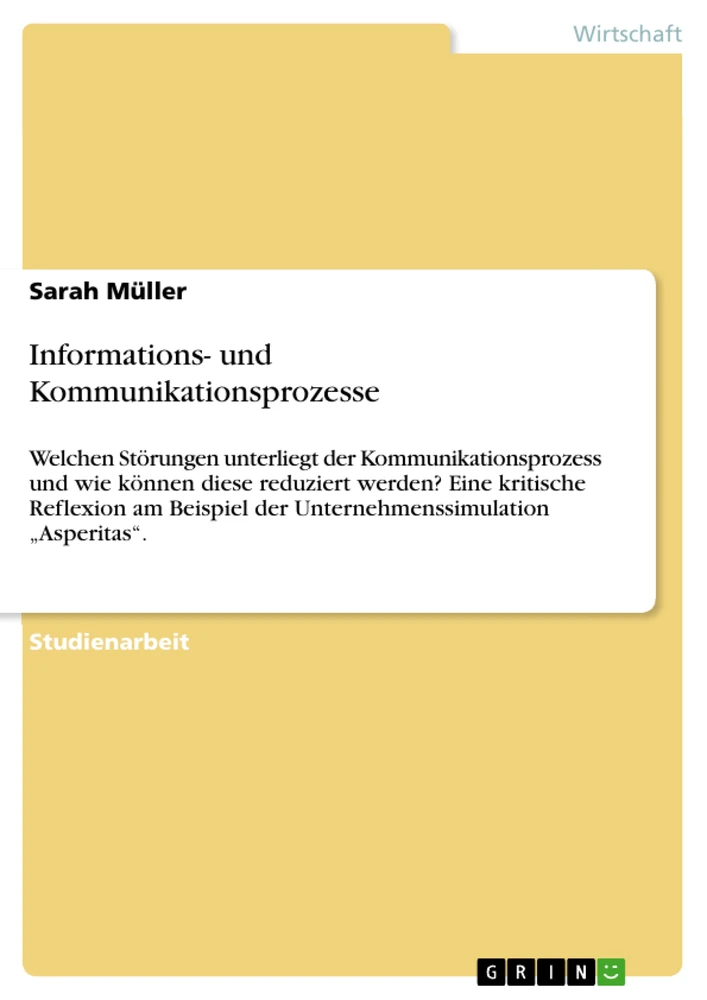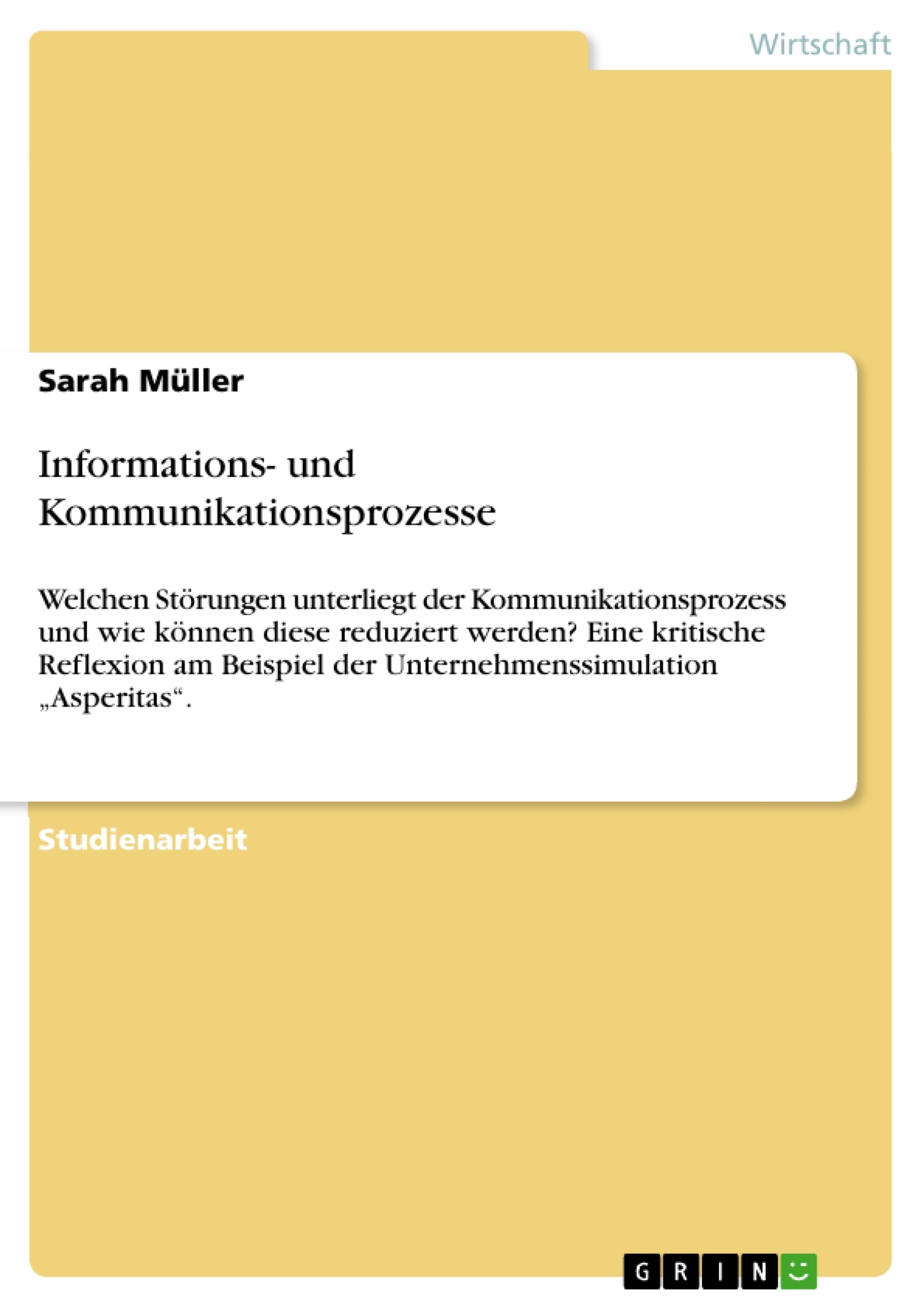Kommunikation wird mittlerweile als Erfolgsfaktor einer Unternehmung betrachtet und nimmt eine sehr bedeutende Rolle ein. Es ist somit zunehmend wichtig im Arbeitsalltag eine ausreichende Kommunikation sicherzustellen. Doch schafft quantitativ mehr Kommunikation ein besseres Verständnis?
„Aus vielen Worten entspringt ebensoviel Gelegenheit zum Mi[ss]verständnis.“
(William James, 1842-1910)
Wie bereits William James im 19. Jahrhundert erkannt hat, kann Kommunikation auch zahlreiche Probleme mit sich bringen und zu Missverständnissen führen.
Es stellt sich die zentrale Frage, welchen Störungen der Kommunikationsprozess unterliegt und wie diese reduziert werden können.
Diese Arbeit wird nach einer Darstellung der mit dem Kommunikationsprozess in Zusammenhang stehenden Begrifflichkeiten die Funktionsweise eines Sender-Empfänger-Modells aufzeigen. Dabei spielt sowohl die asymmetrische als auch die symmetrische Kommunikationsweise eine bedeutende Rolle. Darüber hinaus werden mögliche Kommunikationsstörungen aufgezeigt, welche sowohl internen als auch externen Ursprungs sein können. Auch eine praktische praktische, dem Sender-Empfänger-Modell folgende Anwendung der theoretischen Inhalte am Organisationslaboratorium „Asperitas“ sind Inhalt dieser Ausführungen. Eine kritische Reflexion mit Maßnahmen und Verbesserungsmöglichkeiten wird diese Arbeit abrunden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- BEGRIFFLICHE GRUNDLAGEN.
- DEFINITION INFORMATION
- DEFINITION KOMMUNIKATION
- SENDER- EMPFÄNGER- MODELL.
- ASYMMETRISCHE KOMMUNIKATION
- SYMMETRISCHE KOMMUNIKATION..
- KOMMUNIKATIONSSTÖRUNGEN
- DEFINITION.
- STÖRQUELLEN
- INTERN
- EXTERN
- RÜCKSCHLÜSSE AUF PLANSPIEL ASPERITAS..
- ASYMMETRISCHE KOMMUNIKATION
- SYMMETRISCHE KOMMUNIKATION.
- KOMMUNIKATIONSSTÖRUNGEN.
- Intern..
- Extern..
- KRITISCHE REFLEXION.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Kommunikationsprozess und den Störungen, denen er unterliegt. Sie untersucht die Funktionsweise eines Sender-Empfänger-Modells, insbesondere die asymmetrischen und symmetrischen Kommunikationsformen. Darüber hinaus werden mögliche interne und externe Kommunikationsstörungen identifiziert und anhand des Planspiels „Asperitas“ analysiert. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Komplexität der Kommunikation zu entwickeln und Ansatzpunkte zur Reduzierung von Störungen aufzuzeigen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Information"
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Kommunikation"
- Funktionsweise des Sender-Empfänger-Modells
- Analyse von Kommunikationsstörungen
- Praktische Anwendung am Planspiel „Asperitas“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit befasst sich mit der Einleitung und stellt die Relevanz von Kommunikation im Arbeitsalltag dar. Im zweiten Kapitel werden die Begriffe „Information“ und „Kommunikation“ definiert und aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Kapitel drei führt in das Sender-Empfänger-Modell ein und erklärt die beiden grundlegenden Kommunikationsformen: asymmetrische und symmetrische Kommunikation. Kapitel vier widmet sich dem Thema Kommunikationsstörungen, wobei interne und externe Störquellen unterschieden werden. Das fünfte Kapitel analysiert das Planspiel „Asperitas“ im Hinblick auf die vorgestellten Kommunikationsformen und Störungen. Die Arbeit schließt mit einer kritischen Reflexion und stellt mögliche Maßnahmen zur Verbesserung des Kommunikationsprozesses vor.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Begriffen Information, Kommunikation, Sender-Empfänger-Modell, asymmetrische Kommunikation, symmetrische Kommunikation, Kommunikationsstörungen, interne und externe Störquellen, Planspiel „Asperitas“, kritische Reflexion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Information und Kommunikation?
Information ist der sachliche Gehalt einer Nachricht, während Kommunikation der gesamte Prozess des Austauschs zwischen Sender und Empfänger ist, inklusive sozialer und psychologischer Aspekte.
Wie funktioniert das Sender-Empfänger-Modell?
Ein Sender kodiert eine Nachricht und schickt sie über einen Kanal an einen Empfänger, der sie dekodiert. Dabei kann die Kommunikation asymmetrisch (einseitig) oder symmetrisch (wechselseitig) ablaufen.
Welche Arten von Kommunikationsstörungen gibt es?
Man unterscheidet interne Störungen (z.B. Vorurteile, Emotionen des Senders/Empfängers) und externe Störungen (z.B. Lärm, technische Defekte, unklare Signale).
Was wurde im Planspiel "Asperitas" untersucht?
Im Organisationslaboratorium "Asperitas" wurden die theoretischen Kommunikationsmodelle praktisch angewendet, um Störquellen in einer simulierten Arbeitsumgebung zu identifizieren.
Wie lassen sich Missverständnisse in der Kommunikation reduzieren?
Durch Feedbackschleifen (symmetrische Kommunikation), klare Kodierung der Nachrichten und das Bewusstsein für potenzielle interne und externe Störquellen.
- Arbeit zitieren
- Sarah Müller (Autor:in), 2009, Informations- und Kommunikationsprozesse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153509