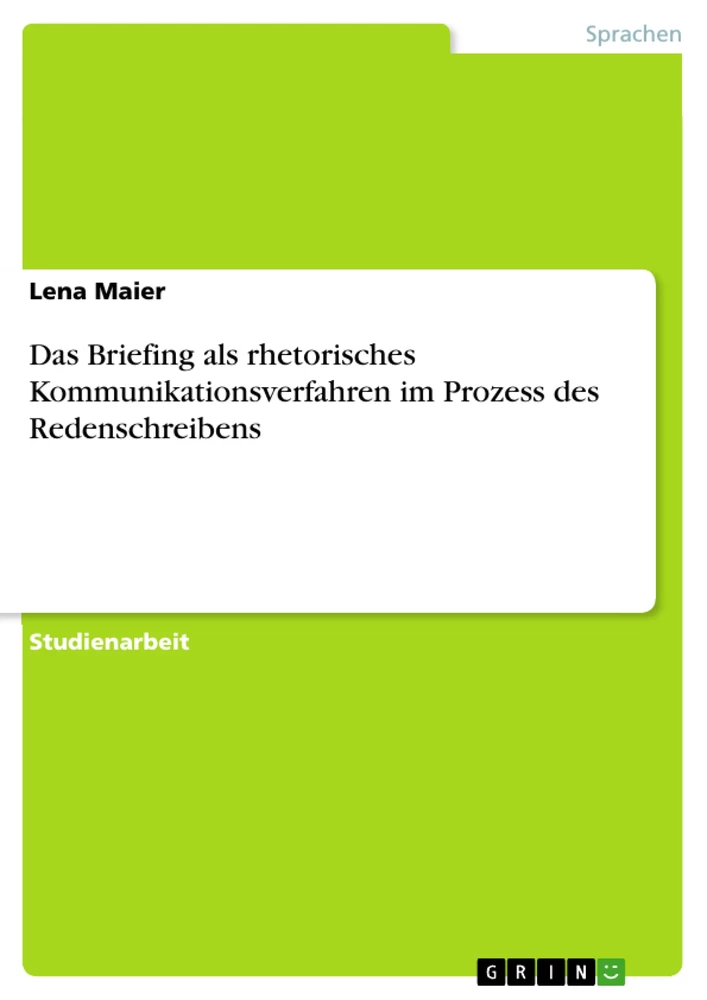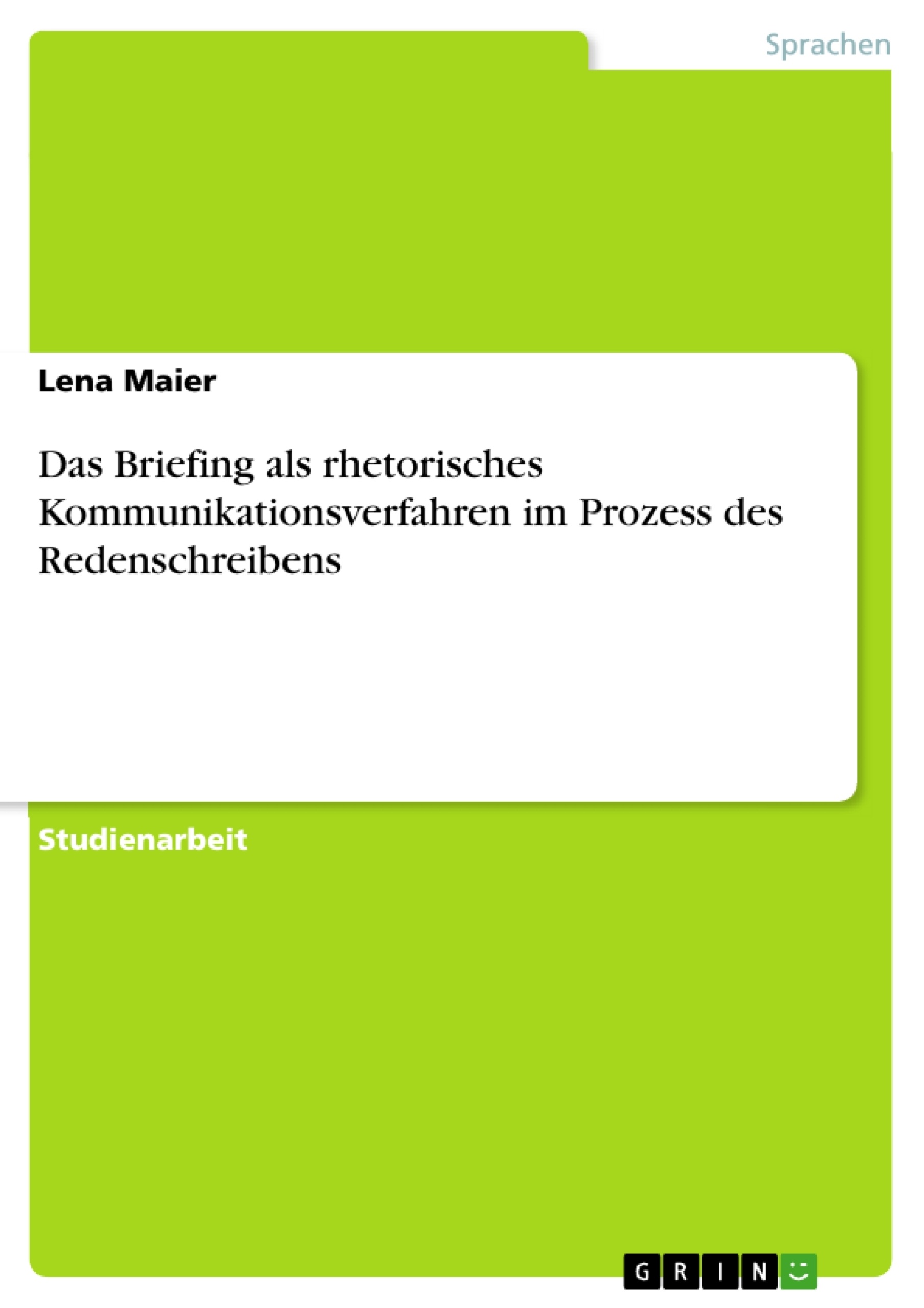Neben der Fülle an Ratgeberliteratur sind wissenschaftliche Untersuchungen und Publikationen zum Thema Briefing bisher selten. Deshalb wird das Briefing, als Teil des Prozess Redenschreiben, in dieser Arbeit in das System der Rhetorik eingebettet, um einen Zugang zum Thema zu ermöglichen, der fern der Ratgeberliteratur systemtheoretisch agiert.
Unter diesem Aspekt soll gezeigt werden, dass das Briefing als Kommunikationsverfahren zu verstehen ist. Ergo als ein Prozess, der nach der Sender-Botschaft-Empfänger-Struktur funktioniert. Mit diesem Verständnis konnte ein Modell entwickelt werden, das die Akteure des Verfahrens – Redner, Redenschreiber und Adressaten – hinsichtlich ihrer Konstitution und Relation abstrahiert. Zuvor wird dafür mit der Begriffsdefinition und einem Überblick über das Verständnis des Terminus die Basis geschaffen. Systematisch ist das Briefing in die Produktionsstadien der Rede einzugliedern, wie gezeigt werden soll, in der Position der intellectio.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitend
- 2. Rhetorisches Setting des Kommunikationsverfahrens Briefing
- 2.1. Strategischer Ansatz
- 3. Hinführend
- 3.1. Rede als Textgattung
- 3.2. Charakteristik des Redenschreibers
- 4. Wortherkunft/Definition
- 4.1. Varianten
- 5. Bestandteile des Kommunikationsverfahrens Briefing
- 5.1. Briefing als intellectio
- 5.2. Zu klärende Aspekte des Briefings
- 5.3. Modell für das Kommunikationsverfahren Briefing
- 5.4. Verhältnis und Disposition der Akteure
- 5.4.1. Auftraggeber/Primärorator
- 5.4.2. Publikum/Adressaten
- 5.4.3. Redenschreiber/Sekundärorator
- 6. Abschließend
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Briefing als rhetorisches Kommunikationsverfahren im Prozess des Redenschreibens. Sie geht über rein praxisnahe Beschreibungen hinaus und bettet das Briefing systemtheoretisch in die Rhetorik ein. Ziel ist es, das Briefing als Prozess nach dem Sender-Botschaft-Empfänger-Modell zu verstehen und ein Modell zu entwickeln, das die beteiligten Akteure (Redner, Redenschreiber, Adressaten) und deren Beziehungen beschreibt.
- Das Briefing als Kommunikationsverfahren im Kontext der Rhetorik
- Die Rolle des Redenschreibers (Sekundärorator) und seine Beziehung zum Redner (Primärorator)
- Die Bedeutung des Adressaten und die Entwicklung eines Adressatenkalküls
- Ein Modell des Briefings als Prozess
- Strategischer Ansatz im Redenschreiben
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitend: Die Einleitung stellt die Problemstellung dar: Die vorhandene Literatur zum Briefing ist meist praxisorientiert, aber nicht wissenschaftlich fundiert. Die Arbeit zielt darauf ab, das Briefing systematisch in die Rhetorik einzubetten und als Kommunikationsverfahren zu verstehen, das nach dem Sender-Botschaft-Empfänger-Modell funktioniert. Ein entwickeltes Modell abstrahiert die Akteure (Redner, Redenschreiber, Adressaten) und deren Beziehungen. Die Rolle des Redenschreibers als Sekundärorator im Verhältnis zum Primärorator (Redner) und zum Publikum wird als zentraler Aspekt hervorgehoben.
2. Rhetorisches Setting des Kommunikationsverfahrens Briefing: Dieses Kapitel beschreibt das Briefing als strategischen Kommunikationsakt. Der Redenschreiber agiert als textkonstruierende Instanz, die im Gegensatz zum Primärorator (Redner) im distanzierten Setting kommuniziert, während der Primärorator den direkten Face-to-Face-Kontakt mit dem Publikum hat. Das rhetorische Telos umfasst sowohl die Beeinflussung des Publikums (Metabolie, Systase) als auch die zufriedenstellende Erfüllung des Auftrags durch den Redenschreiber. Es werden Handlungsempfehlungen und die bewusste Konstruktion von Botschaften durch den Redenschreiber betont.
3. Hinführend: Der Abschnitt "Rede als Textgattung" definiert die Rede als mündlich vorgetragenen, anlassbezogenen Prosatext und betrachtet sie als kommunikatives Ereignis und textuelles Phänomen. Der Fokus liegt auf der Beeinflussung des Publikums (Metabolie), die durch Überzeugungstechniken erreicht werden soll. Der Abschnitt über die "Charakteristik des Redenschreibers" wird hier nicht zusammengefasst, da keine weiteren Informationen im gegebenen Textauszug vorhanden sind.
4. Wortherkunft/Definition: Dieses Kapitel widmet sich der Definition und Wortherkunft des Begriffs „Briefing“. Eine detaillierte Zusammenfassung des Inhalts fehlt im Textauszug.
5. Bestandteile des Kommunikationsverfahrens Briefing: Dieses Kapitel analysiert die einzelnen Bestandteile des Briefings. Es umfasst Aspekte wie das Briefing als intellectio, zu klärende Aspekte, ein Modell für das Briefing-Verfahren, und das Verhältnis der beteiligten Akteure (Auftraggeber, Publikum, Redenschreiber). Im gegebenen Textauszug fehlt eine detailliertere Beschreibung des Inhalts.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Rhetorisches Kommunikationsverfahren Briefing
Was ist der Gegenstand des Texts?
Der Text untersucht das Briefing als rhetorisches Kommunikationsverfahren im Prozess des Redenschreibens. Er geht über rein praxisnahe Beschreibungen hinaus und bettet das Briefing systemtheoretisch in die Rhetorik ein. Das Ziel ist es, das Briefing als Prozess nach dem Sender-Botschaft-Empfänger-Modell zu verstehen und ein Modell zu entwickeln, das die beteiligten Akteure (Redner, Redenschreiber, Adressaten) und deren Beziehungen beschreibt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf das Briefing als Kommunikationsverfahren im Kontext der Rhetorik, die Rolle des Redenschreibers (Sekundärorator) und seine Beziehung zum Redner (Primärorator), die Bedeutung des Adressaten und die Entwicklung eines Adressatenkalküls, ein Modell des Briefings als Prozess und den strategischen Ansatz im Redenschreiben.
Welche Akteure werden im Briefing-Prozess unterschieden?
Der Text unterscheidet drei zentrale Akteure: den Auftraggeber/Primärorator (Redner), den Redenschreiber/Sekundärorator und das Publikum/die Adressaten. Das Verhältnis und die Disposition dieser Akteure werden ausführlich analysiert.
Wie wird das Briefing im Text definiert und eingeordnet?
Das Briefing wird als strategischer Kommunikationsakt beschrieben, in dem der Redenschreiber als textkonstruierende Instanz agiert. Es wird systemtheoretisch in die Rhetorik eingebettet und als Prozess nach dem Sender-Botschaft-Empfänger-Modell verstanden.
Welche Kapitel umfasst der Text und was ist ihr jeweiliger Inhalt?
Der Text gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einleitung, die die Problemstellung und das Ziel der Arbeit darlegt; ein Kapitel zum rhetorischen Setting des Briefings; ein hinführendes Kapitel zu Rede als Textgattung und Charakteristik des Redenschreibers; ein Kapitel zur Wortherkunft und Definition von Briefing; ein Kapitel zu den Bestandteilen des Briefings (intellectio, zu klärende Aspekte, Modell, Verhältnis der Akteure); und abschließend ein zusammenfassendes Kapitel.
Was ist das Ergebnis/Modell des Textes?
Das zentrale Ergebnis ist ein Modell des Briefings als Prozess, das die beteiligten Akteure und ihre Beziehungen beschreibt. Dieses Modell soll das Verständnis des Briefings als Kommunikationsverfahren verbessern und für die Praxis nutzbar machen.
Welche Rolle spielt der Redenschreiber?
Der Redenschreiber (Sekundärorator) spielt eine zentrale Rolle. Er agiert als textkonstruierende Instanz, die im Gegensatz zum Primärorator (Redner) im distanzierten Setting kommuniziert. Seine Beziehung zum Redner und zum Publikum ist ein zentraler Aspekt der Analyse.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, der Text enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, welche die wichtigsten Punkte jedes Kapitels kurz beschreibt.
- Quote paper
- Lena Maier (Author), 2009, Das Briefing als rhetorisches Kommunikationsverfahren im Prozess des Redenschreibens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153400