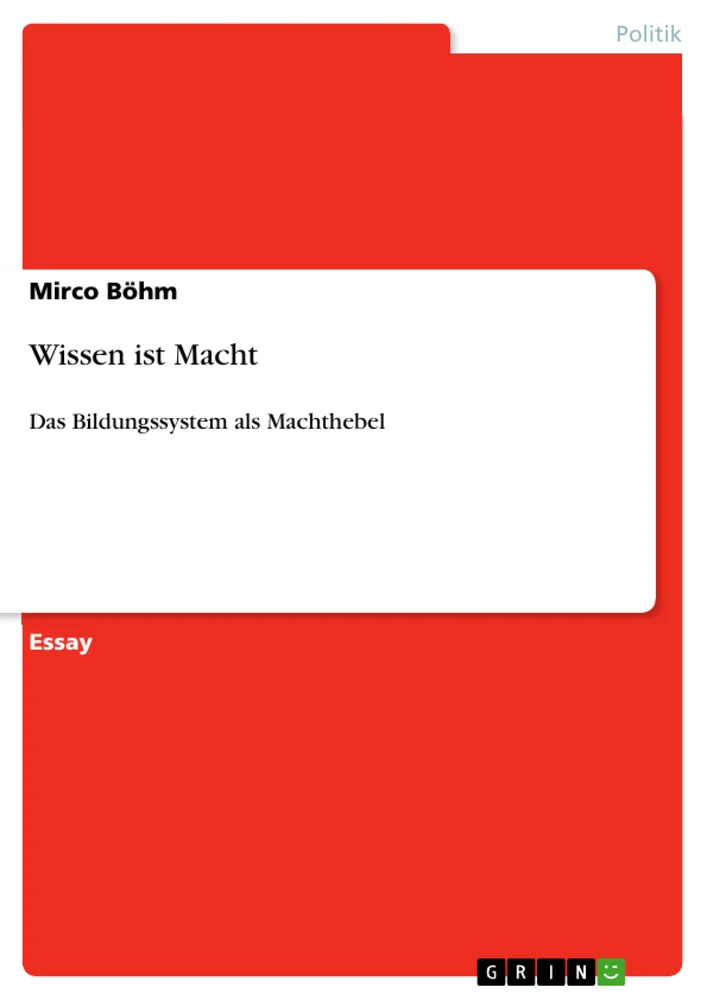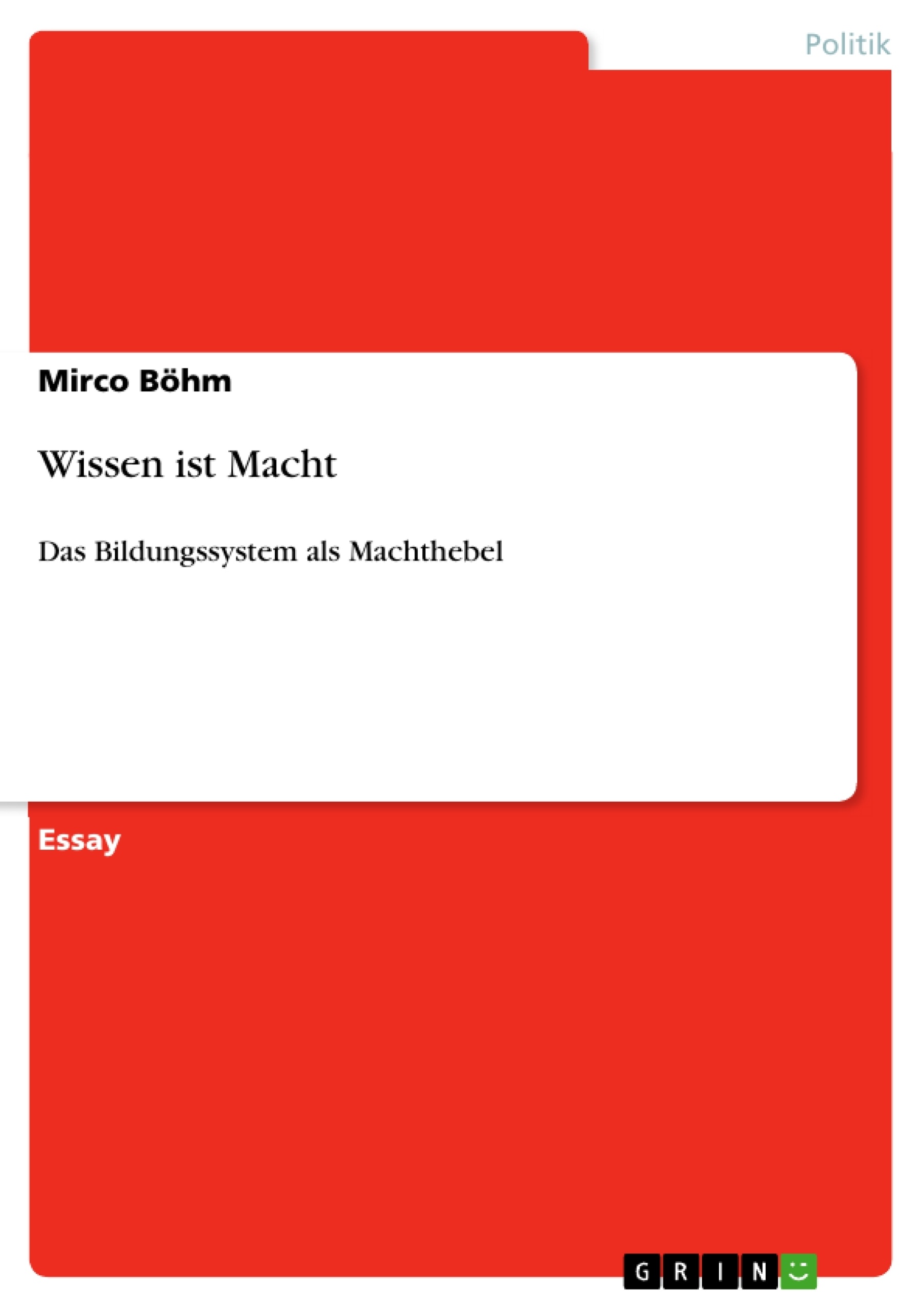Liebknecht sah das Wissen als stärkstes politisches Instrument, und das Werkzeug zur Wis-sensvermittlung, die Schule, als „mächtigstes Mittel der Befreiung“, aber auch als „mächtigs-tes Mittel der Knechtung — je nach der Natur und dem Zweck des Staats. Im freien Staat ein Mittel der Befreiung, ist die Schule im unfreien Staat ein Mittel der Knechtung. Der moderne Klassenstaat bedingt (…) seinem Wesen nach die Unfreiheit.“ Er benötigt „gehorsame Unterthanen und Sklavenseelen.“ Intelligente Sklaven seien hierbei lediglich brauchbarer, „so wird die Schule zur Dressuranstalt statt zur Bildungsanstalt. Statt Menschen zu erziehen, erzieht sie Rekruten, die auf´s Kommando in die Kaserne, diese Menschen-Maschinenfabrik, eilen; Steuerzahler, die sich nicht mucksen, (…) Lohnsklaven des Kapitals (…)“ . Der Um-kehrschluss hieraus wäre, dass dies in einer klassenlosen Gesellschaft nicht der Fall wäre. Ist dem wirklich so? Da eine klassenlose Gesellschaft bisher nicht existierte, empfiehlt es sich, als Beobachtungsobjekt einen Staat zu wählen, der zumindest seiner eigenen Auffassung nach auf dem Weg zur klassenlosen Gesellschaft die erste Stufe mit „nicht mehr anta-gonistischen, sondern nunmehr verbündeten Klassen und Schichten“ erreicht hat und in dem die „Ausbeutung des Menschen durch den Menschen [für immer] beseitigt ist“ : die DDR. Dem Zustand des noch nicht erreichten Finalziels Respekt zollend, ließe sich also folgende Fragestellung formulieren: Ist es der DDR als Gesellschaft mit dem Ziel der Klassenlosigkeit gelungen, die Schule als Mittel der Befreiung zu verwirklichen, oder gab es eher verstärkt Tendenzen zur Dressuranstalt, Rekrutenbildung und Erziehung braver Steuerzahler? Dazu soll im Folgenden zunächst ein objektiver Überblick über das DDR-Schulsystem gegeben werden, um anschließend aus der Sicht von Zeitzeugen zu erfragen, wie das System per-sönlich erlebt wurde. So soll versucht werden, die sich zwangsläufig aus Ideologie und Reali-tät ergebende Diskrepanz näher zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Ein Wort - zwei Hintergründe: Bacon und Liebknecht
- 2. Erziehungs- und politische Ziele der sozialistischen Schule und deren strukturelle Umsetzung
- 2.1. Erziehungs- und Bildungsziele und deren Konsequenzen
- 2.2. Politische Ziele
- 3. Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele
- 3.1. Verflechtung mit der Gesellschaft
- 3.2. Einbindung in Massenorganisationen
- 3.3. Das Anreiz- und Sanktionssystem
- 4. Bezug zur erlebten Wirklichkeit
- 4.1. Wie ein DDR-Lehrer das Bildungssystem einschätzt
- 4.2. Die Sicht des Schülers
- 5. Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht das DDR-Bildungssystem und analysiert dessen Funktion als Machtinstrument. Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen Wissen und Macht im Kontext der sozialistischen Ideologie und Praxis. Dabei wird die Diskrepanz zwischen den erklärten Zielen des Systems und der erlebten Realität untersucht.
- Der Zusammenhang zwischen Wissen und Macht im Denken von Bacon und Liebknecht
- Die Erziehungs- und politischen Ziele der sozialistischen Schule in der DDR
- Die Umsetzung der Ziele durch konkrete Maßnahmen des DDR-Schulsystems
- Die subjektive Wahrnehmung des Bildungssystems durch Lehrer und Schüler in der DDR
- Die Diskrepanz zwischen Ideologie und Realität im DDR-Schulsystem
Zusammenfassung der Kapitel
1. Ein Wort - zwei Hintergründe: Bacon und Liebknecht: Dieses Kapitel vergleicht die Auffassung von Wissen und Macht bei Francis Bacon und Wilhelm Liebknecht. Während Bacon den Zusammenhang zwischen Wissen und Macht im Kontext wissenschaftlicher Erkenntnis betont, sieht Liebknecht die Schule als Machtinstrument, das je nach gesellschaftlicher Ordnung entweder zur Befreiung oder zur Knechtung eingesetzt werden kann. Der Essay nutzt diese gegensätzlichen Perspektiven als Ausgangspunkt für die Analyse des DDR-Schulsystems.
2. Erziehungs- und politische Ziele der sozialistischen Schule und deren strukturelle Umsetzung: Dieses Kapitel beschreibt die offiziellen Erziehungs- und politischen Ziele des DDR-Schulsystems. Die Allgemeinbildung wurde im Sinne einer enzyklopädischen Wissensvermittlung verstanden, stark reglementiert und auf die Bedürfnisse der sozialistischen Produktion ausgerichtet. Politische Ziele betrafen die Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit, zur Unterordnung unter das Kollektiv und zur Akzeptanz des herrschenden Wertesystems. Der Zugang zu weiterführenden Bildungseinrichtungen war stark kontrolliert und nicht chancengleich.
3. Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele: Dieses Kapitel beschreibt die konkreten Maßnahmen zur Umsetzung der im vorherigen Kapitel dargestellten Ziele. Es werden die Verflechtung des Schulsystems mit der Gesellschaft, die Einbindung in Massenorganisationen und das Anreiz- und Sanktionssystem analysiert. Diese Maßnahmen dienten der Durchsetzung der sozialistischen Ideologie und der Unterordnung des Individuums unter das Kollektiv.
4. Bezug zur erlebten Wirklichkeit: Dieses Kapitel präsentiert die subjektiven Erfahrungen von Lehrern und Schülern im DDR-Schulsystem. Die Meinungen von Zeitzeugen sollen die Diskrepanz zwischen der offiziellen Ideologie und der erlebten Realität des Schulsystems beleuchten.
Schlüsselwörter
Wissen, Macht, Bildungssystem, DDR, Sozialismus, Ideologie, Realität, Erziehung, Kollektivismus, Allgemeinbildung, Politische Indoktrination, Chancengleichheit, Zeitzeugenberichte.
Häufig gestellte Fragen zum Essay: Das DDR-Bildungssystem als Machtinstrument
Was ist der Gegenstand des Essays?
Der Essay untersucht das Bildungssystem der DDR und analysiert seine Funktion als Instrument der Machtausübung. Er beleuchtet den Zusammenhang zwischen Wissen und Macht im Kontext der sozialistischen Ideologie und Praxis und untersucht die Diskrepanz zwischen den erklärten Zielen und der erlebten Realität.
Welche Themen werden im Essay behandelt?
Der Essay behandelt folgende Themen: den Zusammenhang zwischen Wissen und Macht im Denken von Bacon und Liebknecht; die Erziehungs- und politischen Ziele der sozialistischen Schule in der DDR; die Umsetzung dieser Ziele durch konkrete Maßnahmen des Schulsystems; die subjektive Wahrnehmung des Bildungssystems durch Lehrer und Schüler; und die Diskrepanz zwischen Ideologie und Realität im DDR-Schulsystem.
Welche Kapitel umfasst der Essay?
Der Essay gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Ein Wort - zwei Hintergründe: Bacon und Liebknecht; 2. Erziehungs- und politische Ziele der sozialistischen Schule und deren strukturelle Umsetzung; 3. Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele; 4. Bezug zur erlebten Wirklichkeit; und 5. Abschließende Betrachtung (die im vorliegenden Auszug nicht enthalten ist).
Wie werden die Ziele des DDR-Bildungssystems beschrieben?
Die offiziellen Erziehungs- und politischen Ziele des DDR-Schulsystems zielten auf Allgemeinbildung im Sinne enzyklopädischer Wissensvermittlung, stark reglementiert und auf die Bedürfnisse der sozialistischen Produktion ausgerichtet. Politisch betrafen sie die Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit, Unterordnung unter das Kollektiv und Akzeptanz des herrschenden Wertesystems. Der Zugang zu weiterführenden Bildungseinrichtungen war kontrolliert und nicht chancengleich.
Welche konkreten Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele werden genannt?
Der Essay analysiert die Verflechtung des Schulsystems mit der Gesellschaft, die Einbindung in Massenorganisationen und das Anreiz- und Sanktionssystem als konkrete Maßnahmen zur Durchsetzung der sozialistischen Ideologie und Unterordnung des Individuums unter das Kollektiv.
Wie wird die subjektive Wahrnehmung des Bildungssystems berücksichtigt?
Das vierte Kapitel präsentiert subjektive Erfahrungen von Lehrern und Schülern im DDR-Schulsystem, um die Diskrepanz zwischen der offiziellen Ideologie und der erlebten Realität zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Essay?
Schlüsselwörter sind: Wissen, Macht, Bildungssystem, DDR, Sozialismus, Ideologie, Realität, Erziehung, Kollektivismus, Allgemeinbildung, Politische Indoktrination, Chancengleichheit, Zeitzeugenberichte.
Wie werden Bacon und Liebknecht in den Essay eingebunden?
Das erste Kapitel vergleicht die Auffassungen von Wissen und Macht bei Francis Bacon und Wilhelm Liebknecht. Bacons Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen Wissen und Macht im Kontext wissenschaftlicher Erkenntnis, während Liebknecht die Schule als Machtinstrument sieht, das zur Befreiung oder Knechtung eingesetzt werden kann. Diese gegensätzlichen Perspektiven bilden den Ausgangspunkt für die Analyse des DDR-Schulsystems.
- Quote paper
- Mirco Böhm (Author), 2010, Wissen ist Macht , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153379