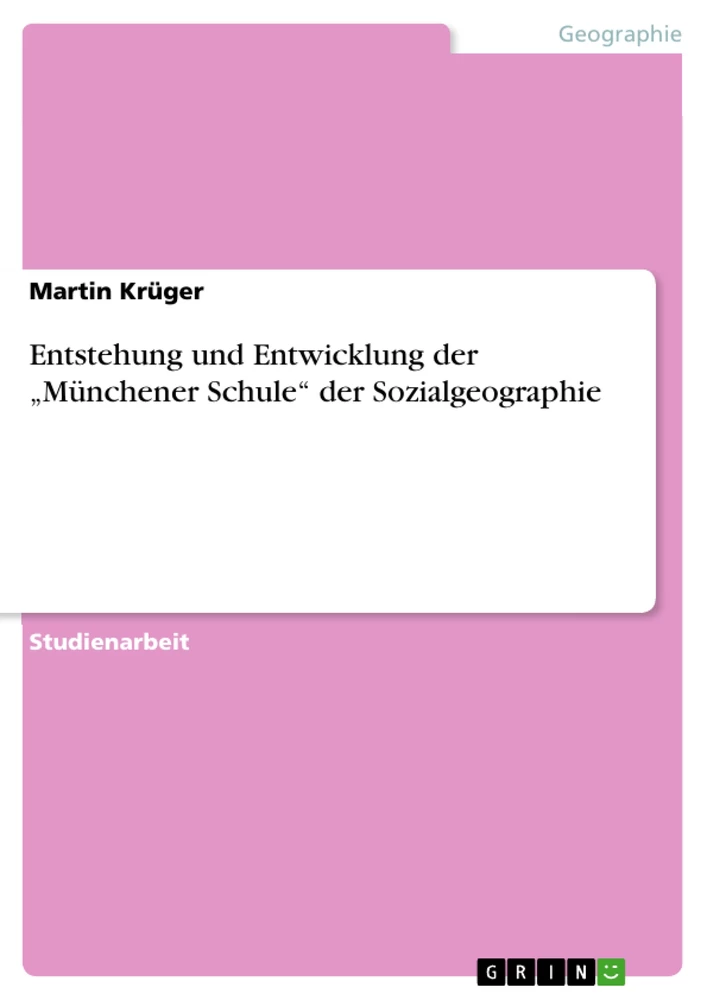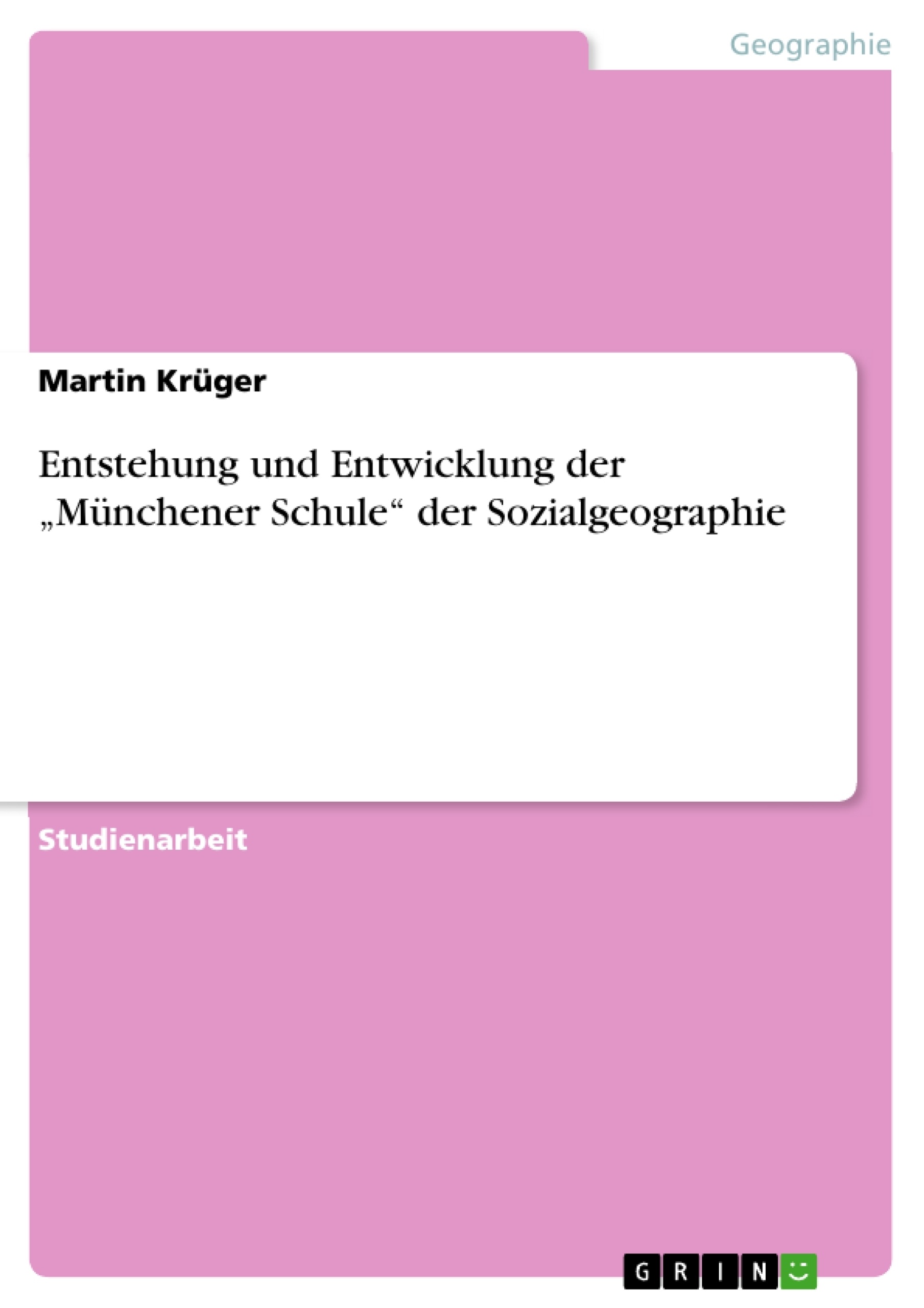Als „Münchener Schule“ der Sozialgeographie wird eine Schule innerhalb der Sozialgeographie bezeichnet, die ihren Ursprung am heutigen Seminar für Sozialwissenschaftliche Geographie der Universität München hat. Sie hat die Geographie als sozialwissenschaftliche Disziplin mitgeprägt und somit die Etablierung der Sozialgeographie innerhalb der Humangeographie maßgeblich beeinflusst. Es war vor allem Wolfgang Hartke, der von 1952 bis 1975 als ordentlicher Professor am Geographischen Institut der Technischen Universität München arbeitete und der „Anfang der [19]60er Jahre am nahezu tabuisierten Selbstverständnis seiner Disziplin gerüttelt und der deutschen Geographie Perspektiven aufgezeigt, die sie aus dem Elfenbeinturm einer antiquierten Landschaftsforschung und universitärer Länderkunde auf das weite Feld gesellschaftsrelevanter Forschungen geführt hat“. Seine Schüler Maier, Paesler, Ruppert und Schaffner entwickelten seine und Hans Bobek’s sozialgeo-graphische Konzeptionen weiter zum „Münchener“ sozialgeographischen Ansatz, mit dem Hauptaugenmerk auf die Daseinsgrundfunktionen sozialer Gruppen gerichtet.
Die hier angefertigte Arbeit beschäftigt sich mit der Entstehung und Entwicklung des Funktionalismus und der Herausbildung der „Münchener Schule“ mit ihrem sozialgeographischen Ansatz und deren Forschungsgegenstand. Abschließend werden hier die Unzulänglichkeiten der „Münchener“ Sozialgeographie erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Funktionalismus
- Herausbildung der „Münchener Schule“
- Daseinsgrundfunktion (DGF)
- Gegenstand der „Münchener Schule“
- Kritik am „Münchener“ sozialgeographischen Ansatz
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung der „Münchener Schule“ der Sozialgeographie, ihren sozialgeographischen Ansatz und ihren Forschungsgegenstand. Der Fokus liegt auf dem Einfluss des Funktionalismus und der Kritik an diesem Ansatz. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der „Münchener Schule“ für die Entwicklung der Sozialgeographie.
- Entstehung und Entwicklung der „Münchener Schule“
- Einfluss des Funktionalismus auf die „Münchener Schule“
- Der sozialgeographische Ansatz der „Münchener Schule“
- Forschungsgegenstand der „Münchener Schule“
- Kritik am „Münchener“ Ansatz
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die „Münchener Schule“ als eine einflussreiche Richtung innerhalb der Sozialgeographie, die am Seminar für Sozialwissenschaftliche Geographie der Universität München ihren Ursprung hat und die Entwicklung der Disziplin maßgeblich geprägt hat. Der Beitrag von Wolfgang Hartke und die Weiterentwicklung seiner Konzeptionen durch seine Schüler werden hervorgehoben. Die Arbeit kündigt die Auseinandersetzung mit der Entstehung und Entwicklung des Funktionalismus und des „Münchener“ sozialgeographischen Ansatzes sowie dessen Kritik an.
Funktionalismus: Dieses Kapitel behandelt die „Charta von Athen“ (1942) als Manifest des modernen Städtebaus und ihren Einfluss auf die Entwicklung der funktionalen Stadtplanung. Die „funktionelle Stadt“ wird als organischer Aufbau beschrieben, wobei das Verkehrsnetz als verbindendes Element fungiert. Der Kapitel erläutert den Ursprung des Funktionalismus in der Biologie und Physiologie und seine Übertragung auf die Sozial- und Kulturwissenschaften, und stellt ihn als Gegenpol zum Geodeterminismus dar.
Herausbildung der „Münchener Schule“: (Detaillierte Zusammenfassung fehlt im Ausgangstext. Eine Zusammenfassung müsste hier basierend auf dem Rest des Textes erstellt werden.)
Daseinsgrundfunktion (DGF): (Detaillierte Zusammenfassung fehlt im Ausgangstext. Eine Zusammenfassung müsste hier basierend auf dem Rest des Textes erstellt werden.)
Gegenstand der „Münchener Schule“: (Detaillierte Zusammenfassung fehlt im Ausgangstext. Eine Zusammenfassung müsste hier basierend auf dem Rest des Textes erstellt werden.)
Kritik am „Münchener“ sozialgeographischen Ansatz: (Detaillierte Zusammenfassung fehlt im Ausgangstext. Eine Zusammenfassung müsste hier basierend auf dem Rest des Textes erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Münchener Schule, Sozialgeographie, Funktionalismus, Daseinsgrundfunktionen, Stadtplanung, Wolfgang Hartke, methodischer Ansatz, kritische Analyse, Entwicklungslinien der Sozialgeographie.
Häufig gestellte Fragen zum Text über die "Münchener Schule" der Sozialgeographie
Was ist der Hauptgegenstand dieses Textes?
Der Text befasst sich umfassend mit der "Münchener Schule" der Sozialgeographie. Er untersucht ihre Entstehung und Entwicklung, ihren sozialgeographischen Ansatz und ihren Forschungsgegenstand, mit besonderem Fokus auf den Einfluss des Funktionalismus und die Kritik an diesem Ansatz. Der Text beleuchtet die Bedeutung der "Münchener Schule" für die Entwicklung der Sozialgeographie insgesamt.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen: die Entstehung und Entwicklung der "Münchener Schule", den Einfluss des Funktionalismus auf diese Schule, den spezifischen sozialgeographischen Ansatz der "Münchener Schule", den Forschungsgegenstand dieser Schule und die Kritik an ihrem Ansatz. Die "Charta von Athen" (1942) und die Daseinsgrundfunktionen (DGF) werden ebenfalls thematisiert.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Funktionalismus, Herausbildung der "Münchener Schule", Daseinsgrundfunktion (DGF), Gegenstand der "Münchener Schule", Kritik am "Münchener" sozialgeographischen Ansatz und Schlussfolgerung. Die Kapitel "Herausbildung der „Münchener Schule“", "Daseinsgrundfunktion (DGF)", "Gegenstand der „Münchener Schule“" und "Kritik am „Münchener“ sozialgeographischen Ansatz" enthalten im vorliegenden Auszug jedoch nur kurze Beschreibungen und benötigen eine detailliertere Ausarbeitung.
Welche Rolle spielt der Funktionalismus im Text?
Der Funktionalismus spielt eine zentrale Rolle, da der Text seinen Einfluss auf die Entstehung und Entwicklung der "Münchener Schule" untersucht. Die "Charta von Athen" wird als Beispiel für funktionalistische Stadtplanung genannt, und der Text erläutert den Ursprung des Funktionalismus in der Biologie und Physiologie sowie seine Übertragung auf die Sozial- und Kulturwissenschaften. Der Funktionalismus wird als Gegenpol zum Geodeterminismus dargestellt.
Wer wird im Text als wichtiger Akteur genannt?
Wolfgang Hartke wird als wichtiger Akteur genannt, dessen Beiträge und Konzeptionen die "Münchener Schule" maßgeblich geprägt haben. Der Text hebt die Weiterentwicklung seiner Ideen durch seine Schüler hervor.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Textes?
Schlüsselwörter sind: Münchener Schule, Sozialgeographie, Funktionalismus, Daseinsgrundfunktionen, Stadtplanung, Wolfgang Hartke, methodischer Ansatz, kritische Analyse, Entwicklungslinien der Sozialgeographie.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Die Zielsetzung des Textes ist die Untersuchung der Entstehung und Entwicklung der "Münchener Schule" der Sozialgeographie, ihres sozialgeographischen Ansatzes und ihres Forschungsgegenstandes. Der Fokus liegt auf dem Einfluss des Funktionalismus und der Kritik an diesem Ansatz. Der Text beleuchtet die Bedeutung der "Münchener Schule" für die Entwicklung der Sozialgeographie.
Wo findet man detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Detailliertere Informationen zu den Kapiteln "Herausbildung der „Münchener Schule“", "Daseinsgrundfunktion (DGF)", "Gegenstand der „Münchener Schule“" und "Kritik am „Münchener“ sozialgeographischen Ansatz" fehlen im vorliegenden Text-Auszug. Diese müssten basierend auf dem vollständigen Text erstellt werden.
- Quote paper
- Martin Krüger (Author), 2009, Entstehung und Entwicklung der „Münchener Schule“ der Sozialgeographie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153290