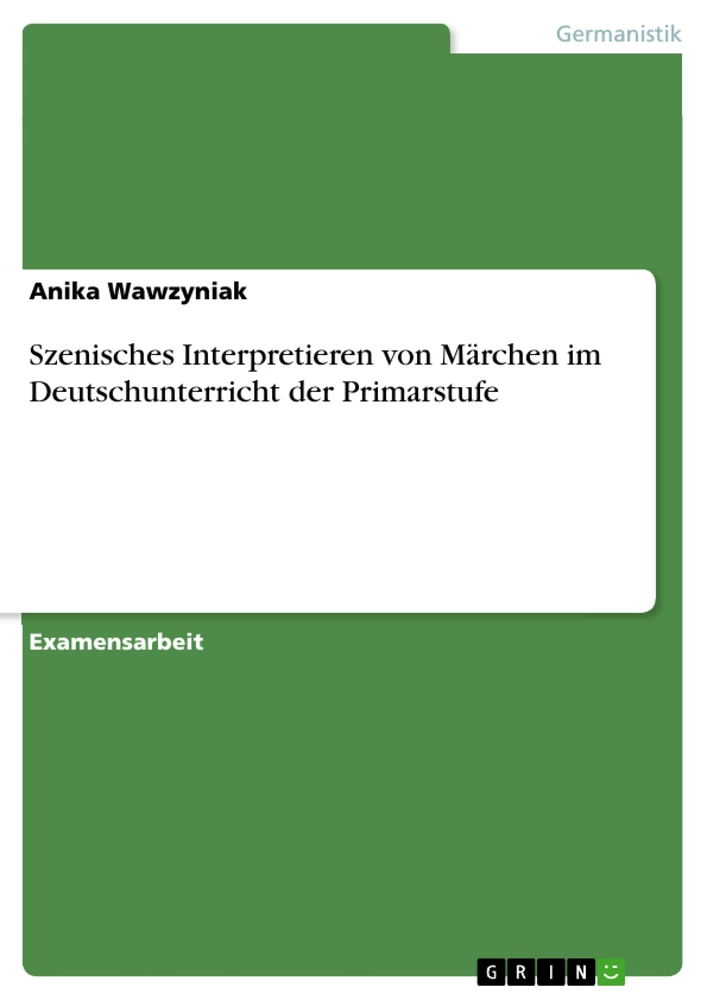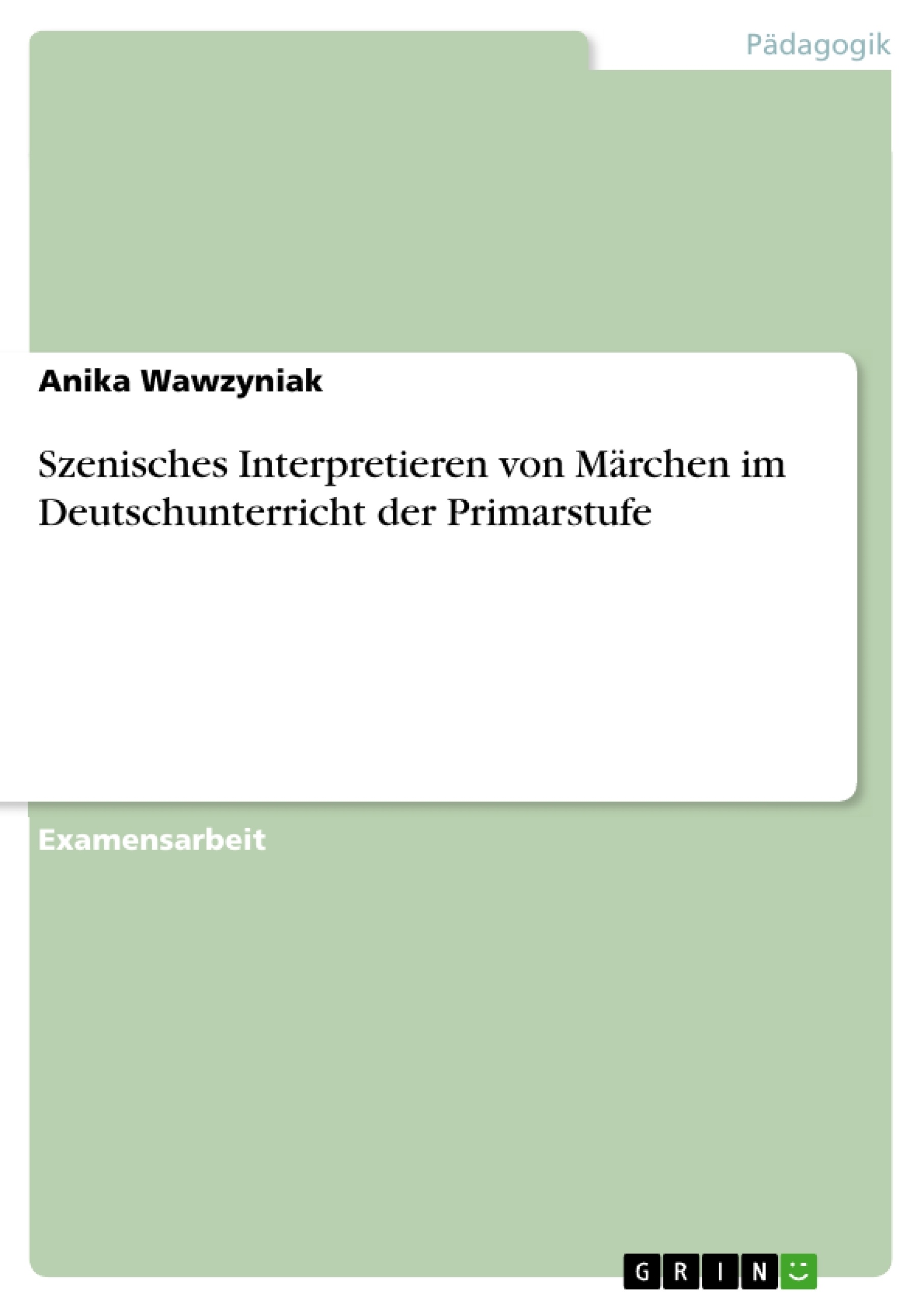Kinder treten auf direkte Art und Weise mit ihrem Umfeld in Kontakt, indem sie alles erkunden, erleben und erfahren wollen. Dabei stellen sie sich gerne neuen Herausforderungen und lassen sich auf ungewohnte Situationen ein – auch im Bereich von Sprache und Literatur. So lieben Kinder es bspw., Verse nachzusprechen, zu verändern oder eigene Reime zu erfinden.1 Außerdem lassen sie sich vor allem von jener Literatur begeistern, die einen Handlungs- und Figurenrahmen bietet, der Kinder zur Identifikation anregt. Nicht selten passiert es in diesem Zusammenhang bspw., dass Kinder nach der Rezeption eines Märchens oder einer Erzählung in die Rollen der jeweiligen Figuren schlüpfen, um deren Erlebnisse nachzuspielen. Dies beweist, wie intensiv sie sich mit der Handlung und den Figuren der entsprechenden literarischen Werke beschäftigen. Ein Phänomen, das auch in der Schule genutzt werden kann, um bereits Grundschüler2 für Literatur zu begeistern und somit die Grundlage für eine langfristige Lesemotivation zu schaffen. Die vorliegende Arbeit liefert in diesem Zusammenhang ein schulpraktisches Beispiel, indem sie zunächst darlegt, welche besondere Bedeutung den Märchen der Brüder Grimm vor allem als Einstiegsliteratur im Grundschulunterricht zukommen kann. Anschließend werden Betrachtungen und Überlegungen zum Verfahren des Szenischen Interpretierens als Unterrichtsmethode für den Umgang mit Märchen angestellt. Die Begründung dafür liegt in der Annahme, dass die Märchen der Brüder Grimm vor allem bei jungen Schülern zu hoher Identifikation mit den Märchenfiguren führen können, und das Verfahren des Szenischen Interpretierens zusätzlich dazu beitragen kann, dass die Schüler die Märchen tatsächlich von Innen heraus erleben und erfahren können, was ihrer Form der Kontaktaufnahme mit ihrem Umfeld entspricht.3 Zudem müssen sowohl die Märchen der Brüder Grimm als auch das szenische Spielen als Sozialisationsgut betrachtet werden – die Märchen der Brüder Grimm kennt fast Jeder, sind sie doch die bekanntesten jener literarischen Gattung weltweit. Und das Spielen und Darstellen von Rollen ist eine der ursprünglichsten menschlichen Verhaltensweisen überhaupt, um andere Menschen nachzuahmen oder sich selbst besser zu begreifen.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Die Gattung der Märchen - Entwicklung und Formen
- 1.1.Die Entwicklung des heute geläufigen Märchenbegriffes
- 1.2.Die verschiedenen Märchentypen – ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- 2. Definition der Märchen
- 2.1 Der Strukturaufbau der Märchen
- 2.2. Die Märchenfiguren
- 2. 3. Der Darstellungsstil der Märchen
- 3. Die literarische Gattung der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm
- 3.1. Entstehung und Entwicklung
- 3.2. Der kindliche Rezipient der Kinder-und Hausmärchen
- 3.3. Die Kinder -und Hausmärchen als epische Kinder- und Jugendliteratur
- 3.4. Die Kinder- und Hausmärchen als phantastische Kinder- und Jugendliteratur
- 3.5. Die Kinder- und Hausmärchen als Sozialisationsliteratur
- 34. Didaktik der Märchen
- 4.1. Entstehung und Entwicklung
- 4.2. Märchen als Modellfälle
- 4.3. Umgang mit Märchen im Unterricht
- 4.4. Für welche Klassenstufen eignen sich Märchen?
- 5. Märchen in der Primarstufe
- 5.1. Märchen als literarischer Einstieg
- 5.2. Kompetenzerwerb durch Märchen
- 5.3. Kompetenzerwerb durch Märchen im Blickfeld der Bildungsstandards für den Deutschunterricht der Primarstufe und dem 'Umgang mit Literatur' nach dem hessischen Rahmenplan
- 6. Szenisches Interpretieren
- 6.1. Spiel – und theaterpädagogische Ansätze
- 6.2. Szenisches Interpretieren nach Scheller
- 6.3. Literarisches Rollenspiel nach Schuster
- 6.4. Szenisches Interpretieren als Methode im Deutschunterricht der Grundschule
- 6.5. Organisation und Grenzen des Szenisches Interpretieren im Unterricht
- 6.6. Kompetenzerwerb durch szenisches Interpretieren
- 6.7. Kompetenzerwerb durch Szenisches Interpretieren im Blickfeld der Bildungsstandards für den Deutschunterricht der Primarstufe und den Lernzielen des hessischen Rahmenplans für das Unterrichtsfach Deutsch
- 47. Unterrichtsentwurf zum szenischen Interpretieren von Märchen
- 7.1. Das szenische Interpretieren von Märchen
- 7.2. Rotkäppchen nach den Brüdern Grimm
- 7.2.1 Entstehung und Verbreitung
- 7. 2.2. Überlegungen zur Interpretation
- 7.3. Wichtige Inhalte für die Abhandlung im Deutschunterricht der Primarstufe
- 7.3.1. Rotkäppchens Weg
- 7.3.2. Rotkäppchen und der Wolf
- 7.3.3.Die Modellhaftigkeit von Rotkäppchen
- 7.3.4. Rotkäppchen als literarischer Einstieg
- 7.3.5. Rotkäppchens Sprache
- 7.3.6. Rotkäppchen als dramatische Literatur
- 7.4. Methodische Überlegungen zur Unterrichtseinheit
- 7.4.1. Die szenische Umsetzung
- 7.4.2. Gemeinsame Erarbeitung der Märcheninhalte und Märchenfiguren
- 7.5. Ablauf des Unterrichtsentwurfes
- 7.5.1. Tabellarischer Ablauf
- 7.5.2. Detaillierter und begründeter Ablauf
- 7.5.2.1. Erster Tag
- 7.5.2.2. Zweiter Tag
- 7.5.2.3. Dritter Tag
- 7.5.2.4. Vierter Tag
- 7.5.2.5. Fünfter Tag
- 7.5.2.6. Sechster Tag
- 7.5.2.7. Siebter Tag
- 7.6. Die Bewertung der Unterrichtseinheit
- 7.7. Nachbereitung
- 7.8. Reflexion
- 7.9. Materialien zur Unterrichtseinheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Examensarbeit befasst sich mit dem szenischen Interpretieren von Märchen im Deutschunterricht der Primarstufe. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Herausforderungen dieser Methode aufzuzeigen und einen konkreten Unterrichtsentwurf zu erstellen.
- Entwicklung und Formen der Märchen
- Didaktische Ansätze im Umgang mit Märchen
- Szenisches Interpretieren als Methode im Deutschunterricht der Primarstufe
- Kompetenzerwerb durch szenisches Interpretieren von Märchen
- Erstellung eines konkreten Unterrichtsentwurfs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Zielsetzung der Arbeit dar. Kapitel 1 beleuchtet die Entwicklung und Formen der Märchen, während Kapitel 2 die Definition der Märchen und deren spezifische Merkmale untersucht. Kapitel 3 widmet sich der literarischen Gattung der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, inklusive ihrer Entstehung, Entwicklung und Relevanz für den kindlichen Rezipienten. Kapitel 4 behandelt die Didaktik der Märchen, ihre Verwendung als Modellfälle und den Umgang mit ihnen im Unterricht. Kapitel 5 fokussiert auf die Bedeutung von Märchen in der Primarstufe und die durch sie möglichen Kompetenzerwerbe. In Kapitel 6 werden verschiedene Ansätze zum szenischen Interpretieren vorgestellt und dessen Bedeutung im Deutschunterricht der Grundschule erörtert. Schließlich widmet sich Kapitel 7 der Erstellung eines konkreten Unterrichtsentwurfs zum szenischen Interpretieren von Märchen, am Beispiel von "Rotkäppchen" der Brüder Grimm.
Schlüsselwörter
Märchen, szenisches Interpretieren, Deutschunterricht, Primarstufe, Kinder- und Hausmärchen, Brüder Grimm, Didaktik, Kompetenzerwerb, Unterrichtsentwurf, Rotkäppchen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des szenischen Interpretierens von Märchen?
Das Ziel ist es, Schülern der Primarstufe einen Zugang zur Literatur zu ermöglichen, indem sie Märchen von innen heraus erleben. Durch das Schlüpfen in Rollen identifizieren sie sich mit den Figuren und entwickeln eine langfristige Lesemotivation.
Warum eignen sich Märchen der Brüder Grimm besonders für die Grundschule?
Die Märchen der Brüder Grimm sind ein weltweit bekanntes Sozialisationsgut. Sie bieten klare Handlungs- und Figurenrahmen, die Kinder zur Identifikation anregen und einen idealen literarischen Einstieg im Deutschunterricht bieten.
Welche Kompetenzen erwerben Schüler durch das szenische Interpretieren?
Schüler erwerben Kompetenzen in den Bereichen Empathie, Textverständnis und Ausdrucksfähigkeit. Es fördert zudem die sozialen Fähigkeiten durch das gemeinsame Spiel und die Auseinandersetzung mit literarischen Konflikten.
Was versteht man unter dem literarischen Rollenspiel nach Schuster?
Es handelt sich um einen methodischen Ansatz, bei dem literarische Texte durch Rollenspiele erschlossen werden. Dabei steht die handelnde Auseinandersetzung mit dem Text im Vordergrund, um tiefere Bedeutungsschichten zu erfassen.
Welches Märchen wird im beigefügten Unterrichtsentwurf behandelt?
Der detaillierte Unterrichtsentwurf befasst sich mit dem Märchen "Rotkäppchen" der Brüder Grimm und zeigt die methodische Umsetzung über einen Zeitraum von sieben Tagen.
- Citar trabajo
- Anika Wawzyniak (Autor), 2009, Szenisches Interpretieren von Märchen im Deutschunterricht der Primarstufe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153188