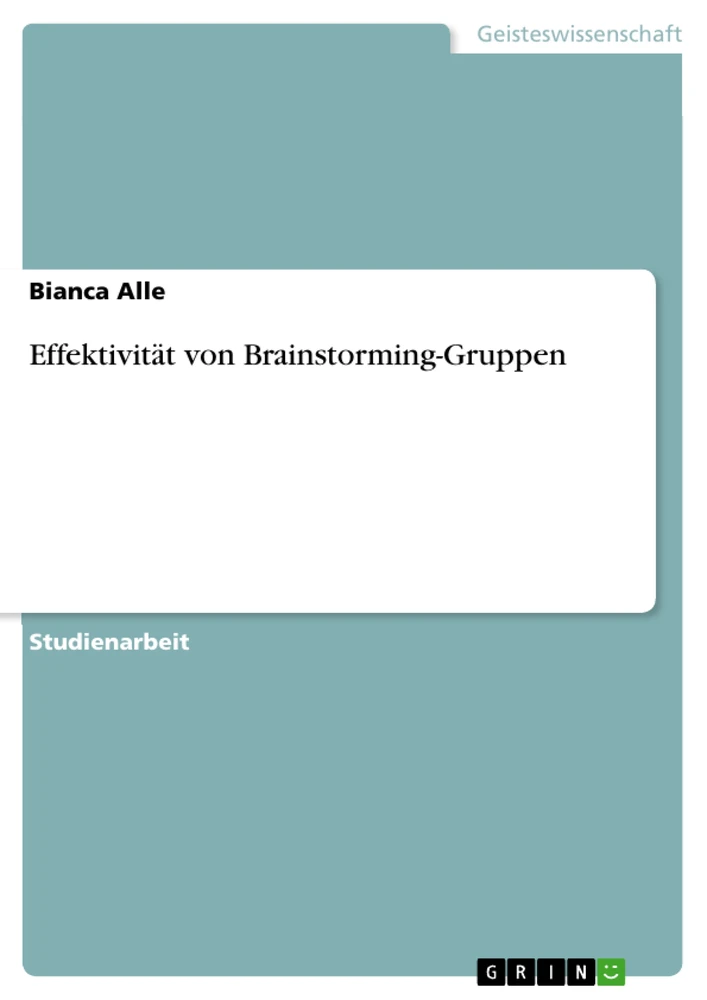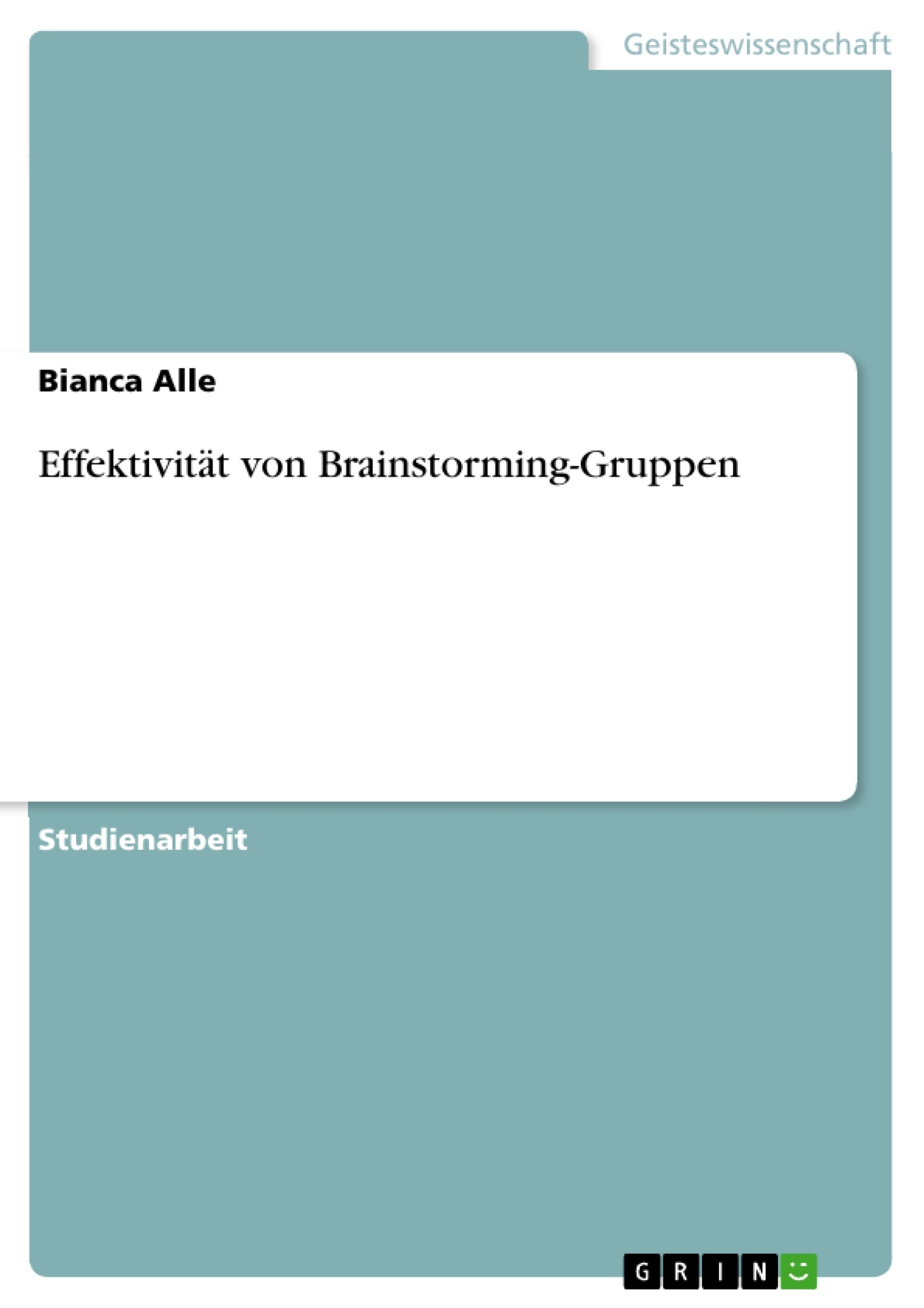Menschen haben verschiedene Meinungen zum Thema Gruppenarbeit und kollektiver Ideengenerierung. Eine alte Volksweisheit besagt „Zwei Köpfe sind besser als einer“. Dahinter steht die Meinung, dass sich Menschen in interagierenden Gruppen gegenseitig geistig, also kognitiv, stimulieren und somit kreativere Ideen als Einzelpersonen hervorbringen.
Andere Positionen beziehen sich darauf, dass soziale Einflüsse die Zusammenarbeit und somit auch die effektive Hervorbringung von Ideen in Gruppen behindern. Der US Amerikanische Pädagoge und Historiker Whitney Griswold (1906-1963) drückte es
seinerzeit folgendermaßen aus: „Could Hamlet have been written by committee, or the Mona Lisa painted by a club? Could the New Testament have been composed as a conference report? Creative ideas don’t spring from groups. They spring from individuals.” (zit. nach Nijstad, 2000, S. 1)
Oder wiederum mit anderen, „volksweisheitlichen“ Worten: „Viele Köche verderbenden Brei.“
Trotzdem bleibt die Arbeit in Gruppen ein wesentlicher Aspekt im Umfeld eines Individuums und tritt in alltäglichen Situationen und Schauplätzen, wie in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Politik immer wieder auf. Eine häufig verbreitete und sehr populäre Art der gemeinsamen Ideenfindung ist das sogenannte Brainstorming, welches von Alex F. Osborn (1953, 1957), dem Leiter einer Werbeagentur, entwickelt wurde. Der Begriff „Brainstorming“ entsprang dabei dem Gedanken „using the brain to storm a problem“ (Osborn, 1957, S. 80). Zu Deutsch: „Das Gehirn zum Sturm auf ein Problem verwenden.“.
Letztendlich steht die Frage im Raum: „Ist das gemeinschaftliche Sammeln von Ideen tatsächlich förderlich für die Quantität und die Qualität der Einfälle und welche Probleme können während dem Brainstorming auftreten?“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Brainstorming-Methode von Alex F. Osborn
- Empirische Untersuchungen zur Effektivität von Brainstorming
- Nominale versus interaktive Brainstorming-Gruppen
- Produktivitätsverluste bei interaktiven Brainstorming-Gruppen
- Ursachen
- Die vier Experimente von Diehl und Stroebe (1986)
- Fazit und Ausblick für die Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Effektivität von Brainstorming-Gruppen und analysiert, ob die kollektive Ideengenerierung tatsächlich zu einer Steigerung der Kreativität führt. Sie beleuchtet die Ursprünge und Prinzipien der Brainstorming-Methode von Alex F. Osborn und analysiert die Ergebnisse empirischer Studien, die sich mit der Effektivität interaktiver Brainstorming-Gruppen auseinandersetzen.
- Die Entwicklung der Brainstorming-Methode von Alex F. Osborn
- Die Prinzipien des „Bewertungsaufschubs“ und „Quantität erzeugt Qualität“
- Die vier Regeln für interaktive Brainstorming-Gruppen
- Empirische Untersuchungen zu den Effekten von Brainstorming
- Produktivitätsverluste in interaktiven Brainstorming-Gruppen und deren Ursachen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf Gruppenarbeit und kollektive Ideengenerierung und führt in das Thema Brainstorming ein. Kapitel 2 stellt die Methode des Brainstormings, wie sie von Alex F. Osborn entwickelt wurde, vor und erläutert die grundlegenden Prinzipien und Regeln. Kapitel 3 untersucht empirische Studien zur Effektivität von Brainstorming-Gruppen und analysiert die Ergebnisse von nominalen versus interaktiven Gruppen. Insbesondere werden die Ursachen für Produktivitätsverluste bei interaktiven Brainstorming-Gruppen sowie die Erkenntnisse der vier Experimente von Diehl und Stroebe (1986) beleuchtet.
Schlüsselwörter
Brainstorming, Kreativität, Gruppenarbeit, Ideengenerierung, Produktivität, Bewertungsaufschub, Quantität erzeugt Qualität, Empirische Forschung, interaktive Brainstorming-Gruppen, nominale Brainstorming-Gruppen, Produktivitätsverluste.
- Citar trabajo
- Bianca Alle (Autor), 2009, Effektivität von Brainstorming-Gruppen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153171