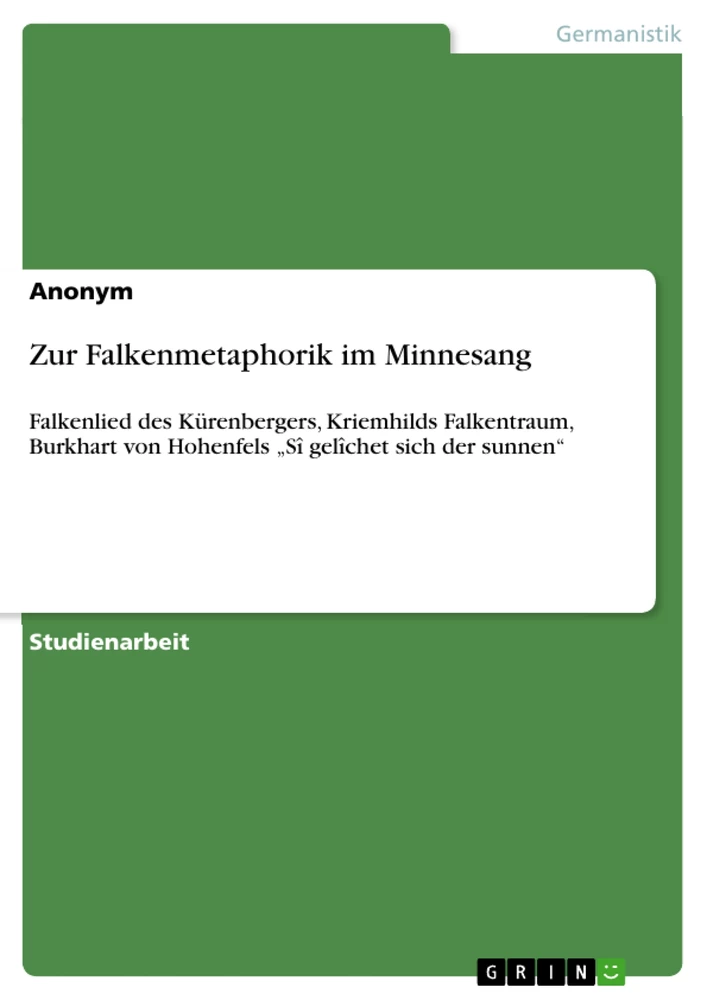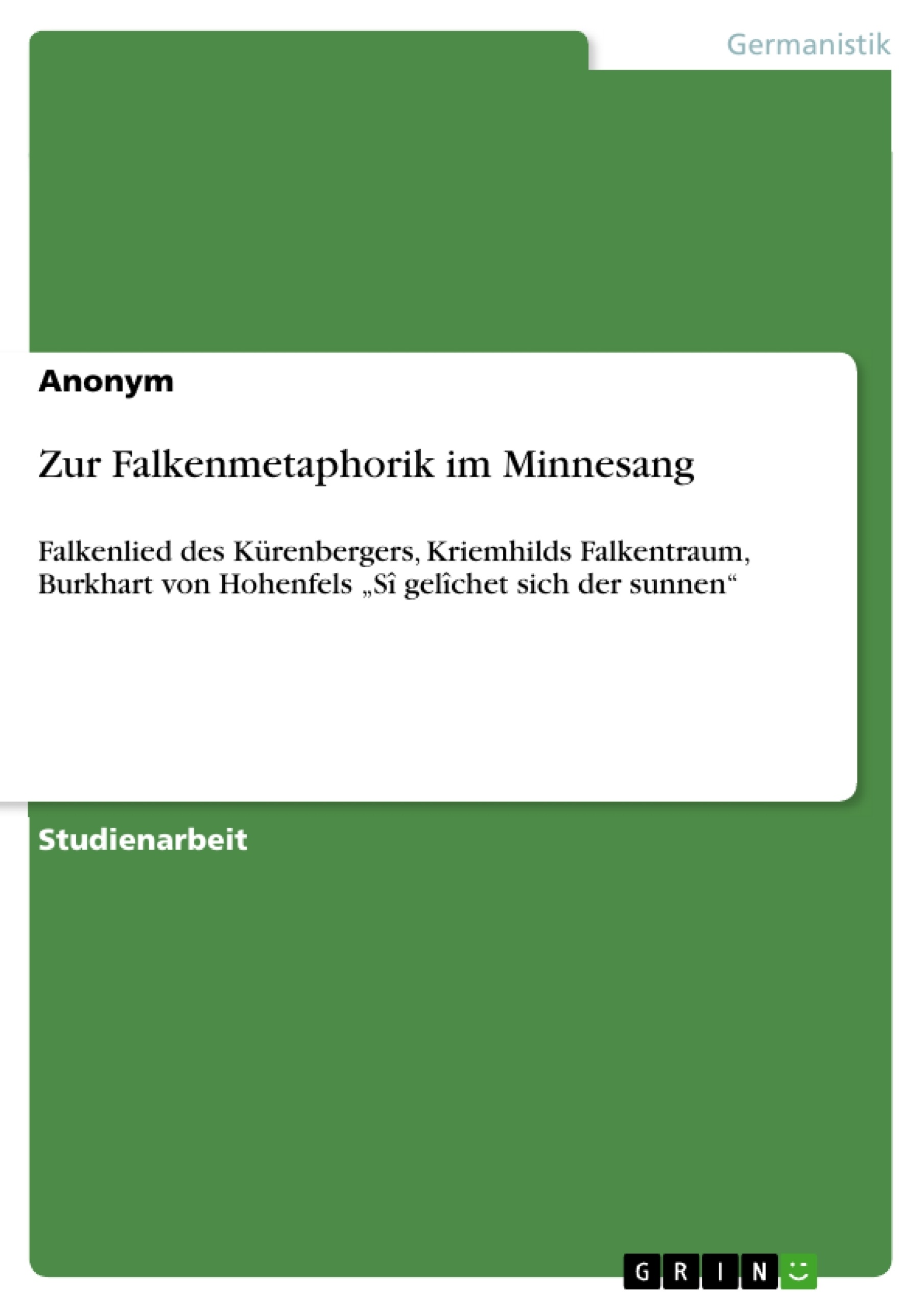Es war „Liebe auf den ersten Blick“. In der ersten Stunde des Minnesangseminars, die ersten Worte
des Professors, noch bevor er uns begrüßte: Kürenbergs Falkenlied!
Falken faszinierten mich schon immer. Ihre scharfen Augen, ihre edle Anmut und Eleganz,
Raub- und Jagdvögel, alles Attribute die eine ungeheure Faszination ausüben, wie sie nur einem
starken, schönen, männlichen Tier zugesprochen werden kann. Ich wurde in meiner Naivität vom
Bild des Falkens eines Besseren belehrt.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich zunächst mit zwei Interpretationen des Falkenliedes aus
der Forschung, welche zeigen sollen, dass die Metaphorik des Falken im Minnesang nicht auf ein
Bild beschränkt ist, sondern völlig entgegengesetzt interpretiert werden kann. Eine kurzer Exkurs
zu Burkhart von Hohenfels „Sî gelîchet sich der sunnen,“ zeigt dann im weiteren Verlauf, dass
eben dieses Bild des Falken einer hohen Variabilität unterliegt.
Zum Schluss entsteht eine eigenständige Interpretationshypothese des Falkenliedes, welche die
Gedanken Rudolf K. Jansens fortführt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Das Falkenlied des Kürenbergers
- Der Falke als Ritter, Kriemhilds Traum
- Der Falke als Mädchen (brûtliet)
- Burkhart von Hohenfels, „Sî gelîchet sich der sunnen,“
- Eigene Interpretationshypothese des Falkenliedes
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Falkenmetaphorik im Minnesang, insbesondere im Falkenlied des Kürenbergers, Kriemhilds Falkentraum und Burkhart von Hohenfels „Sî gelîchet sich der sunnen“. Das Ziel ist es, die vielschichtigen Interpretationen der Falkenmetaphorik aufzuzeigen und eine eigene Interpretationshypothese des Falkenliedes zu entwickeln.
- Interpretation des Falkenliedes des Kürenbergers
- Die Rolle des Falken als Ritter und Mädchen
- Die Variabilität der Falkenmetaphorik im Minnesang
- Die Entstehung einer eigenen Interpretationshypothese
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und beleuchtet die Faszination des Falken in der mittelalterlichen Literatur. Es wird auf die Bedeutung des Falkenliedes des Kürenbergers als Ausgangspunkt der Analyse hingewiesen.
Hauptteil
Das Falkenlied des Kürenbergers
In diesem Kapitel wird das Falkenlied des Kürenbergers in seiner historischen und literarischen Bedeutung beleuchtet. Es werden die Besonderheiten des Liedes in Bezug auf Form und Sprache betrachtet und die Herausforderungen bei der Interpretation des Textes angesprochen.
Der Falke als Ritter, Kriemhilds Traum
Dieses Kapitel widmet sich der Interpretation des Falken als Ritterfigur. Es werden verschiedene Aspekte der Falkensymbolik im Kontext der Ritterkultur und der Minneliteratur untersucht.
Der Falke als Mädchen (brûtliet)
Hier wird der Falke als Mädchenfigur in der Minnelyrik interpretiert. Die Bedeutung des Falkens im Zusammenhang mit der „brûtliet“-Tradition und der weiblichen Schönheit wird beleuchtet.
Burkhart von Hohenfels, „Sî gelîchet sich der sunnen,“
In diesem Abschnitt wird das Gedicht von Burkhart von Hohenfels „Sî gelîchet sich der sunnen“ untersucht. Es wird die Bedeutung der Falkenmetaphorik in diesem Gedicht im Vergleich zu den anderen Texten analysiert.
Eigene Interpretationshypothese des Falkenliedes
Dieses Kapitel stellt eine eigene Interpretationshypothese des Falkenliedes des Kürenbergers vor, die auf den Gedanken Rudolf K. Jansens aufbaut. Es werden die wichtigsten Punkte der eigenen Interpretation zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Minnesang, Falkenmetaphorik, Kürenberger, Falkenlied, Ritter, Mädchen, brûtliet, Burkhart von Hohenfels, Interpretationshypothese, Symbolismus, Mittelhochdeutsch.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2008, Zur Falkenmetaphorik im Minnesang, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/153014