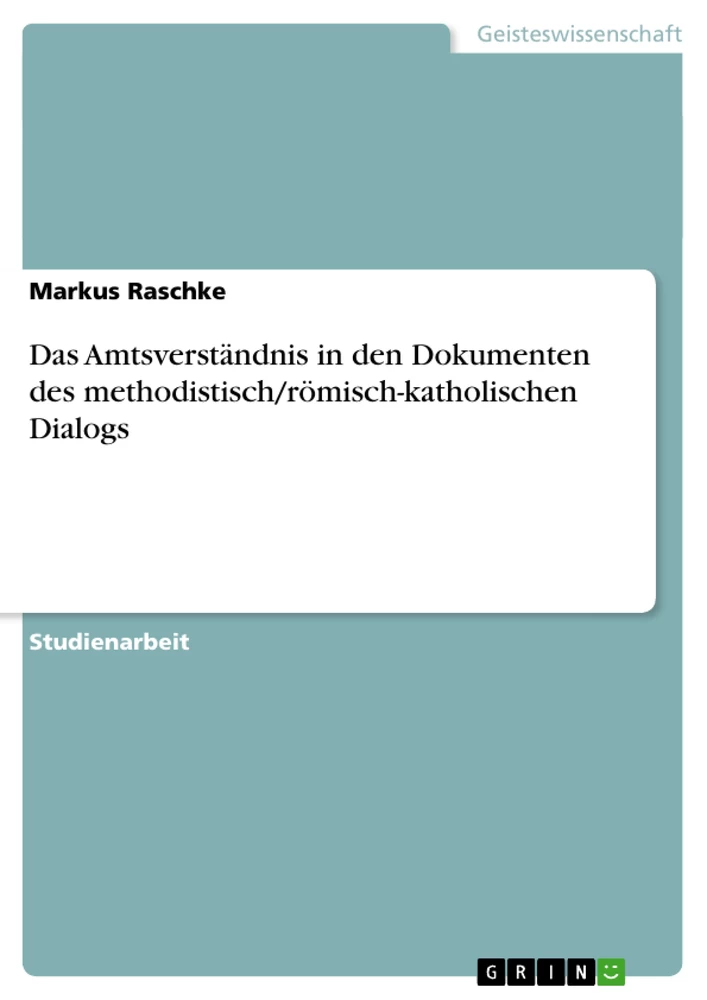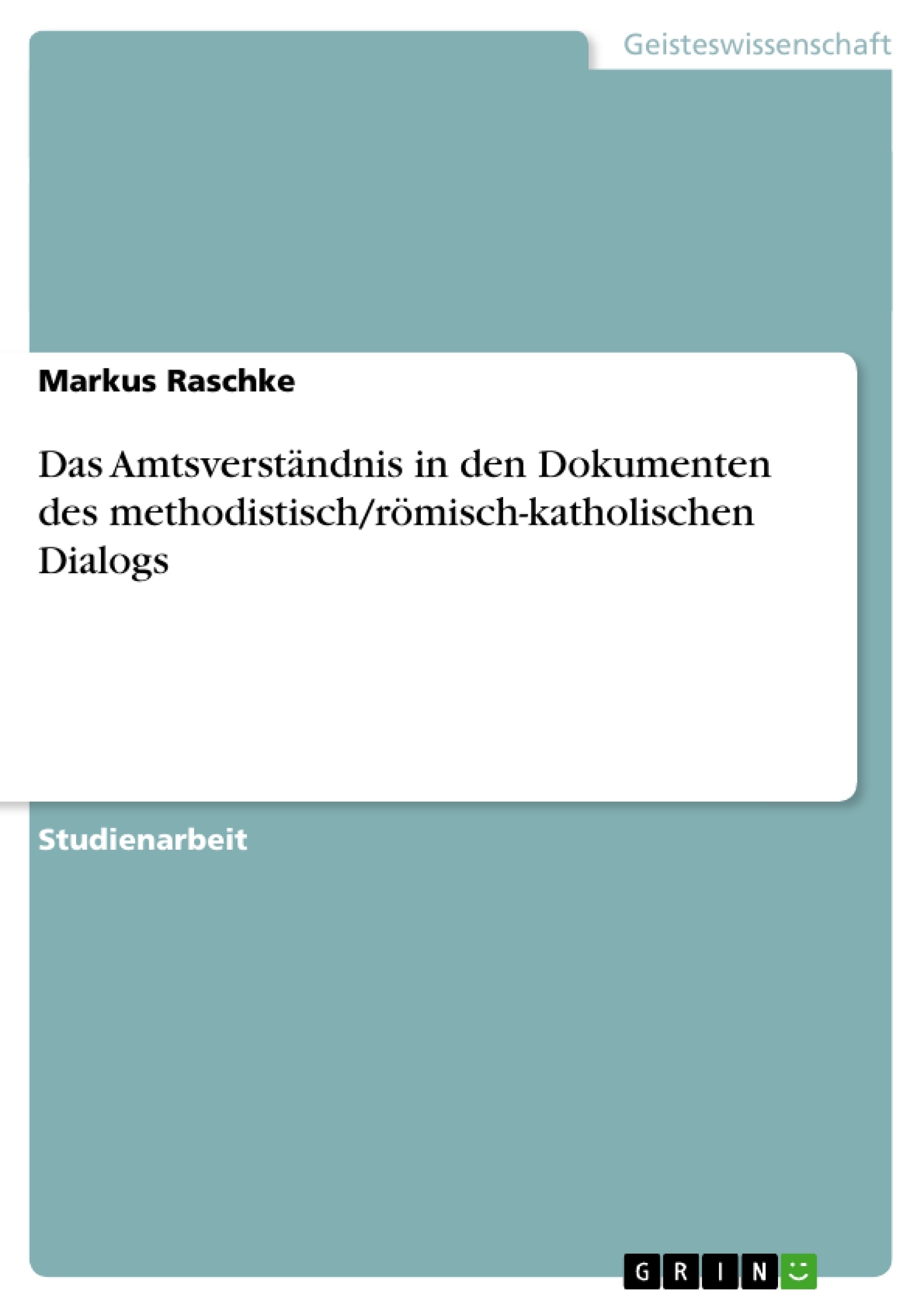Um den ökumenischen Dialog mit den methodistischen Kirchen besser verstehen zu können,
scheint es hilfreich, einen kurzen und gezielten Blick in die Entstehungsgeschichte und das
Selbstverständnis des Methodismus zu werfen:
Der Methodismus entstand als Frömmigkeitsbewegung um die Geistlichen John und Charles
Wesley2 innerhalb der anglikanischen Kirche. Eine Verselbständigung als Kirche geschah
im Zusammenhang mit der Auswanderung von Anhängern nach Amerika, für die eine
eigene Organisation notwendig wurde und daher ein ‘Superintendent’ bestellt wurde. In
England dagegen blieb der Methodismus noch recht lange eine inneranglikanische
Erneuerungsbewegung, die erst 1891 zur eigenständigen „Wesleyanischen Methodistenkirche“
wird. Darüber hinaus entstehen noch weitere methodistisch geprägte
Gemeinschaften bzw. Kirchen, so daß sich der Methodismus weltweit zügig ausbreitete.
Bereits im 19. Jahrhundert beginnen Bemühungen, die eng verwandten Kirchen miteinander
zu vereinigen, was ab 1897 zu einzelnen Vereinigungen zumeist auf regionaler Ebene führt
und (erst) 1968 mit der Vereinigung zur „United Methodist Church“ weltweit zum Abschluß
kommt.
Von seiner Entstehung her kann der Methodismus also kaum als ‘Abspaltung’ von einer
Großkirche angesehen werden. Entsprechend verstehen sich die Methodisten selbst auch
nicht als eine Konfession, sondern als ‘Denomination’, „womit die Einheit im Wesentlichen
betont wird bei gleichzeitig möglicher Vielfalt in den äußeren Ausformungen“3. Aufgrund
seiner internen Entwicklung ist die Ökumene ein Wesensmerkmal des Methodismus, das
auch in seiner Verfassung festgeschrieben ist („nach Einheit auf allen Gebieten des kirchl.
Lebens zu streben“, auch „durch Vereinigung mit anderen Kirchen“4). Dies beruht
genauerhin darauf, daß „der Methodismus zu keiner Zeit eine Bewegung gegen Kirche und
Theologie, sondern immer gegen Unglauben und Gleichgültigkeit war“, und damit
„problemlos theologische Traditionen anderer Kirchen aufnehmen“ konnte.5 Insofern kann
der Methodismus als Vorreiter der ökumenischen Bewegung insgesamt eingeordnet werden.
2 John Wesley lebte 1703-91, sein Bruder Charles 1707-1788.
3 Kirchenlexikon, S. 135.
4 Art. 5 der Verfassung, zitiert nach Ökumene-Lexikon, Sp. 801.
5 Ökumene-Lexikon, Sp. 801.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Methodismus und Ökumene
- 1.2. Der methodistisch - römisch-katholische Dialog
- 1.2.1. Die vorliegenden Dokumente
- 1.2.2. Relevanz und Stellung des Themas „Amt“
- 2. Die Diskussion um das Amtsverständnis
- 2.1. Entwicklungslinien
- 2.2. Übereinstimmungen und Anfragen im Denver-Bericht
- 2.2.1. Punkte grundlegender Übereinstimmung
- 2.2.2. Anfragen an die katholische Auffassung
- 2.3. Diskussionspunkte im Dublin-Bericht
- 2.3.1. Das apostolische Amt
- 2.3.2. Die Schwierigkeiten mit dem „Priestertum“
- 2.3.3. Ordination
- 2.4. Die Frage der Amtstruktur im Nairobi-Bericht
- 2.5. Die Diskussion im Paris-Bericht
- 2.5.1. Ordination
- 2.5.2. Sakramentalität
- 2.5.3. Aufsicht
- 2.5.4. Das Problem: Wer ordiniert wird
- 3. Gesamteinschätzung und Herausforderung
- 4. Literaturnachweis
- 4.1. Quellentexte
- 4.2. Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Amtsverständnis im methodistisch-römisch-katholischen Dialog anhand der relevanten Dokumente. Ziel ist es, die Entwicklung des Dialogs nachzuvollziehen und die wichtigsten Übereinstimmungen und Differenzen bezüglich des Amtsverständnisses herauszuarbeiten. Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Diskussionspunkte und deren Bedeutung für das ökumenische Verständnis von Kirche und Amt.
- Entwicklung des methodistisch-römisch-katholischen Dialogs
- Vergleichende Analyse des Amtsverständnisses in beiden Konfessionen
- Schlüsselpunkte der Übereinstimmung und der Differenzen im Dialog
- Bedeutung des Amtsverständnisses für die Kirchenstruktur und -verständnis
- Herausforderungen und Perspektiven für die ökumenische Zusammenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung bietet einen kurzen Überblick über den Methodismus, seine Entstehungsgeschichte und sein ökumenisches Selbstverständnis. Sie betont die Bedeutung des ökumenischen Dialogs und die Besonderheit des methodistisch-römisch-katholischen Dialogs, der nicht von einer Geschichte formeller Konflikte belastet ist. Die methodistische Offenheit und das Verständnis als Denomination (nicht Konfession) werden als förderlich für den Dialogprozess hervorgehoben. Die Arbeit stellt die untersuchten Dokumente vor und erläutert die Relevanz des Themas „Amt“ im Kontext des neutestamentlichen Kirchenverständnisses, das sowohl charismatische als auch amtliche Strukturen umfasst. Die unterschiedliche Betonung dieser Strukturen in beiden Konfessionen wird als Ausgangspunkt der Diskussion um das Amtsverständnis dargestellt.
2. Die Diskussion um das Amtsverständnis: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des Amtsverständnisses im methodistisch-römisch-katholischen Dialog anhand verschiedener Berichte (Denver, Dublin, Nairobi, Paris). Es untersucht die Übereinstimmungen und Differenzen in den einzelnen Berichten, wobei Schwerpunkte auf dem apostolischen Amt, dem „Priestertum“ und der Ordination liegen. Für jeden Bericht werden die wichtigsten Diskussionspunkte detailliert dargestellt, einschließlich Bewertungen und Lösungsansätze. Die Kapitel unterstreichen die Herausforderungen und Entwicklungen im Dialogprozess bezüglich des Verständnisses von Amt, Ordination und der jeweiligen Kirchenstrukturen. Die Zusammenfassung der einzelnen Berichte zeigt die schrittweise Annäherung und die verbleibenden Unterschiede im Amtsverständnis auf.
Schlüsselwörter
Methodismus, Römisch-katholische Kirche, Ökumene, Amtsverständnis, Dialog, Denver-Bericht, Dublin-Bericht, Nairobi-Bericht, Paris-Bericht, Ordination, Apostolisches Amt, Priestertumsverständnis, Kirchenstruktur, Kirchenverständnis, charismatische Struktur, amtliche Struktur.
Häufig gestellte Fragen zum methodistisch-römisch-katholischen Dialog über das Amtsverständnis
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Amtsverständnis im methodistisch-römisch-katholischen Dialog anhand wichtiger Dokumente wie den Berichten von Denver, Dublin, Nairobi und Paris. Sie verfolgt die Entwicklung des Dialogs und untersucht Übereinstimmungen und Differenzen im Verständnis von Amt, Ordination und Kirchenstruktur.
Welche Dokumente werden untersucht?
Die Arbeit basiert auf den Berichten der methodistisch-römisch-katholischen Dialoge in Denver, Dublin, Nairobi und Paris. Diese Berichte bilden die Grundlage der vergleichenden Analyse des Amtsverständnisses.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung des methodistisch-römisch-katholischen Dialogs, einen vergleichenden Analyse des Amtsverständnisses beider Konfessionen, Schlüsselpunkte der Übereinstimmung und der Differenzen, die Bedeutung des Amtsverständnisses für die Kirchenstruktur und -verständnis sowie Herausforderungen und Perspektiven für die ökumenische Zusammenarbeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Diskussion um das Amtsverständnis, eine Gesamteinschätzung und einen Literaturnachweis. Das Kapitel zur Diskussion um das Amtsverständnis analysiert die Berichte von Denver, Dublin, Nairobi und Paris im Detail, wobei die Themen apostolisches Amt, „Priestertum“, Ordination und Kirchenstruktur im Mittelpunkt stehen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Methodismus, römisch-katholische Kirche, Ökumene, Amtsverständnis, Dialog, Denver-Bericht, Dublin-Bericht, Nairobi-Bericht, Paris-Bericht, Ordination, apostolisches Amt, Priestertumsverständnis, Kirchenstruktur, Kirchenverständnis, charismatische Struktur und amtliche Struktur.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse?
Die Arbeit zeigt die schrittweise Annäherung und die verbleibenden Unterschiede im Amtsverständnis beider Konfessionen auf. Sie hebt sowohl Übereinstimmungen als auch bestehende Herausforderungen im ökumenischen Dialog hervor und beleuchtet die Bedeutung des Amtsverständnisses für das Verständnis von Kirche und deren Struktur.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse der verschiedenen Berichte des methodistisch-römisch-katholischen Dialogs, um die Entwicklung des Amtsverständnisses nachzuvollziehen und Übereinstimmungen sowie Differenzen herauszuarbeiten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Theologen, Ökumene-Forscher, Studierende der Theologie und alle, die sich für den methodistisch-römisch-katholischen Dialog und das ökumenische Gespräch interessieren.
- Quote paper
- Markus Raschke (Author), 1997, Das Amtsverständnis in den Dokumenten des methodistisch/römisch-katholischen Dialogs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15299