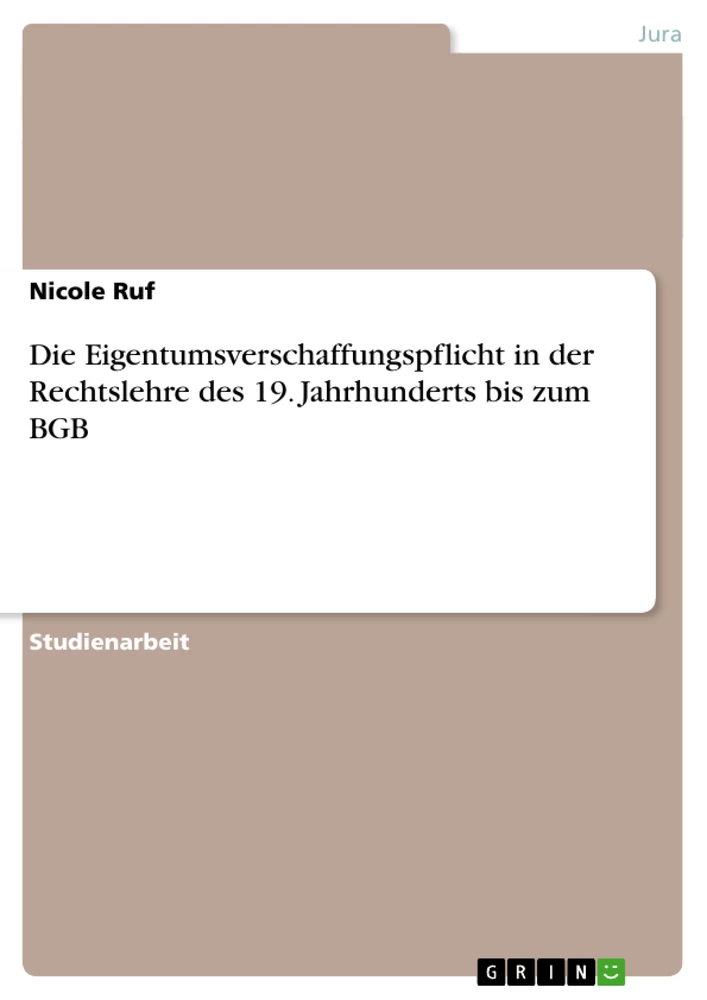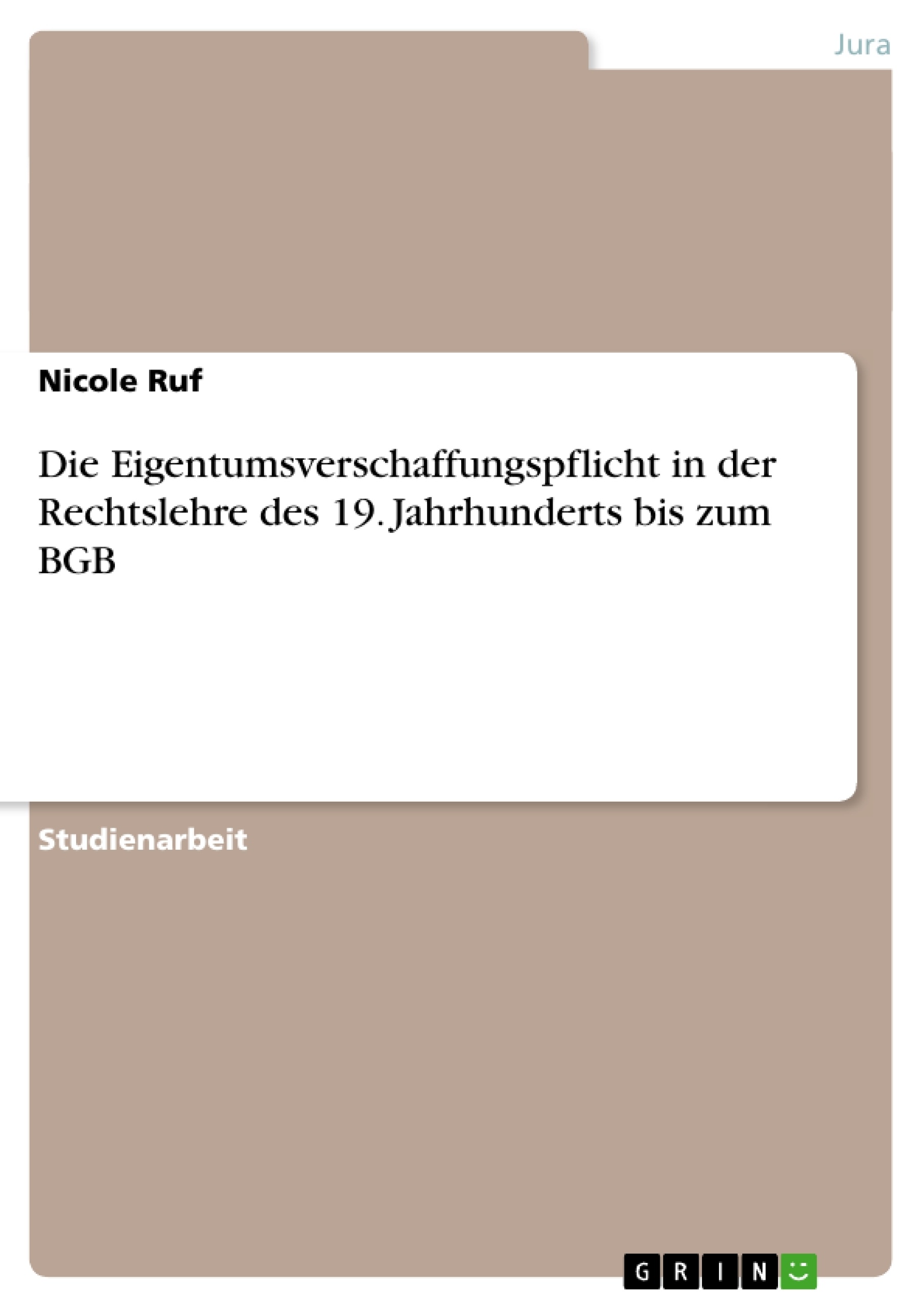Gang der Darstellung
Die Arbeit beginnt mit der Darstellung des Römischen bzw. Gemeinen Rechts
hinsichtlich der Pflichten des Verkäufers. Danach geht die Arbeit auf die Entwicklungen bis zu Beginn des 19. Jhdt. ein, also auf die Zeit, in der Grundlagen
für die Entwicklung der wissenschaftlichen Diskussion der Rechtslehre des 19. Jhdt.
entstanden sind. So werden an dieser Stelle auch die geschichtlichen Hintergründe,
wie die Epoche der Aufklärung, die „historische Schule“ und das Naturrecht erläutert,
die für die Rechtsentwicklung von großer Bedeutung waren. Dabei wird insbesondere
den herausragenden Persönlichkeiten dieser Epochen Beachtung geschenkt, die
maßgeblich die Rechtslage zur ETVPfl. beeinflusst haben. Im Hauptteil erfolgt die
Darstellung der ETVpfl. in der Rechtslehre des 19. Jahrhunderts, insbesondere im
ALR und seine Entwicklung bis zum BGB von 1900. Hierbei werden auch der
Erwerb einer fremden Sache, die Doppelkontraktion und Leistungsstörungen
behandelt. Dabei erfolgt jeweils die Illustration der Rechtsbeziehungen und
verschiedenen Wirkungen des Eigentumsübergangs inter partes und gegenüber
Dritten, auch gegenüber Rechtsnachfolgern und Gläubigern des veräußernden oder
erwerbenden Teils.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Hauptteil
- I. Das Gemeine Recht
- 1. Die Rezeption römischen Rechts in den deutschen Gebieten
- 2. Die Pflichten des Verkäufers im Römischen Recht
- 2.1. Der Eigentumsbegriff im römischen/gemeinen Recht
- 2.2. Die Pflichten des Verkäufers
- 2.3. Voraussetzungen der Erhebung des Eviktionsanspruchs
- 2.4. Inhalt des Eviktionsanspruchs
- 2.5. Gefahrübergang bei Veräußerung einer Sache
- 2.6. Der Verkauf einer fremden Sache
- II. Fortgeltung des gemeinen Rechts und seine Entwicklung bis zum 19. Jhdt.
- 1. Einfluss des Römischen (gemeinen) Rechts im 18./ 19. Jahrhundert
- 2. Entwicklung der Rechtslehren des 19. Jahrhunderts, Persönlichkeiten
- 2.1. Das Naturrecht
- 2.2. Historische Schule
- 3. Die Auffassungen des Pandektenrechts zu den Verkäuferpflichten
- 3.1. Der Eigentumsbegriff im Wandel vom römischen Recht zum 19. Jhdt.
- 3.2. Die Pflichten des Verkäufers nach den Pandekten
- 3.3. Beurteilung des Pandektenrechts bzgl. der Eigentumsverschaffungspflicht
- 3.4. Die Lehre über die Eigentumsverschaffungspflicht von Christian Wolff
- III. Die Rechtslehre des 19. Jhdt. und dessen wichtigste Kodifikationen
- 1. Rechtslage in den deutschen Gebieten im 19. Jahrhundert
- 2. Die Kodifizierung des ALR
- 2.1. Der Geltungsbereich des ALR von 1794 bis zu seiner Ablösung durch das BGB
- 2.1.1. Geltungsbereich bei Inkrafttreten 1794
- 2.1.2. Die Fremdherrschaft Napoleons und der Tilsiter Frieden
- 2.1.3. Kritik am ALR
- 2.2. ALR Systematik und soziale Beschränkungen
- 2.2.1. Der Charakter des ALR
- 2.2.2. Systematik des ALR
- 2.2.3. Ständeordnung im ALR
- 2.1. Der Geltungsbereich des ALR von 1794 bis zu seiner Ablösung durch das BGB
- 3. Die Eigentumsverschaffungspflicht des Verkäufers im ALR
- 3.1. Der Eigentumsbegriff im ALR
- 3.2. Die Reglungen des ALR zur Eigentumsverschaffungspflicht
- 3.3. Das schuldrechtliche Erwerbsgeschäft - der Kaufvertrag
- 3.4. Der Eigentumserwerb und das Jus ad rem
- 3.5. Die Ausgestaltung der Eviktionsleistung (§ 136 I 11) im ALR
- Leistungsstörungen im ALR
- 1. Verzug beim Kaufvertrag
- 3. Die Schlechtleistung
- 4. Sonstige Leistungsstörungen
- 3.4. Gutgläubiger Erwerb im ALR (Verträge über fremde Sachen)
- 3.5. Abschluss mehrerer schuldrechtlicher Verträge über dieselbe Sache
- 3.6. Eigentumsverschaffung unter einer Bedingung
- 4. Das ALR Recht der Eigentumsverschaffung im Rechtsvergleich
- 5. Die Reformgesetze (insbesondere das Eigentumserwerbsgesetz von 1872)
- IV. 19. Jhdt. bis zum Inkrafttreten des bürgerlichen Gesetzbuches 1900
- 1. Kodifikationsstreit Thibaut - Savigny
- 2. Die Entstehung des BGB und seine Einflüsse
- 3. Absolute Geltung des BGB (Geltungsbereich)
- 4. Beurteilung des BGB
- 5. Der Einfluss Otto von Gierkes
- V. Das Bürgerliche Gesetzbuch von 1900
- 1. Materielle Beurteilung des Entwurfs zum BGB
- 2. Die Eigentumsverschaffungspflicht im BGB
- 2.1. Eigentum und Eigentumsverschaffungspflicht
- 2.2. Sach- und Rechtsmängelhaftung im Wandel der Zeit
- 2.3. Genuskauf im BGB
- 2.4. Eigentumsverschaffungspflicht bei beweglichen Sachen
- 2.5. Eigentumsverschaffungspflicht bei Grundstücken
- 2.6. Eigentumsverschaffungspflicht beim Kauf von Rechten
- 2.7. Die Eigentumsverschaffungspflicht unter einer Bedingung
- 2.8. Der Eigentumsverschaffungswille des Verkäufers beim Barkauf
- 3. Das Abstraktions- und Trennungsprinzip – „der große Grundsatz“
- 3.1 Durchbrechungen des Traditionsprinzips
- 3.2. Beurteilung des „Großen Grundsatzes“ für die Kaufvertragsparteien
- I. Das Gemeine Recht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Eigentumsverschaffungspflicht in der Rechtslehre des 19. Jahrhunderts bis zur Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Ziel ist es, die Entwicklung des Rechtsverständnisses bezüglich dieser Pflicht nachzuvollziehen und die wichtigsten Meilensteine und Einflüsse zu beleuchten.
- Entwicklung des Eigentumsbegriffs vom römischen Recht bis zum BGB
- Verpflichtungen des Verkäufers im römischen und gemeinen Recht
- Einfluss der Naturrechtslehre und der historischen Schule auf die Rechtsentwicklung
- Analyse des Allgemeinen Landrechts (ALR) und seiner Relevanz
- Die Kodifizierung im BGB und deren Auswirkungen auf die Eigentumsverschaffungspflicht
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Eigentumsverschaffungspflicht ein und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit. Sie begründet die Relevanz der Thematik und umreißt den chronologischen Ablauf der Untersuchung, beginnend mit dem römischen Recht und endend mit dem BGB.
B. Hauptteil I. Das Gemeine Recht: Dieses Kapitel untersucht die Grundlagen der Eigentumsverschaffungspflicht im römischen und gemeinen Recht. Es analysiert den Eigentumsbegriff, die Pflichten des Verkäufers, die Voraussetzungen und den Inhalt des Eviktionsanspruchs, den Gefahrübergang und den Verkauf fremder Sachen. Die detaillierte Auseinandersetzung mit den römischen Rechtsgrundlagen bildet die Basis für das Verständnis der späteren Entwicklungen.
B. Hauptteil II. Fortgeltung des gemeinen Rechts und seine Entwicklung bis zum 19. Jhdt.: Dieses Kapitel beleuchtet die Weiterentwicklung der Rechtsauffassungen vom 18. bis zum 19. Jahrhundert. Es analysiert den Einfluss des römischen Rechts, die Rolle von Naturrechtslehre und historischer Schule, sowie die Auffassungen des Pandektenrechts hinsichtlich der Verkäuferpflichten und der Lehre von Christian Wolff. Der Fokus liegt auf dem Wandel des Eigentumsbegriffs und der sich verändernden Rechtsprechung.
B. Hauptteil III. Die Rechtslehre des 19. Jhdt. und dessen wichtigste Kodifikationen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rechtslage im 19. Jahrhundert in den deutschen Gebieten, insbesondere auf die Kodifizierung des Allgemeinen Landrechts (ALR). Es analysiert den Geltungsbereich des ALR, seine Systematik, soziale Beschränkungen und Kritikpunkte. Der Schwerpunkt liegt auf der Eigentumsverschaffungspflicht im ALR, einschließlich der Regelung des Kaufvertrags, des Eigentumserwerbs und der Eviktionsleistung. Leistungsstörungen und der gutgläubige Erwerb werden ebenfalls behandelt.
B. Hauptteil IV. 19. Jhdt. bis zum Inkrafttreten des bürgerlichen Gesetzbuches 1900: Dieses Kapitel beschreibt den Kodifikationsstreit zwischen Thibaut und Savigny und die Entstehung des BGB. Es analysiert die Einflüsse auf die Entstehung des BGB und dessen absolute Geltung. Die Bedeutung von Otto von Gierkes wird ebenfalls beleuchtet.
B. Hauptteil V. Das Bürgerliche Gesetzbuch von 1900: Dieses Kapitel analysiert den Entwurf des BGB und die Eigentumsverschaffungspflicht im BGB. Es untersucht den Eigentumsbegriff, die Sach- und Rechtsmängelhaftung, den Genuskauf, sowie die Eigentumsverschaffungspflicht bei verschiedenen Sachverhalten (bewegliche Sachen, Grundstücke, Rechte). Das Abstraktions- und Trennungsprinzip wird eingehend diskutiert.
Schlüsselwörter
Eigentumsverschaffungspflicht, Römisches Recht, Gemeines Recht, Pandektenrecht, Naturrecht, Historische Rechtsschule, Allgemeines Landrecht (ALR), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kodifikation, Kaufvertrag, Eviktionsanspruch, Eigentumserwerb, Sachmängelhaftung, Rechtsmängelhaftung, Abstraktionsprinzip, Trennungsprinzip.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studienarbeit: Eigentumsverschaffungspflicht vom Römischen Recht bis zum BGB
Was ist der Gegenstand dieser Studienarbeit?
Die Studienarbeit untersucht die Entwicklung der Eigentumsverschaffungspflicht in der Rechtslehre des 19. Jahrhunderts bis zur Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Sie verfolgt die Entwicklung des Rechtsverständnisses dieser Pflicht und beleuchtet wichtige Meilensteine und Einflüsse.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Eigentumsbegriffs vom römischen Recht bis zum BGB, die Verpflichtungen des Verkäufers im römischen und gemeinen Recht, den Einfluss der Naturrechtslehre und der historischen Schule, eine Analyse des Allgemeinen Landrechts (ALR) und dessen Relevanz, sowie die Kodifizierung im BGB und deren Auswirkungen auf die Eigentumsverschaffungspflicht.
Welche Zeiträume werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet den Zeitraum vom römischen Recht bis zur Einführung des BGB im Jahr 1900. Sie umfasst also die Entwicklung des Rechts über Jahrhunderte hinweg, mit besonderem Fokus auf das 18. und 19. Jahrhundert.
Welche Rechtsquellen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert das römische Recht, das gemeine Recht, das Allgemeine Landrecht (ALR) und das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Sie betrachtet auch die Rechtslehren verschiedener Denkschulen, wie die Naturrechtslehre und die historische Schule.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in eine Einleitung, einen Hauptteil und ein Kapitel mit Schlüsselbegriffen gegliedert. Der Hauptteil unterteilt sich in Abschnitte, die das römische Recht, die Entwicklung des gemeinen Rechts bis zum 19. Jahrhundert, die Rechtslehre des 19. Jahrhunderts mit dem ALR, die Zeit bis zum BGB und schließlich das BGB selbst behandeln.
Welche Rolle spielt das Allgemeine Landrecht (ALR)?
Das ALR wird als wichtige Kodifikation des 19. Jahrhunderts analysiert. Die Arbeit untersucht seinen Geltungsbereich, seine Systematik, soziale Beschränkungen, Kritikpunkte und vor allem die Regelung der Eigentumsverschaffungspflicht im ALR.
Welche Bedeutung hat das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)?
Das BGB bildet den Schlusspunkt der Arbeit. Die Analyse konzentriert sich auf den Entwurf des BGB, die Eigentumsverschaffungspflicht im BGB, den Eigentumsbegriff, die Sach- und Rechtsmängelhaftung und das Abstraktions- und Trennungsprinzip.
Welche zentralen Persönlichkeiten werden erwähnt?
Die Arbeit erwähnt unter anderem Christian Wolff im Kontext des Pandektenrechts und den Kodifikationsstreit zwischen Thibaut und Savigny sowie den Einfluss von Otto von Gierke auf die Entstehung des BGB.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind Eigentumsverschaffungspflicht, Römisches Recht, Gemeines Recht, Pandektenrecht, Naturrecht, Historische Rechtsschule, Allgemeines Landrecht (ALR), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kodifikation, Kaufvertrag, Eviktionsanspruch, Eigentumserwerb, Sachmängelhaftung, Rechtsmängelhaftung, Abstraktionsprinzip und Trennungsprinzip.
Wo finde ich den vollständigen Inhaltsverzeichnis?
Das vollständige Inhaltsverzeichnis befindet sich zu Beginn der HTML-Datei. Es bietet eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel der Arbeit.
- Quote paper
- Nicole Ruf (Author), 2008, Die Eigentumsverschaffungspflicht in der Rechtslehre des 19. Jahrhunderts bis zum BGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152952