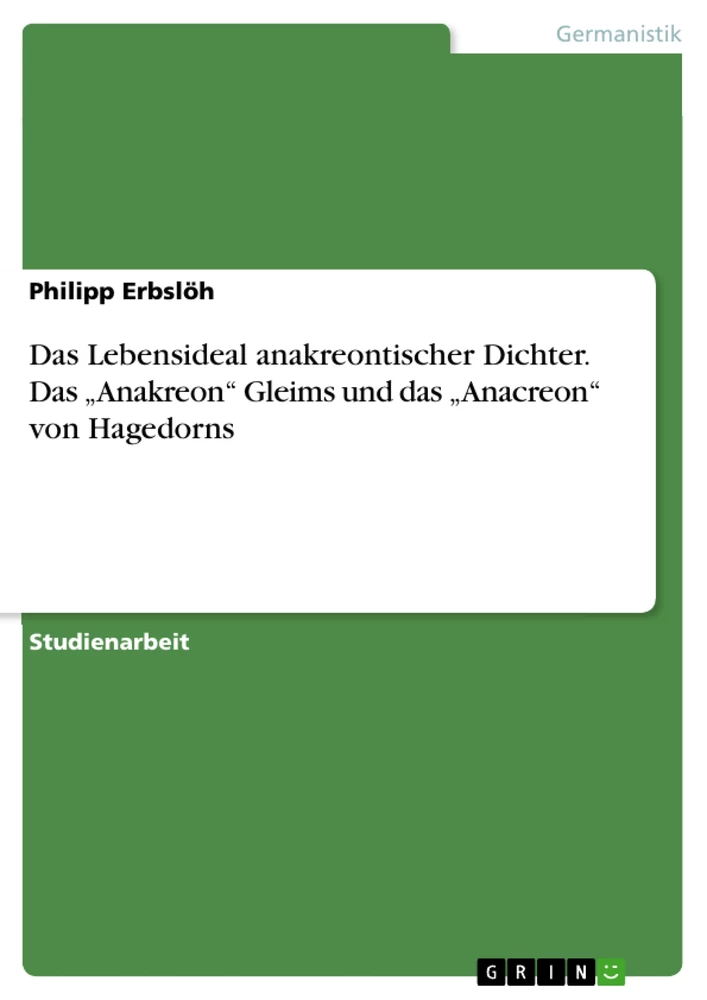Die Gedichte „Anakreon“ von Johan Wilhelm Ludwig Gleim und „Anacreon“ von Friedrich von Hagedorn stehen stellvertretend für die literarische „Modedichtung“ in der Mitte des 18. Jahrhunderts, der Anakreontik. Nach Auseinandersetzung mit der antiken Figur des Anakreon und verschiedener Bemühungen um gehaltvolle Anakreon-Übertragungen bildet die Gedichtsammlung Gleims „Versuch in Scherzhaften Liedern und Lieder“ aus den Jahren 1744/45, den Beginn einer literarischen Periode der schöpferischen Gestaltung einer eigenständigen deutschen Dichtkunst. Diese war um Nachahmung in Geist und Form des antiken Vorbilds Anakreons aus dem sechsten Jahrhundert vor Christus bemüht.
Ein Rückbezug auf einen antiken Dichter war in dieser Form keine Seltenheit, doch wurde das Ausmaß dieser sich im 18. Jahrhundert entwickelnden anakreontischen Bewegung schon 1854 in der Art gesehen,
dass die Anakreon-Begeisterung der Generation um Hagedorn und Gleim viel mehr war als eine der üblichen, immer wieder sporadisch auftauschenden Imitationswellen seit der Frühen Neuzeit. Noch nie wurde einem antiken Dichter [aber] ein so exponierter Einfluß auf alle Lebensbereiche „weit über das eigentliche Kunstgebiet hinaus“ eingeräumt.
Der Dichter Gleim war Teil dieser anakreontischen Bewegung, er gehörte dem Kreise der Hallenser Anakreontiker an, einem lockeren Zusammenschluss unter anderem mit den Hallenser Studenten Johann Peter Uz und Johann Nicolaus Götz.
Der weder dem Hallenser Kreise noch einem anderen Literatenkreise zugehörende Friedrich von Hagedorn schreibt 1747 sein Gedicht „Anacreon.“, und leistet damit einen andersartigen Beitrag zur allgemeinen Beschäftigung mit der Figur des Anakreon, indem sein „Anakreon“ von dem Umgang der Dichter mit den anakreontischen Gesängen handelt.
Die vorliegende Hausarbeit wird sich anhand dieser zwei Gedichte gleichen Titels mit den verschiedenen Zugängen sowohl zur anakreontischen Dichtung als auch zu dem anakreontischen Lebensideal befassen. Der zentrale Aspekt ist hierbei die Untersuchung sowie der Vergleich der Aussageabsichten beider Autoren hinsichtlich ihres Dichterbildes. Dieser Vergleich schließt sich an die separate Untersuchung der zwei Gedichte an.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Betrachtung und Analyse von Johann Wilhelm Ludwig Gleims „Anakreon“
- II. Betrachtung und Analyse von Friedrich von Hagedorns „Anacreon“
- III. Vergleich der beiden Gedichte
- III.1. in Bezug auf die Adaption eines Anakreon-Bildes
- III.2. bezugnehmend auf das Dichterleben unter anakreontischen Leitgedanken
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gedichte „Anakreon“ von Johann Wilhelm Ludwig Gleim und „Anacreon“ von Friedrich von Hagedorn, um die verschiedenen Zugänge zur anakreontischen Dichtung und dem anakreontischen Lebensideal zu beleuchten. Im Fokus steht der Vergleich der Aussageabsichten beider Autoren bezüglich ihres Dichterbildes. Die Analyse der einzelnen Gedichte bildet die Grundlage für diesen Vergleich.
- Anakreontische Bewegung im 18. Jahrhundert
- Vergleichende Analyse der Gedichte Gleims und Hagedorns
- Adaption des Anakreon-Bildes in der Literatur
- Das anakreontische Lebensideal in der Dichtung
- Formale Aspekte und Stilmittel der anakreontischen Lyrik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Gedichte „Anakreon“ von Gleim und „Anacreon“ von Hagedorn als repräsentative Beispiele der anakreontischen Modedichtung des 18. Jahrhunderts vor. Sie beschreibt den Kontext der Nachahmung des antiken Dichters Anakreon und die Bedeutung dieser Bewegung für die Entwicklung einer eigenständigen deutschen Dichtkunst. Die Arbeit kündigt die vergleichende Analyse der beiden Gedichte und deren unterschiedlicher Zugänge zum anakreontischen Lebensideal an.
I. Betrachtung und Analyse von Johann Wilhelm Ludwig Gleims „Anakreon“: Gleims „Anakreon“, das eröffnende Gedicht seiner Sammlung „Versuch in Scherzhaften Liedern“, wird analysiert. Das Gedicht präsentiert eine Art „Schnittmuster“ der Lebenswelt Anakreons, geprägt von Wein, Liebe, Geselligkeit und einem eudämonistischen Lebensgefühl. Gleims Adaption des Anakreon-Bildes zeichnet sich durch eine parodistische Übertreibung der anakreontischen Motive aus. Die formale Gestaltung mit Repetitionen und parataktischer Reihung trägt zur Gestaltung des Gedichtes bei und unterstreicht den Fokus auf das genussvolle Leben. Der Gebrauch von Wiederholungen und die parataktische Struktur gliedern das Gedicht in zwei Teile: der erste Teil mit Repetitionen des Verses "Und singt von Wein und Liebe" und ein zweiter Teil mit einer Häufung von parataktischen Reihen. Diese Gestaltung hebt die Lebensfreude und den Fokus auf die Sinneslust hervor.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Gleims und Hagedorns Anakreon-Gedichten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert und vergleicht die Gedichte „Anakreon“ von Johann Wilhelm Ludwig Gleim und „Anacreon“ von Friedrich von Hagedorn. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Zugängen beider Autoren zur anakreontischen Dichtung und dem damit verbundenen Lebensideal, insbesondere im Hinblick auf ihr jeweiliges Dichterbild.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die anakreontische Bewegung des 18. Jahrhunderts, vergleicht die Gedichte von Gleim und Hagedorn, analysiert die Adaption des Anakreon-Bildes in der Literatur, untersucht das anakreontische Lebensideal in der Dichtung und betrachtet formale Aspekte und Stilmittel der anakreontischen Lyrik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, zwei Kapitel zur Analyse der Gedichte von Gleim und Hagedorn, ein Kapitel zum Vergleich beider Gedichte (unterteilt in die Adaption des Anakreon-Bildes und das anakreontische Lebensideal) und eine Schlussbemerkung. Das Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht.
Wie wird Gleims „Anakreon“ analysiert?
Die Analyse von Gleims „Anakreon“ beschreibt das Gedicht als ein „Schnittmuster“ der Lebenswelt Anakreons, charakterisiert durch Wein, Liebe, Geselligkeit und Eudaimonie. Gleims Adaption wird als parodistische Übertreibung anakreontischer Motive dargestellt. Die formale Gestaltung mit Repetitionen und parataktischer Reihung wird im Detail erläutert und in Bezug zum Thema gesetzt.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Interpretationen und Darstellungen des anakreontischen Ideals in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts zu beleuchten und durch den Vergleich der beiden Gedichte ein tieferes Verständnis der jeweiligen poetischen Intentionen zu erreichen.
Welche Rolle spielt der Vergleich der Gedichte?
Der Vergleich der Gedichte von Gleim und Hagedorn bildet den Kern der Arbeit. Er dient dazu, die unterschiedlichen Zugänge zum anakreontischen Lebensideal und Dichterbild der beiden Autoren herauszuarbeiten und zu kontrastieren. Der Vergleich fokussiert insbesondere auf die Adaption des Anakreon-Bildes und die Umsetzung des anakreontischen Lebensideals in den jeweiligen Gedichten.
- Quote paper
- Philipp Erbslöh (Author), 2003, Das Lebensideal anakreontischer Dichter. Das „Anakreon“ Gleims und das „Anacreon“ von Hagedorns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152794