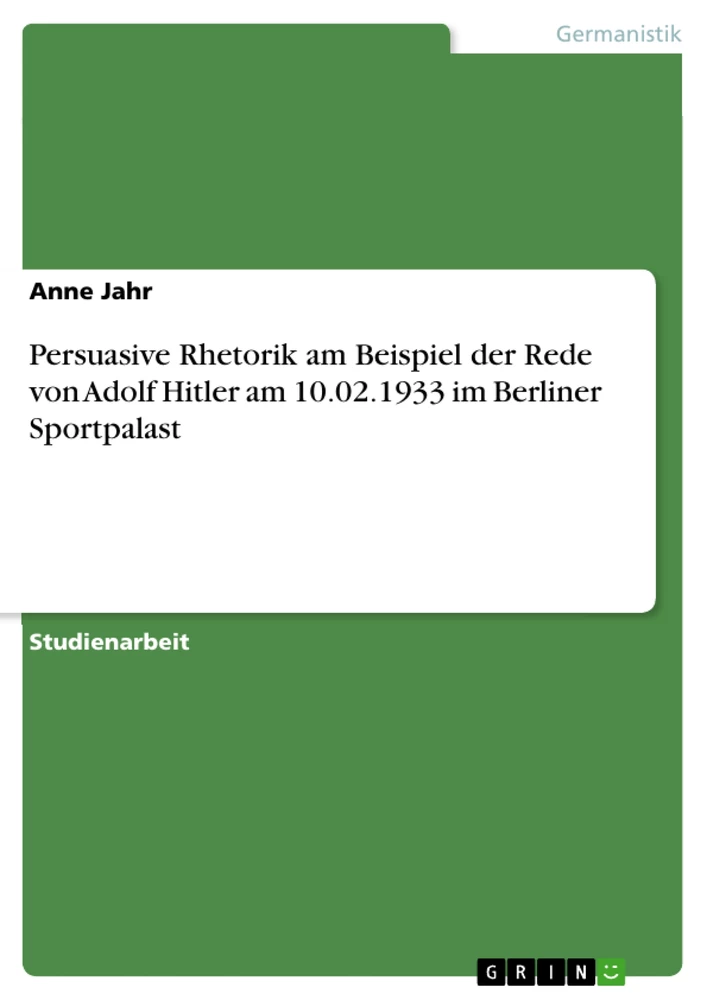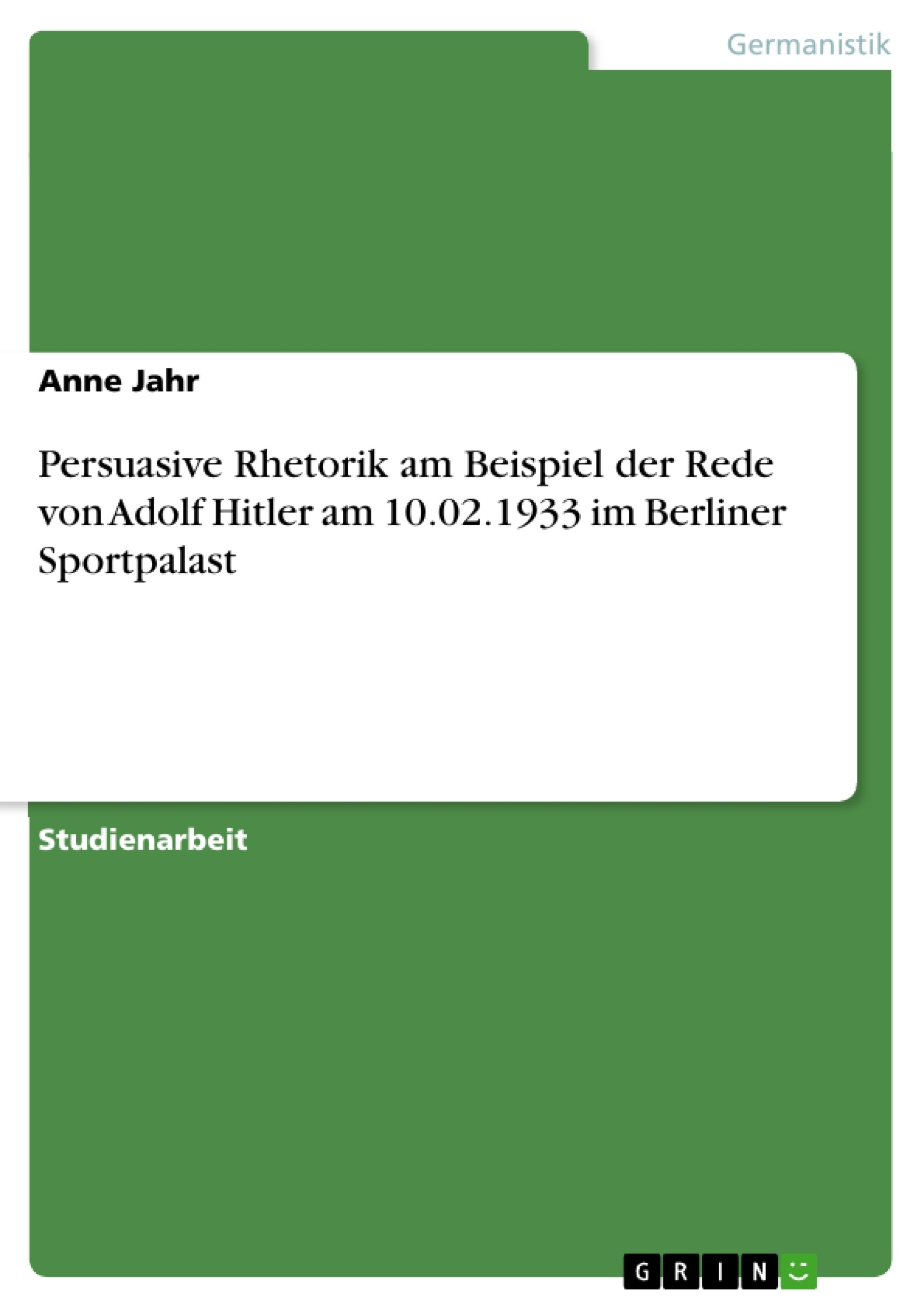Die Beschäftigung mit der „zu politischen Zwecken benutzten Sprache“ fand vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Zusammenbruch des NS-Regimes Verbreitung, obwohl Sprache seit jeher eines der wichtigsten Instrumente in der Politik darstellt. Die politische Rede im Nationalsozialismus sah die Hauptfunktion der Sprache darin, das Publikum durch emotionale und psychische Erregung sowie suggestive Glaubwürdigkeit auf seine Seite zu ziehen. Bereits Aristoteles, auf den die drei Grundarten der
Überzeugung – ethos, pathos und logos – zurückgehen, ließ der affektuellen „persuasio“ besondere Bedeutung zukommen. Hitler selbst war sich über die Wirkung von Rhetorik bewusst. Im Vorwort seiner Autobiografie ‚Mein Kampf’ schreibt er: „Ich weiß, daß man Menschen weniger durch das geschriebene Wort als vielmehr durch das gesprochene zu gewinnen vermag, daß jede große Bewegung auf dieser Erde ihr Wachsen den großen Rednern und nicht den großen Schreibern verdankt“4. Und an anderer Stelle heißt es, dass die Ansichten der Menschen nicht durch ihren Verstand, sondern „durch das Gefühl gestützt sind“ und dass es deshalb gilt, „diese geheimnisvollen Kräfte“ anzusprechen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Redesituation
- 3. Gliederung der Rede
- 3.1. Zum Inhalt
- 3.2. Die Programmpunkte
- 4. Persuasion als Redeabsicht
- 4.1. Die Redestrategien
- 4.2. Propagandasprache
- 5. Vagheit und Polysemie
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Hitlers Rede vom 10. Februar 1933 im Berliner Sportpalast, um die persuasive Rhetorik und ihre Wirkung auf das Publikum zu untersuchen. Es wird gezeigt, wie Hitler durch Sprache und Inszenierung seine politischen Ziele verfolgte.
- Analyse der Redesituation und des Kontextes
- Untersuchung der rhetorischen Strategien (Ethos, Pathos, Logos)
- Die Rolle von Propaganda und suggestiver Sprache
- Der Einfluss von Vagheit und Mehrdeutigkeit (Polysemie)
- Wirkung der Rede auf das Publikum
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Analyse von Hitlers Rede vom 10. Februar 1933 ein. Sie begründet die Relevanz der Untersuchung persuasiver Rhetorik im Kontext der politischen Rede im Nationalsozialismus und hebt die besondere Bedeutung der Sprache als Instrument der politischen Manipulation hervor. Die Arbeit verweist auf die Bedeutung von Aristoteles' Überzeugungsmitteln (Ethos, Pathos, Logos) und Hitlers eigenes Bewusstsein über die Macht der gesprochenen Sprache, wie in "Mein Kampf" dokumentiert. Der Fokus liegt auf der Analyse der Methoden, mit denen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit geschaffen und das Publikum beeinflusst wird.
2. Die Redesituation: Dieses Kapitel beschreibt den historischen Kontext und die Redesituation von Hitlers Rede. Es erläutert die politische Lage nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933, die begrenzte Macht der NSDAP und die geplante "legale Revolution" mit anschließenden Neuwahlen. Die Rede im Berliner Sportpalast wird als erste "Verlautbarung der Reichsregierung" vor dem deutschen Volk dargestellt. Das Kapitel beschreibt detailliert das Publikum (hauptsächlich NSDAP-Anhänger), die Übertragung der Rede über Lautsprecher und Rundfunk, sowie die professionelle Inszenierung mit Hakenkreuzfahnen, Scheinwerfern und Hitlers erhöhter Position. Die detaillierte Beschreibung der Inszenierung betont deren Beitrag zur Schaffung einer Atmosphäre, die das Publikum empfänglich für Hitlers Botschaften machte.
3. Gliederung der Rede: Dieses Kapitel gliedert Hitlers Rede in Einleitung, Hauptteil (mit zwei größeren Themenkomplexen) und Schluss. Der Hauptteil wird als Darlegung der Gründe für Hitlers Engagement in der Politik und die Einleitung einer neuen Phase des Kampfes um die "deutsche Erhebung" beschrieben. Der Inhalt des Hauptteils umfasst Hitlers Darstellung der Situation nach dem Ersten Weltkrieg, die Betonung von Not und Ungerechtigkeit, die Schuldzuweisung an die Marxisten und die Ankündigung eines Kampfes gegen den Marxismus. Es wird hervorgehoben, dass Hitler seine Behauptungen nicht mit Fakten, sondern mit eindrucksvollen Bildern untermauert.
Schlüsselwörter
Persuasive Rhetorik, Adolf Hitler, politische Rede, Nationalsozialismus, Propaganda, Propagandasprache, Redesituation, Überzeugung, Ethos, Pathos, Logos, Vagheit, Polysemie, Mein Kampf, Berliner Sportpalast, emotionale Erregung, suggestive Glaubwürdigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse von Hitlers Rede vom 10. Februar 1933
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Diese Arbeit analysiert die Rede Adolf Hitlers vom 10. Februar 1933 im Berliner Sportpalast. Der Fokus liegt auf der persuasiven Rhetorik, den angewandten Strategien und deren Wirkung auf das Publikum. Die Analyse untersucht, wie Hitler durch Sprache und Inszenierung seine politischen Ziele verfolgte.
Welche Aspekte der Rede werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Redesituation und den historischen Kontext, die rhetorischen Strategien (Ethos, Pathos, Logos), die Rolle von Propaganda und suggestiver Sprache, den Einfluss von Vagheit und Mehrdeutigkeit (Polysemie) sowie die Wirkung der Rede auf das Publikum. Die Gliederung der Rede selbst wird ebenfalls detailliert betrachtet.
Welche Kapitel umfasst die Analyse?
Die Analyse gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Redesituation, Gliederung der Rede (mit Unterkapiteln zum Inhalt und den Programmpunkten), Persuasion als Redeabsicht (mit Unterkapiteln zu den Redestrategien und Propagandasprache), Vagheit und Polysemie und Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Zusammenfassung der jeweiligen Aspekte der Rede.
Welche Zielsetzung verfolgt die Analyse?
Die Arbeit zielt darauf ab, die persuasive Rhetorik Hitlers zu untersuchen und aufzuzeigen, wie er durch Sprache und Inszenierung seine politischen Ziele verfolgte. Es wird untersucht, wie er ein Gefühl der Zusammengehörigkeit schuf und das Publikum beeinflusste.
Welche Rolle spielen Ethos, Pathos und Logos in der Analyse?
Die Analyse untersucht, wie Hitler die drei aristotelischen Überzeugungsmittel – Ethos (Glaubwürdigkeit), Pathos (Emotionen) und Logos (Logik) – in seiner Rede einsetzte, um sein Publikum zu überzeugen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Wirkung dieser Mittel im Kontext der politischen Propaganda.
Welche Bedeutung hat die Redesituation?
Die Analyse betrachtet die Redesituation als entscheidenden Faktor für die Wirkung der Rede. Der historische Kontext (politische Lage nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler, geplante "legale Revolution"), das Publikum (hauptsächlich NSDAP-Anhänger), die technische Übertragung (Lautsprecher, Rundfunk) und die professionelle Inszenierung (Hakenkreuzfahnen, Scheinwerfer, erhöhte Position Hitlers) werden detailliert beschrieben und in Bezug zur Wirkung der Rede gesetzt.
Wie wird die Struktur der Rede analysiert?
Die Rede wird in Einleitung, Hauptteil (mit zwei größeren Themenkomplexen) und Schluss gegliedert. Der Hauptteil wird als Darlegung der Gründe für Hitlers Engagement in der Politik und die Einleitung einer neuen Phase des Kampfes um die "deutsche Erhebung" beschrieben. Die Analyse untersucht den Inhalt des Hauptteils, die rhetorischen Mittel und die Art der Argumentation (oder das Fehlen derselben).
Welche Rolle spielt Propaganda in Hitlers Rede?
Die Analyse untersucht die Verwendung von Propagandasprache und suggestiven Mitteln in Hitlers Rede. Es wird gezeigt, wie Hitler durch eindrucksvolle Bilder und emotionale Appelle seine Behauptungen untermauerte, oft ohne diese mit Fakten zu belegen. Die Rolle der Mehrdeutigkeit (Polysemie) und Vagheit in der Propagandasprache wird ebenfalls untersucht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Analyse?
Schlüsselwörter sind: Persuasive Rhetorik, Adolf Hitler, politische Rede, Nationalsozialismus, Propaganda, Propagandasprache, Redesituation, Überzeugung, Ethos, Pathos, Logos, Vagheit, Polysemie, Mein Kampf, Berliner Sportpalast, emotionale Erregung, suggestive Glaubwürdigkeit.
- Citar trabajo
- Anne Jahr (Autor), 2008, Persuasive Rhetorik am Beispiel der Rede von Adolf Hitler am 10.02.1933 im Berliner Sportpalast, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152730