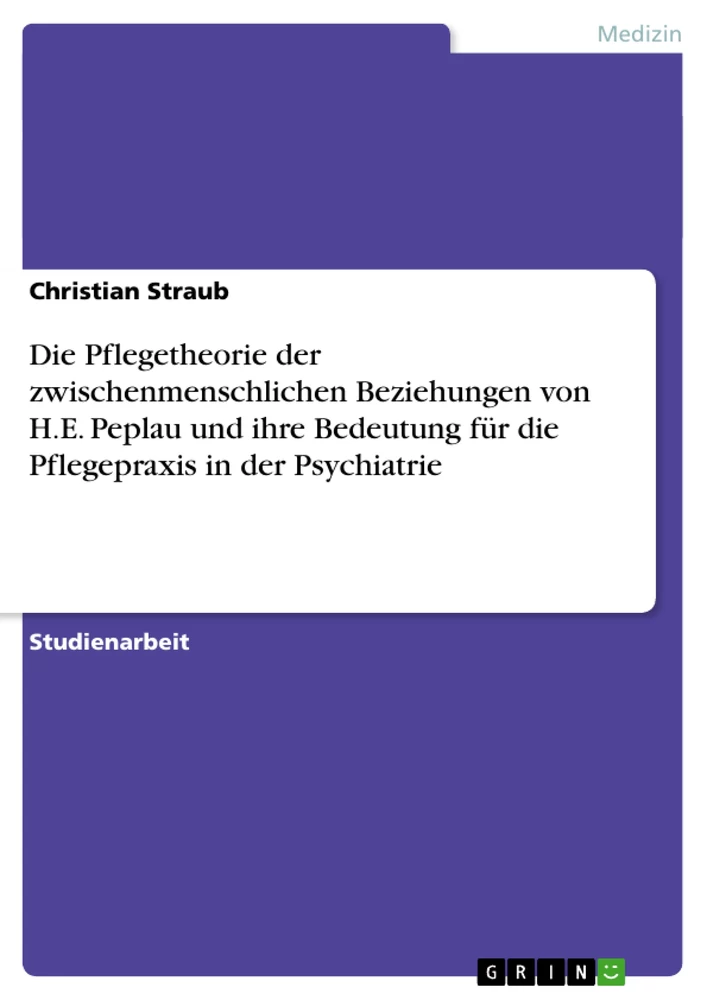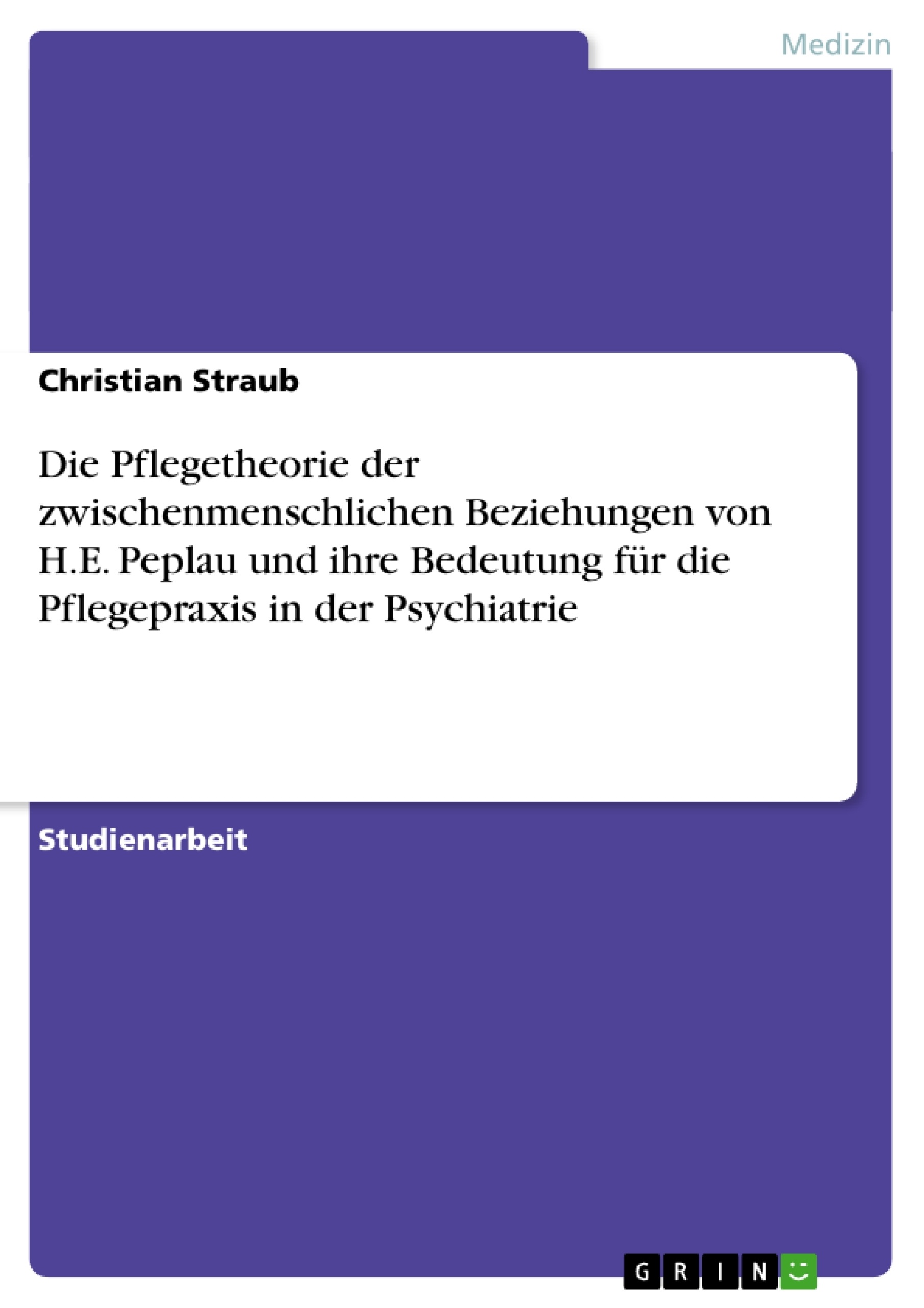Die 1909 in Pensylvania, USA geborene Hildegard E. Peplau schloss 1931 ihre
Ausbildung zur Krankenschwester ab und arbeitete dann im Operationsdienst, bis sie
1936 Leiterin des Gesundheitsdienstes am Bennington College wurde und gleichzeitig
begann, „Interpersonale Psychologie“ zu studieren, was sie 1943 mit dem Bachelor of
Arts abschloss. Nach ihrer Tätigkeit als Leutnant des amerikanischen Armeepflegekorps
in England absolvierte sie ein Studium am Teachers College der Columbia University,
und erwarb dort den „Master of Arts“ in psychiatrischer Krankenpflege. Parallel zu
ihrer Promotion zum Educational Doctor arbeitete sie sowohl im klinischen als auch
ambulanten Bereich als psychiatrische Krankenschwester. 1954 ging sie an die
Universität von New Jersey, wo sie bis zu ihrer Emeritierung im Jahr 1974
psychiatrische Pflege lehrte. Hildegard E. Peplau war außerdem tätig in verschiedensten
Organisationen und Institutionen, unter anderem der Weltgesundheitsorganisation und
dem amerikanischen Krankenpflegeverband. Sie wurde mehrfach für ihre Verdienste
ausgezeichnet und erhielt vier Ehrendoktorwürden.
Ihr Buch „Interpersonal relations of nursing“ veröffentlichte Hildegard E. Peplau 1952
und revolutionierte damit die psychiatrische Krankenpflege der damaligen Zeit.
Pflegewissenschaftlich relevante Hypothesen waren bis dato nur von Florence
Nightingale aufgestellt worden, Virginia Henderson veröffentlichte ihre Definition der
14 Grundbedürfnisse erst 1955. Peplaus Werk fußt auf den Grundannahmen der humanistischen Psychologie. So
orientierte sie sich maßgeblich an Maslow (Motivationstheorie), Miller
(Persönlichkeitstheorie), Symonds (psychoanalytische Theorie) und Sullivan
(Persönlichkeitsentwicklung) und nutzte deren wichtigste verhaltenspsychologische und
psychoanalytische Theorien zur Entwicklung ihrer spezifischen Beschreibung von
Krankenpflege. Zu dieser Zeit stellte eine solche Art der Vorgehensweise in der
Wissenschaft ein Novum dar. Vor diesem Hintergrund stellte Peplau umfangreiche Beobachtungen in der
pflegerischen Praxis an, um die alltagsweltlichen Erfahrungen von Pflegenden mit dem
Verständnis des symbolischen Interaktionismus auf allgemein gültige Hypothesen
zurückführen zu können - ein methodisches Vorgehen, dass wir heute mit dem Begriff
der Grounded Theory beschreiben würden. Peplau stellte in ihrer Theorie die Beziehung
von Pflegekraft und Patient in den Mittelpunkt und begründete dadurch die Schule der
Interaktionstheoretiker/innen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung ins Thema
- Geschichtlicher Hintergrund
- Wissenschaftstheoretischer Hintergrund
- Metaparadigmen der Pflege
- Mensch und Gesellschaft
- Gesundheit und Krankheit
- Pflege
- Schlüsselkonzepte
- Psychodynamische Pflege
- Die Beziehung zwischen Pflegeperson und Patient
- Rollen der Pflegenden
- Theorie und Praxis
- Bezugspflege und Pflegeprozeß
- Möglichkeiten für das case management
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat befasst sich mit der Pflegetheorie der zwischenmenschlichen Beziehungen von Hildegard E. Peplau und analysiert ihre Relevanz für die Pflegepraxis in der Psychiatrie. Es soll die Verknüpfung von wissenschaftlicher Theorie und pflegerischer Praxis verdeutlichen und Ansatzpunkte für ein zeitgerechtes Pflegemanagement aufzeigen.
- Die Pflegetheorie von Hildegard E. Peplau und ihre wissenschaftlichen Grundlagen
- Die Bedeutung der zwischenmenschlichen Beziehungen in der psychiatrischen Pflege
- Die Rolle von Kommunikation, Empathie und Interaktion in der Pflege
- Praktische Anwendung der Pflegetheorie in der psychiatrischen Praxis
- Bedeutung der Theorie für ein zeitgemäßes Pflegemanagement
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung ins Thema: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Biografie von Hildegard E. Peplau und die Entstehung ihrer Pflegetheorie. Es beleuchtet den wissenschaftstheoretischen Hintergrund, insbesondere die Einflüsse humanistischer Psychologie, und beschreibt die Entwicklung der Theorie aus der Praxis heraus.
- Metaparadigmen der Pflege: Dieses Kapitel erläutert die zentralen Konzepte von Peplaus Theorie, insbesondere die Sichtweise auf den Menschen, Gesundheit, Krankheit und Pflege. Es zeigt, wie Peplau die Rolle der zwischenmenschlichen Beziehungen in der Pflege betont und die Bedeutung der Berücksichtigung von Bedürfnissen, Frustrationen, Konflikten und Ängsten des Einzelnen hervorhebt.
- Schlüsselkonzepte: Dieses Kapitel konzentriert sich auf wichtige Konzepte der Pflegetheorie, wie die psychodynamische Pflege, die Beziehung zwischen Pflegeperson und Patient sowie die verschiedenen Rollen der Pflegenden. Es zeigt auf, wie die Theorie eine dynamische und komplexe Sichtweise auf die Pflegebeziehung und deren Einfluss auf die psychische Gesundheit des Patienten vertritt.
- Theorie und Praxis: Dieses Kapitel untersucht die praktische Anwendung der Pflegetheorie, insbesondere im Zusammenhang mit Bezugspflege und Pflegeprozess. Es zeigt, wie die Theorie die Bedeutung von Kommunikation, Empathie und Interaktion für die Gestaltung des Pflegeprozesses betont und Möglichkeiten für ein Case Management aufzeigt.
Schlüsselwörter
Psychiatrische Pflege, zwischenmenschliche Beziehungen, Pflegetheorie, Hildegard E. Peplau, Psychodynamik, Kommunikation, Empathie, Interaktion, Bezugspflege, Pflegeprozess, Case Management.
- Quote paper
- Christian Straub (Author), 2003, Die Pflegetheorie der zwischenmenschlichen Beziehungen von H.E. Peplau und ihre Bedeutung für die Pflegepraxis in der Psychiatrie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15272