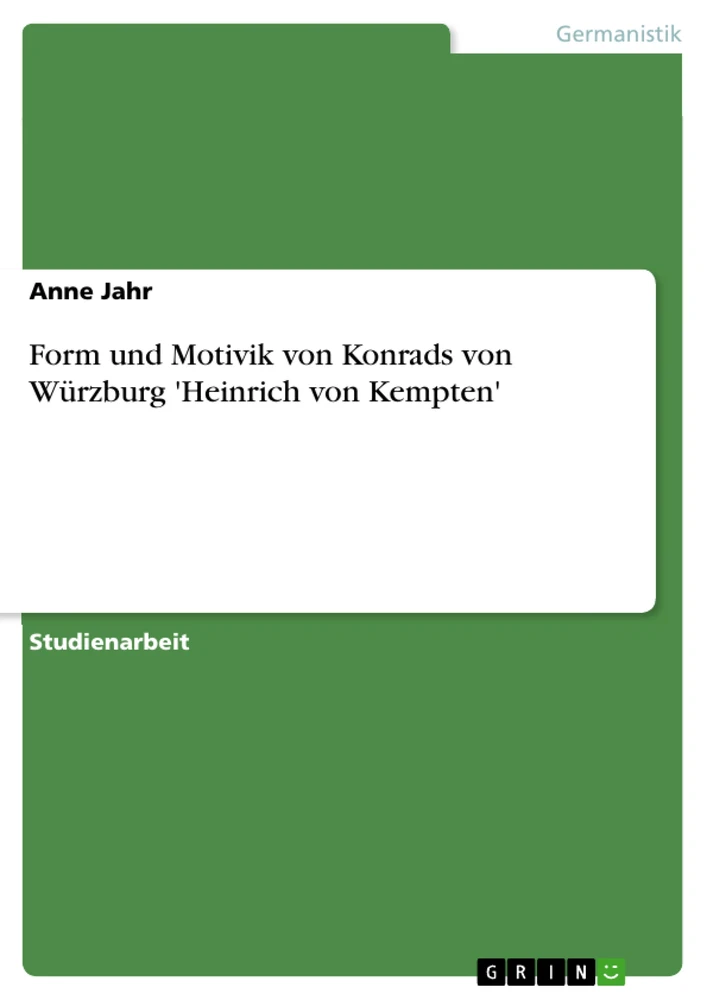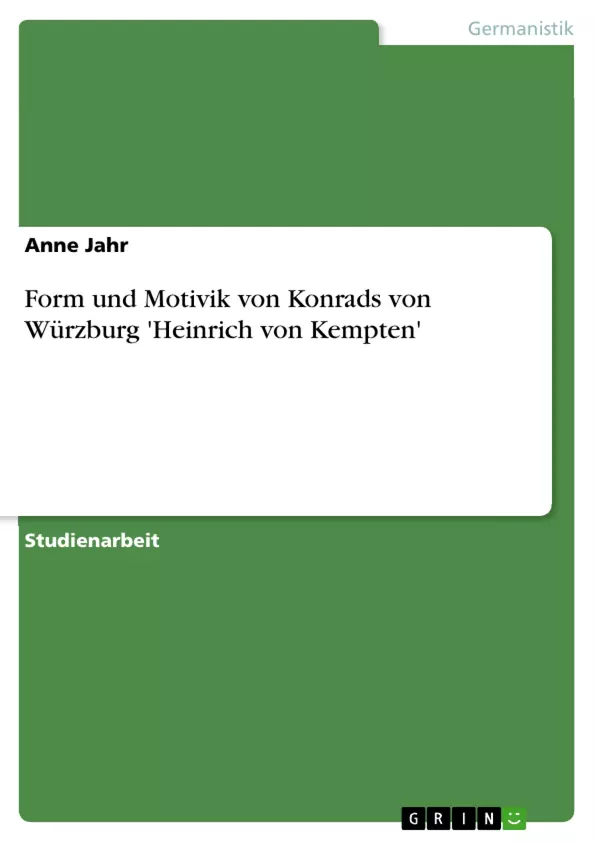Konrad von Würzburg gilt als einer der bedeutendsten und vielfältigsten Autoren der mittelalterlichen Literatur. Er wurde möglicherweise um 1230 in Würzburg geboren, was sich aus seinem Namen, den er in zahlreichen Werken genannt hat, abzuleiten ist.
Sein Leben lässt sich in drei Phasen gliedern: die Würzburger Zeit bis etwa 1257/58, die niederrheinische Zeit bis etwa 1260 und die oberrheinische Zeit bis zu seinem Tod 1287, während der er sich überwiegend in Straßburg und Basel aufhielt.
Sein frühestes datierbares Werk ist ‚Der Schwanritter’ um 1257/58. Etwa zur gleichen Zeit dürften ‚Das Turnier von Nantes’ und ‚Die Klage der Kunst’ entstanden sein. Weitere bedeutende Werke sind die Erzählungen ‚Der Welt Lohn’, ‚Das Herzmaere’ sowie
die hier zu analysierende Versnovelle von ‚Heinrich von Kempten’. Außerdem die Legenden ‚Silvester’, ‚Alexius’ und ‚Pantaleon’, das Gedicht ‚Die goldene Schmiede’, die Romane ‚Engelhard’, ‚Partonopier und Meliur’ und der unvollendete ‚Trojanerkrieg’ sowie zahlreiche Leichs, Minnelieder und Sangsprüche.
Über seine Herkunft ist wenig bekannt, jedoch ist davon auszugehen, dass er nicht adlig war. In mittelalterlichen Quellen wird er stets als magister bzw. meister bezeichnet, was ihn gleichzeitig als Berufsdichter charakterisiert. Seine Auftraggeber stammten überwiegend aus den politischen und ökonomischen Führungsschichten der damaligen Zeit, wie zum Beispiel Liutold von Roeteln, Johannes von Arguel oder Peter Schaler. Sein Tod ist laut eines Eintrags im Anniversarienbuch des Basler Münsters auf den 31. August 1287 datiert.
„Mit ‚schoenen worten’ und ‚seltsên rîm’ hat Konrad zweifellos seinen Zeitgenossen und den Nachfahren am meisten imponiert“ und bis heute „ragt [Konrad] aus der deutschen Literatur der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts hervor durch Form und Umfang
seiner Werke, aber auch durch seine poetologischen und dichtungstheoretischen Ausführungen“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formale Aspekte
- Inhalt
- Form
- Stoffgeschichtliches
- Entstehung und Überlieferung
- Quelle
- Motivik
- Rittertum
- Der rote Bart
- Nacktheit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Versnovelle „Heinrich von Kempten“ von Konrad von Würzburg, wobei der Fokus auf dem Stoff und der Motivik des Werkes liegt. Die Arbeit untersucht die Entstehung und Überlieferung des Stoffes sowie mögliche Quellen. Darüber hinaus werden wichtige Motive wie Rittertum, der rote Bart und Nacktheit in ihrer Bedeutung für das Werk herausgearbeitet.
- Analyse des Stoffes und der Motivik in Konrads „Heinrich von Kempten“
- Erforschung der Entstehung und Überlieferung des Stoffes
- Identifizierung und Analyse zentraler Motive
- Einordnung des Werkes in den literarischen Kontext des Mittelalters
- Bedeutung des Werkes für die deutsche Literaturgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Konrad von Würzburg als einen der bedeutendsten Autoren des Mittelalters vor und gibt einen Überblick über sein Schaffen. Die Arbeit fokussiert sich anschließend auf „Heinrich von Kempten“, die formale Struktur des Werkes und die Stoffgeschichte werden beleuchtet. In Kapitel 4 werden die zentralen Motive des Werkes, Rittertum, der rote Bart und Nacktheit, genauer analysiert.
Schlüsselwörter
Konrad von Würzburg, Heinrich von Kempten, Versnovelle, Stoffgeschichte, Motivik, Rittertum, der rote Bart, Nacktheit, mittelalterliche Literatur, deutsche Literaturgeschichte.
- Quote paper
- Anne Jahr (Author), 2008, Form und Motivik von Konrads von Würzburg 'Heinrich von Kempten', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152715