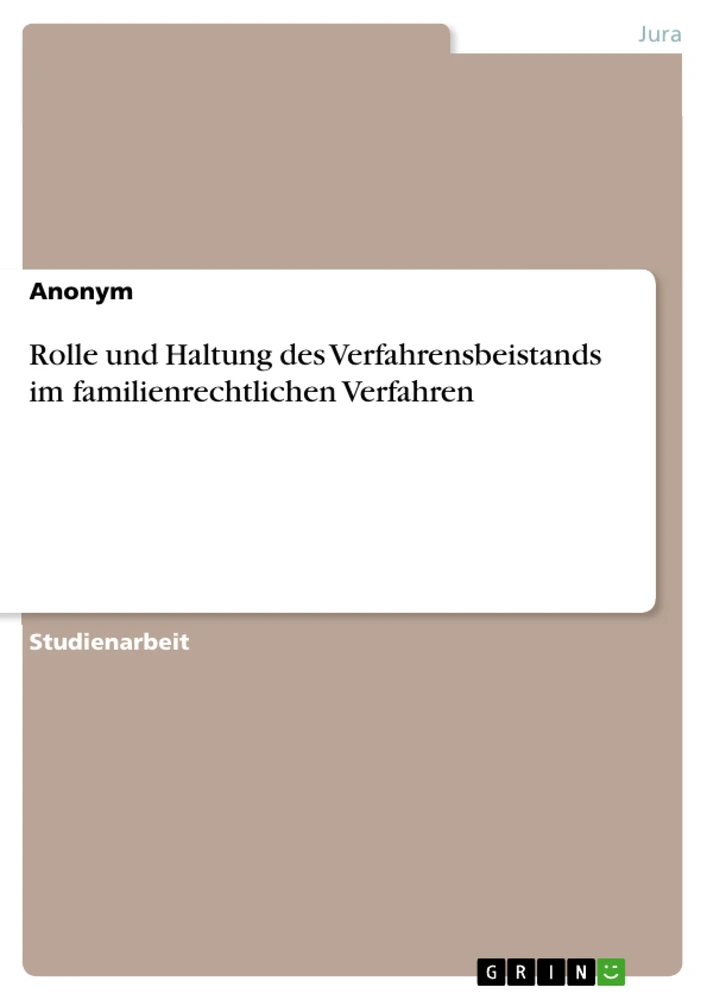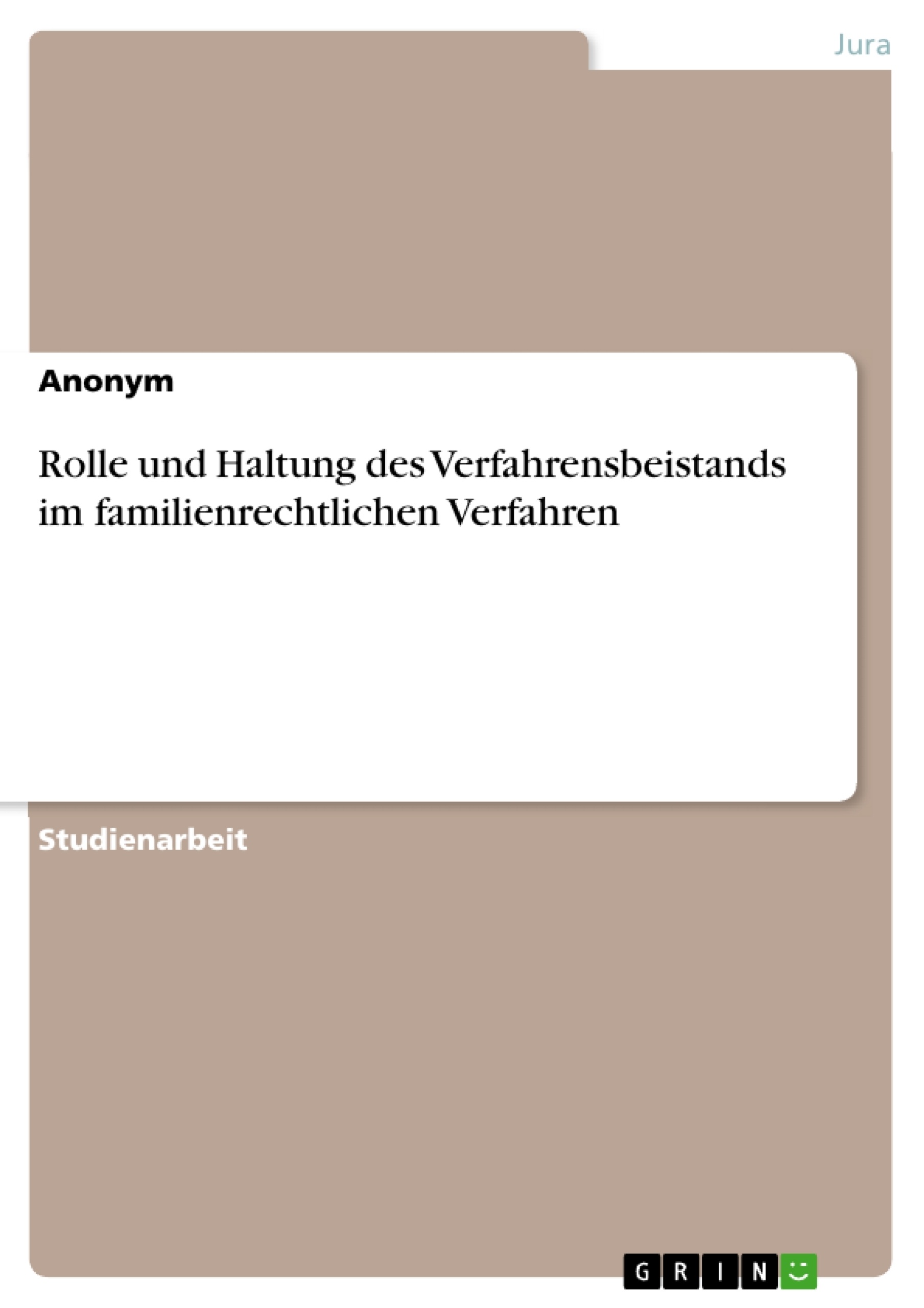Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle und Haltung des Verfahrensbeistandes im familiengerichtlichen Verfahren in Kindschaftssachen. Strukturelles Merkmal, das mich motivierte, dieses Thema zu wählen, ist der Umstand, dass mit Wirkung vom 01.09.2009 durch das Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-RG) die Funktion des Verfahrensbeistandes betreffend bis zum heutigen Tage weder seine Aufgaben, noch seine Rechte als Interessensvertreter für Kinder und Jugendliche in der breiten Öffentlichkeit hinreichend bekannt sind.
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
A. EINFÜHRUNG
B. FORMELLEVORAUSSETZUNGEN DESVERFAHRENSBEISTANDES GEMÄß FamFG
1. Historische Betrachtung und Erfordernis
2. Definition und Rechtliche Einordnung
2.1. Definition des Verfahrensbeistandes
2.1.1. Berufsbild - Voraussetzungen rechtliche Ebene
2.1.2. Berufsbild - Voraussetzungen materielle Ebene
2.2. Einordnung in die Familiengerichtsbarkeit
2.3. Einordnung in HKÜVerfahren nach IntFamRVG
2.4. Einordnung in die Programmatik der Kinder- und Jugendhilfe (KJH)
2.5. die Stellung des Verfahrensbeistandes in der Familie gemäß Art. 6 I GG
2.6. Rechte und Pflichten des Verfahrensbeistandes im Kindschaftsrecht
2.6.1. Abwehr- / Ablehnungsrechte
2.6.2. Tätigkeit auf Grundlage gesetzlicher Garantien gemäß Art. 6 I GG
2.6.2.1. Einrichtungsgarantien
2.6.2.2. Institutionsgarantien
2.6.3. Förderungsgebotvs. Benachteiligungsverbot
2.6.4. Schutz des Staates-Wächteramt
2.7. Grundrechte des Kindes im Kindschaftsrecht
C. METHODIK DER FALLANAMNESE DURCH DEN VERFAHRENSBEISTAND UND
BERICHTSANFORDERUNGEN
1. Allgemeine Methodik zur Fallanamnese
2. Prüfungsmethoden und der „Kleine“ & „Große Aufgabenkreis“
2.1. „Der Kleine Aufgabenkreis“
2.2. „DerGroße Aufgabenkreis“
2.3. Bei Verdacht einer Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB
2.4. Kindeswohlgefährdungsprüfungsverfahren nach § 1666 BGB
3. Stellung bei der Ausübung ( Neutralität )
4. Berichterstattung der gewonnenen Erkenntnisse aus der Fallanamnese
D. Zusammenfassung über das Berufsbild des Verfahrensbeistandes
Quellenverzeichnis
VORWORT
Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle und Haltung des Verfahrensbeistandes im familiengerichtlichen Verfahren in Kindschaftssachen. Strukturelles Merkmal, das mich motivierte, dieses Thema zu wählen, ist der Umstand, dass mit Wirkung vom 01.09.2009 durch das Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-RG) die Funktion des Verfahrensbeistandes betreffend bis zum heutigen Tage weder seine Aufgaben, noch seine Rechte als Interessensvertreter für Kinder und Jugendliche in der breiten Öffentlichkeit hinreichend bekannt sind.
In dieser Abhandlung wird von der Person des Verfahrensbeistandes als neutraler und männlichem Geschlecht gesprochen, wobei ich anmerken möchte, dass stets auch die weibliche Form, also die Verfahrensbeiständin, gemeint ist.
A. EINFÜHRUNG
Das Berufsbild des Verfahrensbeistandes findet sich eingangs in den §§ 158,158 a, 158 b und 158 c FamFG. Diese Vorschriften regeln allgemein die Voraussetzungen bzw. die Rahmenbedingungen für die Tätigkeit des Verfahrensbeistandes. Maßgebliche Normen für die Durchführung der Aufgaben eines Verfahrensbeistandes sind in den §§ 151 bis 168a FamFG zu finden. Diese Arbeit möchte das Berufsfeld hinsichtlich der Rolle und der Funktion eines Verfahrensbeistandes im Kindschaftsrecht als solches einer näheren Betrachtung unterziehen.
B. FORMELLE VORAUSSETZUNGEN DES VERFAHRENSBEISTANDES GEMÄß FamFG
1. Historische Betrachtung und Erfordernis
Das Berufsbild des Verfahrensbeistandes verdankt seine Existenz dem Umstand, dass der Gesetzgeber zwar den Eltern das Recht auf Hinzuziehung eines versierten Rechtsbeistandes obligatorisch eingeräumt hat, wohingegen er, der Gesetzgeber, das Recht auf eine geeignete rechtliche Interessensvertretung für die Klärungen im Familienrecht und den Sorgerechtsangelegenheiten Kindern und Jugendlichen entsprechend den Verfahrensbeistand mit der Absicht an die Seite stellte, die Rechte von Minderjährigen zu stärken. Darum wurde am 30.07.2009 das Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-RG) verabschiedet, das mit Wirkung vom 01.09.2009 in Kraft trat.1
2. Definition, Berufsbild und Rechtliche Einordnung
2.1. Definition des Verfahrensbeistandes
Der Verfahrensbeistand ist als Rechtsfigur als Anwalt des Kindes anzusehen. Er ist für das Kindeswohl, für die daraus resultierenden Rechte des Kindes und für die Kommunikation im gerichtlichen Vorverfahren und Verfahren zuständig. Dabei erforscht und arbeitet er das objektive Interesse des Kindes bezüglich des Verfahrensgegenstandes (hier das Wohl des Kindes) und das tatsächliche subjektive Interesse des Minderjährigen (gemeint ist der Wille des Kindes) heraus, um seine Erkenntnisse dem Gericht anschließend kommunizieren zu können. Der Verfahrensbeistand ist dabei nicht weisungsgebunden und ist unparteiisch tätig.2
2.1.1. Berufsbild - Voraussetzungen rechtliche Ebene
Der Verfahrensbeistand ist nach § 158 Abs. III Satz 2 FamFG als prozessbeteiligte Person in der Familiengerichtsbarkeit anzusiedeln. Ihm kommt als Organ der Rechts- und Verfahrenspflege dennoch eine ungebundene neutrale Stellung in folgenden Verfahren zu. Der Gesetzgeber hat mit dem am 01.07.2021 in Kraft getretenen Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder erweiterte zwingende Qualifikationsanforderungen für Verfahrensbeistandschaften novelliert. So muss der Verfahrensbeistand nunmehr eine BVEB-Zerfizierung verpflichtend für ein Tätigwerden vorweisen können, da diese von den Amts- und Oberlandesgerichten gefordert werden.
2.1.2. Berufsbild - Voraussetzungen materielle Ebene (Eignung gemäß § 158a FamFG)
Für die Ausübung der Funktion bringt der Verfahrensbestand wesentliche Grundkenntnisse in folgenden Bereichen mit:
- Grundkenntnisse des Kindschaftsrechts
- Kenntnisse das Familienrecht betreffend
- Verfahrensrecht in Kindschaftssachen
- Kenntnisse aus dem Kinder- und Jugendhilferecht
- Kenntnisse der Entwicklungspsychologie des Kindes
- Kompetenzen der Gesprächsführung mit Kindern
Hat der Verfahrensbeistand keine sozialpädagogische bzw. keine pädagogische, psychologische oder juristische Berufsqualifikation einzubringen, so ist eine weitere fachliche Aneignung von Kompetenzen im Rahmen einer BVBG-Zusatzqualifikation erforderlich.
2.2. Einordnung in die Familiengerichtsbarkeit
Der Verfahrensbeistand wird in Verfahren, in denen es um die freiheitsentziehende Unterbringung von Minderjährigen geht, bei zu regelnden Pflegschaftsangelegenheiten, bei der Klärung von Vormundschaften, in Angelegenheiten, die die Herausgabe eines Minderjährigen zum Gegenstand haben (z. B. Zwangsvollstreckungen, auch im HKÜ-Verfahren), aber auch in Angelegenheiten der elterlichen Sorge und des Umgangsrechtes der Eltern mit den Kindern, hinzugezogen.
2.3. Einordnung in HKÜ-Verfahren nach IntFamRVG
In den Fällen, die das Haager Kinderschutzübereinkommen und das Haager Kindesentführungsübereinkommen und die entsprechenden Umgangsverfahren nach Brüssel II-a und Il-b betreffen, ist die Bestellung von Verfahrensbeiständen nicht vorgeschrieben. Dieser Rechtskreis, für den sich weder aus dem § 158 FamFG (bisher § 50 FGG), noch aus dem HKÜ selbst eine Verpflichtung zur Bestellung eines Verfahrensbeistandes ergibt, dürfte damit regelungsbedürftig sein. Dafür spricht auch, dass diese Rechtsfälle quasi in ein eigenständiges weitläufiges rechtlich komplexes Fachgebiet involviert sein dürften. Für derlei geartete Fälle sollte der Gesetzgeber die Tätigkeitsräume für speziell ausgebildete Verfahrensbeistände rechtlich zementieren und organisieren.3
2.4. Einordnung in die Programmatik der Kinder- und Jugendhilfe (KJH)
Mit der Anknüpfung an die Funktion und den Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe stellt der Verfahrensbeistand das unabhängige Bindeglied zwischen der Justiz, die ihn bestellt, und dem Jugendamt dar. Jener ist damit bei allen Sorgerechts- und Umgangsverfahren gesetzlich zur Mitwirkung verpflichtet. Das Jugendamt entsendet einen Vertreter bzw. eine Vertreterin des zuständigen Allgemeinen Sozialen Dienstes für einen Austausch vor dem Verhandlungstermin zum Verfahrensbeistand und kommt damit einer gesetzlichen Mitwirkungspflicht nach.4
2.5. die Stellung des Verfahrensbeistandes in der Familie gemäß Grundgesetz nach Art. 61GG
Indem der Verfahrensbeistand mit Bestellung durch die zuständige Rechtspflegestelle das Bindeglied zwischen dem Gericht, den Eltern eines Kindes und den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe darstellt und sich dort und zwischen den Stellen bewegen kann, wird dessen Stellung deutlich. So kann sich der Verfahrensbeistand ein weitaus umfangreicheres Bild von einer Falllage in einer Familie machen, als es das Jugendamt oder das Gericht es im familienrechtlichen Verfahren könnten.
2.6. die Rechte und Pflichten des Verfahrensbeistandes im Kindschaftsrecht
Wo Eltern eigene Rechtsbeistände im familienrechtlichen Verfahren an ihrer Seite haben können, so vertritt verpflichtend der Verfahrensbeistand die Interessen und Rechte des Kindes vor Gericht. Dem Verfahrensbeistand kommt somit auch eine besondere rechtliche Bedeutung zu, da er den komplexen Auftrag des Gesetzgebers hat, dem Kind als ein ihm schutzbefohlenes eine Stimme vor Gericht zu geben und vor allem, zu dessen Wohl zu agieren. Die Schriftsätze von Verfahrensbeiständen können vor Gericht eine hohe Entscheidungsrelevanz auf das gerichtliche Verfahren bewirken, dadiese nahezu als Minigutachten bewertet werden könnten. Dieser Umstand lässt auf die Rechte des Verfahrensbeistandes im gerichtlichen Verfahren schließen.
2.6.1. Abwehr- / Ablehnungsrechte
Bereits das Prozedere vor der Annahme eines Auftrages durch den Verfahrensbeistand zeigt, dass der Verfahrensbeistand gewisse Freiheiten in der Ausübung seiner Tätigkeit inne hat. Dergestalt wird ihm die Möglichkeit eingeräumt, Aufträge vom Gericht abzulehnen, wenn er bspw. keine freien Kapazitäten hat oder ihm die Familie als Verfahrensbeteiligte privat bekannt ist. Wenngleich es dem Verfahrensbeistand frei steht, über die Annahme oder die Ablehnung eines Auftrages zu entscheiden, so steht jedoch Eltern die Ablehnung der Bestellung des Verfahrensbeistandes als Rechtsmittel gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 FamFG sowie § 7 Abs. 5 und 6 FamFG nur in Ausnahmefällen, in denen die Abbestellung geboten ist, zur Verfügung.5 Das Gesetz sieht die Ablehnung des Verfahrensbeistandes dennoch grundsätzlich nicht vor, weil jenem die Wahrnehmung der Interessen des Kindes obliegt.
2.6.2. Tätigkeit auf Grundlage gesetzlicher Garantien gemäß Art. 6 I GG
2.6.2.1. Einrichtungsgarantien
Das Wirken des Verfahrensbeistandes lässt sich im Interesse des schutzbefohlenen Kindes an eine Einrichtungsgarantie des Gesetzgebers nach Art. 6 I GG knüpfen, wonach seine Tätigkeit nicht einfach hinweg gedacht werden kann, ohne dass das Interesse und Wohl des Kindes gemäß Art. 6 I GG verletzt werden könnte, da dem Verfahrensbestand die Sorge zukommt, dass die Wahrung und die Umsetzung der Interessen des minderjährigen Mandanten gewährleistet werden kann. Hier steht dem Verfahrensbeistand eine Vielfalt von Instrumenten zur Verfügung, u. a. das Stellen eigener Anträge und die Einreichung von Beschwerden das Wohl des von ihm vertretenen Kindes betreffend.
2.6.2.2. Institutionsgarantien
Institutionsgarantien sind auf den subjektiv-grundrechtlichen Schutz der Menschenwürde gerichtet, z. B. die Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit betreffend. Der Gesetzgeber stattet den Verfahrensbeistand zur Wahrung des rechtstaatlichen Verfahrens im Familienrecht mit großer Unabhängigkeit aus, um dessen Unvoreingenommenheit und Integrität bei der Ausübung seiner Tätigkeit zu wahren. So gewährleistet er dem Verfahrensbeistand das Recht, dem Gericht zu widersprechen, wenn eine Entscheidung nicht dem Wohle und den Interessen des Kindes ausreichend Rechnung trägt. Die Unabhängigkeit, die auch Unparteilichkeit umfasst, erlaubt es dem Verfahrensbeistand auch, Empfehlungen des Gerichtes nicht nur zu widersprechen, sondern auch solche nicht zu befolgen.
2.6.3. Förderungsgebotvs. Benachteiligungsverbot
Aufgrund der Einrichtungsgarantie des Gesetzgebers nach Art. 6 GG unterliegt das Wirken des Verfahrensbeistandes auch einem Schutz- und Förderungsgebot der Familie als Grundrecht.6 Aus diesem Grundsatz heraus ergibt sich für die Tätigkeit des Verfahrensbeistandes ein Schädigungsverbot unter der Maßgabe des gesetzlichen Schutzgebotes der Familie gegenüber. Dabei ist das Schutzgebot, das nach Irene Gerlachs Anamnese als Abwehrrecht der Familie gegen Eingriffe durch die Kinder- und Jugendhilfe anzusehen ist, auch als Förderungsgebot zum Schutz der Familie analog anzusehen und entsprechend auch als Benachteiligungsverbot. Der Verfahrensbeistand ist demnach besonders gefordert, da die Beurteilung seiner Arbeit einen gewichtigen Einfluss auf den Ausgang eines familienrechtlichen Verfahrens hat und somit maßgeblich die Zukunft des Kindes beeinflussen wird.
In der Praxis begegnet dem Verfahrensbeistand auch die Falllage, wonach das Interesse des Kindes, d. h. Kindeswohl, mit dem Willen des Kindes kausal auseinander fällt. So kann es vorkommen, dass der Verfahrensbeistand dem Gericht eine Empfehlung zukommen lassen muss, die dem Kindeswillen nicht ausreichend Rechnung tragen kann, jedoch im Ganzen dem Wohl des Kindes dienlich ist. So kann schnell der Vorwurf einer Benachteiligung des Kindesinteresses in den Raum gestellt werden, wobei der Verfahrensbeistand besonders achtsam vortragen sollte, worauf sich seine Empfehlung von den Umständen her stützt.
2.6.4. Schutz des Staates - Wächteramt
In den Fällen, in denen der Verfahrensbeistand sich im häuslichen Umfeld, i. d. R. der elterliche Haushalt des zu vertretenen Kindes oder in den Geprächen mit den Beteiligten einen umfangreichen Überblick über die Lebensumstände der Haushaltmitglieder und über Informationen weiterer Bezugspersonen, z. B. Schule, Hort oder Kita, verschafft hat, und er eine Kindeswohlgefährdungslage vermutet, ist er zum Schutz des Kindes zur Meldung beim Jugendamt, dem Wächteramt, oder dem Gericht verpflichtet. Dies könnte der Fall sein, wenn zum Beispiel sexueller Missbrauch, anderweitige psychische oder körperliche Gewalt oder Vernachlässigung des Kindes von ihm bemerkt werden. In eigenem Ermessen kann der Verfahrensbeistand ein Kindeswohlgefährdungsprüfungsverfahren beim Familiengericht nach § 1666 BGB anregen, um seinem Schutzauftrag gerecht zu werden.
2.7. Grundrechte des Kindes im Kindschaftsrecht
Im Jahr 1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention7 der Vereinigten Nationen als Kinderrechtskatalog beschlossen. In dieser wurden für Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, unabhängig ihres Aufenthaltsortes, ihrer Herkunft, ihres Geschlechtes, unveräußerliche Rechte für ihren Schutz, ihre Versorgung und gesunde Entwicklung festgelegt, die von jedem Erwachsenen über 18 Jahre eingehalten werden müssen.
Zu diesen Rechten gehören vornehmlich:
- das Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung
- das Recht auf Schutz vor Gewalt, Ausbeutung und Diskriminierung
- das Recht auf Bildung und Meinungsäußerung
- das Recht auf Freizeit
- das Recht auf Umgang mit den Eltern und Geschwistern
- das Recht auf Fürsorge und daraus resultierend auf Versorgung mit angemessener Unterkunft, mit Nahrungsmitteln und Kleidung, Zugang zu medizinischer Behandlung
- das Recht auf rechtliches Gehör
- das Recht auf Schutz bei bewaffneten Konflikten nach dem humanitären Völkerrecht
Die Umsetzung der Kinderrechte aus der UN-Kinderrechtskonvention ist Aufgabe der Eltern des Kindes und kommen sie dem nicht nach, so wachen und organisieren die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie die Familien- und Oberlandesgerichte die Einhaltung.
Kinder sind eigenständige Grundrechtsträger:innen, auch wenn ihre Rechte nicht explizit als Kinderrechte im Grundgesetz verankert worden sind. Vielmehr finden sich die Kinderrechte auch im Art. 1-7 und in Art. 16a GG wieder, da auch Kinder vom grundrechtlichen Rechtsschutzgedanken des Gesetzgebers angesprochen und erfasst sind.
So könnte sich u. a. auch erklären, dass die Rechte des Kindes aus der Abstammung mit Datum vom 01.07.1998 im Abstammungsrecht mit dem Kindschaftsrechtsreformgesetz neu geregelt wurde. Bei der rechtlichen Abstammung geht es um den Verwandtenkreis. Dieser wurde in Verbindung mit § 1589 BGB im Kindschaftsrechtsreformgesetz neu definiert. Die Kenntnis über die Herkunft und Abstammung ist Recht eines jeden Kindes. Deswegen hat der Gesetzgeber dem Kind das Recht auf Feststellung der biologischen Eltern, hier der leiblichen Mutter nach § 1591 BGB und i. V. m. § 1592 BGB des Vaters und die daraus resultierende Elternschaft gemäß § 1600 d BGB, eingeräumt.
C. METHODIK DER FALLANAMNESE DURCH DEN VERFAHRENSBEISTAND UND BERICHTSANFORDERUNGEN
1. Allgemeine Methodik zur Fallanamnese
Der Verfahrensbeistand kontaktiert für ein Gespräch postalisch die Eltern und ab dem 14. Lebensjahr auch das betroffene Kind bzw. die betreffenden Kinder.
In seine Arbeit, vor allem bei Gesprächen mit Eltern, Kindern und mit weiteren Bezugspersonen sollte der Verfahrensbeistand eine objektive und neutrale Haltung und Betrachtung den Beteiligten gegenüber einnehmen. Das bedeutet, dass er nichtvorurteilsbehaftet agieren darf.
Gespräche mit dem Kind und weiteren Personen dürfen nur nach Erlaubnis der Sorgeberechtigten erfolgen. Bei Gesprächen mit Drittpersonen, z.B Schule, Lehrer usw., benötigt der Verfahrensbeistand eine Schweigepflichtsentbindung der sorgeberechtigten Elternteile.
Im Gerichtsverfahren ist er eine unabhängige Person. Der Blickpunkt ist nach rechtlichen Vorgaben stets das Kindeswohl, dessen Interessen gewahrt werden sollen. Das Kind muss in altersgerechter Weise über seine Rechte beim Erstgespräch durch den Verfahrensbeistand, dessen Aufgaben und über seine Mitwirkung als Anwalt des Kindes unterrichtet werden. Diese Handhabung ist notwendig, um eine Entscheidung im Sinne des Kindes generell treffen zu können.
Mit vertraulichen Informationen sollte sehr sorgfältig und achtsam umgegangen werden. Im Verlauf der Fallarbeit wird sich dieses Vorgehen im Umgang mit Daten als sehr hilfreich und nützlich erweisen können, denn sollten widersprüchliche bzw. fragwürdige Aussagen gegeneinander abgewogen werden müssen, so kann der Wahrheitsgehalt und seine Tragweite gezielter ermittelt werden, z. B: die Anwendung von Manipulationstechniken seitens der Elternteile, die den autonomen Kindeswillen in einen Loyalitätskonflikt steuern könnten oder auch angewandte Entfremdungstaktiken am Kind, insbesondere dem Umgangsboykott.
2. Prüfungsmethoden und der „Kleine“ & „Große Aufgabenkreis“
Die allgemeinen Prüfungsmethoden eines Verfahrensbeistandes beziehen sich auf Gespräche mit dem betreffenden Kind, um dessen Bedürfnisse und Wünsche zu erforschen. Auch gehört das zu beobachtende Verhalten und die psychische sowie die emotionale Verfassung des Kindes während des Gesprächs dazu. In Anknüpfung an die Prüfungsmethoden unterscheidet man zwischen dem .Kleinen Aufgabenkreis‘ und dem .Großen Aufgabenkreis‘. Es kommt bei der Wahl der Prüfungsmethoden oft darauf an, welchen Aufgabenkreis der Verfahrensbeistand durch das Gericht inne hat.
2.1. „Der Kleine Aufgabenkreis“
Darunter ist zu verstehen, dass mit der Bestellung des Verfahrensbeistandes durch das Gericht nur der mindestens erforderliche Prüfbedarf gewährleistet wird. Dazu zählen beispielsweise Gespräche zwischen dem Verfahrensbeistand, den Eltern und dem Kind sowie den Geschwisterkindern. Mit dem Kleinen Aufgabenkreis wird lediglich der direkte Familienkreis angesprochen.
2.2. „Der Große Aufgabenkreis“
Der sogenannte „Große Aufgabenkreis“ ist der anspruchsvollere. Hier stehen dem Verfahrensbeistand umfangreichere Berechtigungen und entsprechende gewichtigere Verantwortlichkeiten zur Informationsgewinnung in Angelegenheiten des familienrechtlichen Verfahrens zur Verfügung. Dementsprechend ist auch das Prüfhabitat weitreichender als im Kleinen Aufgabenkreis.
Neben den Gesprächen mit dem engeren Familienkreis des Kindes, ist der Verfahrensbeistand berechtigt, diese auch mit Drittpersonen, z. B. der Schule, mit Lehrern, Therapeuten, Erziehern, Ärzten usw. zu führen. Dazu bedarf es jedoch einer Schweigepflichtentbindung der sorgeberechtigten Elternteile.
In Gesprächen mit den Eltern und Drittpersonen erforscht der Verfahrensbeistand die familiäre Situation des Kindes, um Lösungen zu erarbeiten z.B bei Problemen, die zu Belastung und Konflikte führen.
Anmerkung zu 2.1. und 2.2.:
Allgemein gesehen sind diese Prüfungsmethoden wichtig und notwendig, damit sich der Verfahrensbeistand ein umfangreiches Bild der familiären Situation der Familie verschaffen kann, um das Kind im familienrechtlichen Verfahren ordnungsgemäß vertreten zu können.
2.3 Bei Verdacht einer Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB
Der Verfahrensbeistand muss bei Verdacht einer Kindeswohlgefährdung im Interesse, zum Wohl und zum Schutz des Kindes agieren. Er hat die Pflicht, alle möglichen Maßnahmen nach §1666 BGB einzuleiten, die erforderlich sind, um das Kind vor weiterer Gefährdungslage zu schützen. Er muss unverzüglich Meldung des Verdachts an das zuständige Jugendamt, den ASD oder anderweitige zuständige Behörden sowie an das Familiengericht tätigen.
Auch in Absprache mit den Eltern kann der Verfahrensbeistand mit anderweitigen Beteiligten geeignete Maßnahmen einleiten, um das Kind zu schützen, wie z.B. die Einleitung von erforderlichen Schutzmaßnahmen oder die Unterbringung des Kindes in einer sicheren Umgebung nach § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung).
Hierzu muss der Verfahrensbeistand mit anderen beteiligten Fachkräften zusammenarbeiten, um das Wohl des Kindes zu schützen. Er oder sie muss dabei auch auf mögliche Konflikte und Belastungen für das Kind hinweisen und geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Kind zu schützen.
2.4 Kindeswohlgefährdungsprüfungsverfahren nach § 1666 BGB
Bei einem Verdacht oder der Feststellung einer Kindeswohlgefährdung hat der Verfahrensbeistand nicht nur die Pflicht, wie oben in Punkt C.2.3. dargestellt, sondern auch bei Gericht einen Antrag nach §1666 BGB und infolge ein Kindeswohlgefährdungsprüfungsverfahren anzuregen bzw. einzuleiten.
Auch in einem solchen Verfahren hat er die Aufgabe, das Kind anzuhören, dessen Interessen und Rechte zu wahren, die Wünsche und Bedürfnisse zu ermitteln und das Kind im Verfahren zu vertreten.
Ebenfalls hier muss das Kind vor Gefahrensituationen geschützt werden, indem effektive Lösungen und Maßnahmen zum Wohl und Schutz des Kindes ausgearbeitet und vor Gericht in der Verhandlung angeregt werden.
3. Stellung bei der Ausübung (Neutralität)
In Deutschland regelt das Familienrecht die Bestellung und die Aufgaben des Verfahrensbeistandes in § 158 FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit). Dieser Paragraph legt fest, dass das Gericht zur Wahrung des Kindeswohls einen Verfahrensbeistand bestellen kann, der das Kind im Verfahren vertritt und seine Interessen wahrnimmt. Es werden auch die Aufgaben des Verfahrensbeistandes beschrieben, die darauf abzielen, die Wünsche und Bedürfnisse des Kindes zu ermitteln und im Verfahren zu vertreten.
In Bezug auf die Neutralität des Verfahrensbeistandes ist es wichtig zu beachten, dass das FamFG explizit darauf abzielt, das Kindeswohl zu schützen und die Interessen des Kindes zu vertreten. Obwohl der § 158 FamFG nicht explizit die Neutralität des Verfahrensbeistandes erwähnt, implizieren die Bestellung und die Aufgaben des Verfahrensbeistandes, dass er oder sie unabhängig und neutral handeln muss, um das Wohl des Kindes zu gewährleisten.
Der Verfahrensbeistand ist unabhängig und hat in seiner Funktion eine überaus verantwortungsvolle Rolle einzunehmen. Entscheidungen sollten immer zum Besten des Kindes getroffen werden und er muss in der Lage sein, sich durch aktives Zuhören in das Kind hinein versetzen zu können. Das Berufsbild des Verfahrensbeistandes erfordert eine hohe Sensibilität im Umgang mit Kindern, explizit mit Kleinkindern, und Familien sowie eine fundierte Kenntnis des Familienrechts und der psychosozialen Arbeit.
Ein Verfahrensbeistand sollte neutral sein und sich weder von der Sympathie zu den Beteiligten, z. B. den Vertretern von Jugendämtern oder dem ASD, den Eltern bzw. den Elternteilen, noch von anderweitigen Beteiligten beeinflussen lassen. Auch sollte er in keinerlei beruflichen, privaten oder sonstigen persönlichen Verbindungen mit dem Kind, dessen Eltern und anderen Beteiligten im persönlichen Privatbereich seines Lebens verstrickt sein, da er sonst keine neutrale Stellung beziehen kann und somit befangen wäre.
In vorgenannten Falllagen, wird ein fachlich kompetenter Verfahrensbeistand von dem erwähnten Personenkreis Abstand nehmen, indem er den Fall ablehnt. Damit stellt er sicher, dass die Interessen des Kindes in geeigneter neutraler Weise vertreten werden können.
Andererseits kommt es in der Praxis häufig vor, dass Verfahrensbeistände die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Kinder-und Jugendhilfe dahingehend verstehen, dass sie sich mit diesen Einrichtungen, entgegen der tatsächlichen Interessen und Wünsche des Kindes, „einig werden müssten“. Dies kann dazu führen, dass der Verfahrensbeistand eine parteiliche Positionierung einnimmt, weil er sich mutmaßlich ungeprüft auf die Seite der Einrichtungen oder der Gerichte schlägt, obwohl dies für das Kind teils massive Nachteile für den weiteren Lebensweg langfristig zur Folge hat bzw. haben kann.8 Gerät ein Verfahrensbeistand in diese Situation, so ist er als Anwalt des Kindes gemäß § 158 a FamFG fachlich ungeeignet.
Nachteilig und daher aus Sicht der Verfasserin dieser Arbeit gesetzlich regelungsbedürftig ist die Position des Verfahrensbeistandes in Fällen, wenn er in Ausübung seiner Funktion als Anwalt des Kindes eine unabhängige Position wahrt, wie in § 158a FamFG vorgegeben, und den Auffassungen und Lösungsvorschlägen der anderen Verfahrensbeteiligten nicht folgt, weil er eine zu einer anderen fachlichen Einschätzung gelangte. Häufig ist in der Praxis diese durchaus kontroverse Fallkonstellation anzutreffen, weil der Verfahrensbeistand den autonomen Kindeswillen und dessen rechtliches Interesse anders einschätzt, als die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und das Gericht selbst. Als Beispiele könnten Fragen zum Aufenthaltsort, Formen des Wechselmodells, die Rückführung und die Umgangsregelungen für das Kind in Betracht kommen. Kommuniziert der Verfahrensbeistand seine unabhängige eigene fachliche Expertise zum Fall, so könnte sich dies ihm gegenüber in einer Ausgrenzung durch das Gericht für Folgeaufträge niederschlagen, sofern das Gericht seiner Auffassung nicht folgt. Es handelt sich bei dieser Symptomatik um eine häufiger auftretende Problematik, als man auch in der Fachwelt annehmen möchte. Insofern gelangt die Unabhängigkeit des Verfahrensbeistandes an ihre Grenzen, weshalb sich die Frage an den Gesetzgeber stellt, wie diese Praxis rechtlich neu geprüft und nachgeregelt werden könnte, um eine Abhängigkeit des Verfahrensbeistandes vom Gerichtsermessen zu vermeiden.
4. Berichterstattung der gewonnenen Erkenntnisse aus der Fallanamnese
Die Stellungnahme vom Verfahrensbeistand an das Familiengericht müssen eine klare Darstellung von relevanten fallbezogenen Informationen mit objektiver Beschreibung des Falles, nebst Empfehlungen, beinhalten.
Jeder Fall sollte detailliert erfasst werden. Unter anderem sollten die Beziehungen und Bindungen zwischen Eltern(teilen) und Kindern festgestellt und der Wille als auch das Kindeswohl erfasst werden. Dabei müssen chronologische und andere relevante Ereignisse, einschließlich der Hintergrundinformationen notiert und entsprechende Nachweise beigefügt werden.
Nach einer Gerichtsverhandlung berichtet der Verfahrensbeistand dem Kind bzw. den Kindern über die Entscheidung des Richters im familienrechtlichen Verfahren.
D. Zusammenfassung über das Berufsbild des Verfahrensbeistandes
Ein Verfahrensbeistand ist eine Person, die im Rahmen von familiengerichtlichen Verfahren eingesetzt wird, um das Kindeswohl zu schützen und die Interessen des Kindes zu vertreten. Der Verfahrensbeistand vertritt das Kind unabhängig von den Eltern und anderen Beteiligten und hat die Aufgabe, das Kind zu unterstützen, seine Wünsche und Bedürfnisse zu ermitteln und diese im Verfahren angemessen zu berücksichtigen. Der Verfahrensbeistand arbeitet mit dem Gericht, den Eltern und anderen Beteiligten zusammen, um eine für das Kind bestmögliche Lösung zu finden. Dazu gehört auch die Anregung von Gutachten, die Teilnahme an Verhandlungen und Kindesanhörungen. Er ist auch bei der Entscheidungsfindung vor Gerichten zum Wohle des Kindes behilflich.
Bemerkenswerterweise ist der Beruf des Verfahrensbeistandes als Anwalt des Kindes in der Gesellschaft noch relativ unbekannt. Dies zeigen Reaktionen immer wieder anschaulich, z. B.: die von den Eltern, welche von einem Verfahrensbeistand oft noch nie erfahren haben.
Dem Verfahrensbeistand kommt damit eine sehr gewichtige Verantwortung für das Wohl von Minderjährigen, die im rechtlichen Verfahren beteiligt sind, zu, da er mit der Würdigung der Lebensumstände des Kindes und dessen Familie betraut und Einblick in einen sehr persönlichen und sensiblen Lebensbereich erhält. Dies ist der Fall, wenn der Verfahrensbeistand seinen Fokus in den Mittelpunkt der Interessen, der Bedürfnisse und Wünsche des Kindes stellt. Er muss in der Lage sein, aufgrund seiner fachlichen Kompetenzen das Kind in allen Belangen und dem Verlauf des Verfahrens zu vertreten. In der Praxis bedeutet dies, dass der Verfahrensbeistand das Kind mit seiner individuellen Persönlichkeit zunächst umfassend wahrnimmt, da er die Person ist, die den Wunsch und den Willen des Kindes als dessen anwaltlicher Vertreter vor dem Gericht und den Verfahrensbeteiligten kundzugeben hat. Indem er seine Aufgabe wahrnimmt, darf er nicht im eigenen Interesse handeln. In eigenem Ermessen darf der Verfahrensbeistand nur dann handeln, wenn er eine Kindeswohlgefährdungslage feststellt, wobei es dabei der Fall sein könnte, dass das Schutzinteresse des Kindes, das der Verfahrensbeistand sieht, mit dem Wunsch des gefährdeten Kindes auseinanderfällt, z. B. in Fällen, in denen harte Verdachtsmomente für ausgeübte Gewalt (einschließlich der sexuelle Missbrauch, sexualisierte Gewalt und Stockholm-Syndrom) am Kind vorliegen oder Anlass geben, vermutet zu werden. In Fällen von Kindeswohlgefährdungen darf der Verfahrensbeistand auch Gutachten beim Gericht anregen. Zusammenfassend festgehalten bedeutet dies, dass der Verfahrensbeistand verpflichtet ist, für die bestmögliche Entwicklung und das Wohlergehen des ihm anvertrauten Kindes neutral und unabhängig einzutreten.
Da der Verfahrensbeistand, außer mit dem Gericht und der Familie des Kindes, auch mit anderen Verfahrensbeteiligten zusammenarbeiten muss, z. B. mit dem Jugendamt, dem ASD, Erziehungsbeiständen, der Familienhilfe, der Familiengerichtshilfe und ggf. mit Familiengutachtern, könnte es geschehen, ist er in einer Position steuert, in der er zum Nachteil des Kindes parteilich werden könnte. Dies muss er unbedingt vermeiden.
Insgesamt ist die würdigende Verantwortung des Verfahrensbeistandes für das Wohl von Minderjährigen von großer Bedeutung, dasie sicherstellt, dass die Interessen und Bedürfnisse des Kindes angemessen berücksichtigt werden und es eine angemessene Vertretung und Unterstützung erhält.
Interessant ist die Betrachtung der Anzahl der jährlichen Verfahren und die Tatsache, dass der Verfahrensbeistand in der Gesellschaft noch nicht in der Sichtbarkeit angelangt ist, die ihm zukommen müsste.
Der Verfahrensbeistand hat einen Großteil der Datenbeschaffung und der Verarbeitung der gewonnenen Informationen zu bewältigen. Aus finanzieller Sicht ist der Beruf des Verfahrensbeistandes eher unattraktiv, weil, gemessen am Arbeitsaufwand, keine angemessene Vergütung an ihn gezahlt wird.
Wer als Verfahrensbeistand arbeitet, macht dies vor allem wahrscheinlich aus Verbundenheit, aus Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein gegenüber Kindern.
Quellenverzeichnis
Sonstige Quellen:
Eigene Kursaufzeichnungen
[...]
1 vgl.. BGBl. I S. 2449 vom 30.07.2009 Seite 3
2 siehe dazu Kapitel C Punkt 2. - Stellung bei der Ausübung, S. 11 Seite 4
3 Haufe, Deutsches Anwalt Office Premium, Völker & Clausius, §11 Grenzüberschreitende Sorge-, Umgangs- und Kindesent / 9. - Verfahrensbeistand Seite 5
4 Dipl. Psych. Ingrid Ortland, Hamburg 2018, Familienrechtversus Kindeswohl, Kapitel: Verfahrensbeistand, S. 44 Seite 5
5 Splitt, FamRB 2020, 331, Beitrag „Die Aufhebung der Bestellung zum Verfahrensbeistand “, https://www.famrb.de/63485.htm Seite 6
6 vgl. Irene Gerlach, 2015, Beitrag: „Familie, Familienrecht und Reformen“, Bundeszentrale für Politische Bildung - online, https://www.bpb.de/themen/familie/familienpolitik/198764/familie- familienrecht-und-reformen/ Seite 7
7 Unicef, November 2023, „UN-Kinderrechtskonvention“, https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention Seite 8
8 vgl. Ingrid Ortland, 2018, Familienrechtversus Kindeswohl, Kapitel: ,Verfahrensbeistand‘, S. 44 Seite 12
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2024, Rolle und Haltung des Verfahrensbeistands im familienrechtlichen Verfahren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1525479