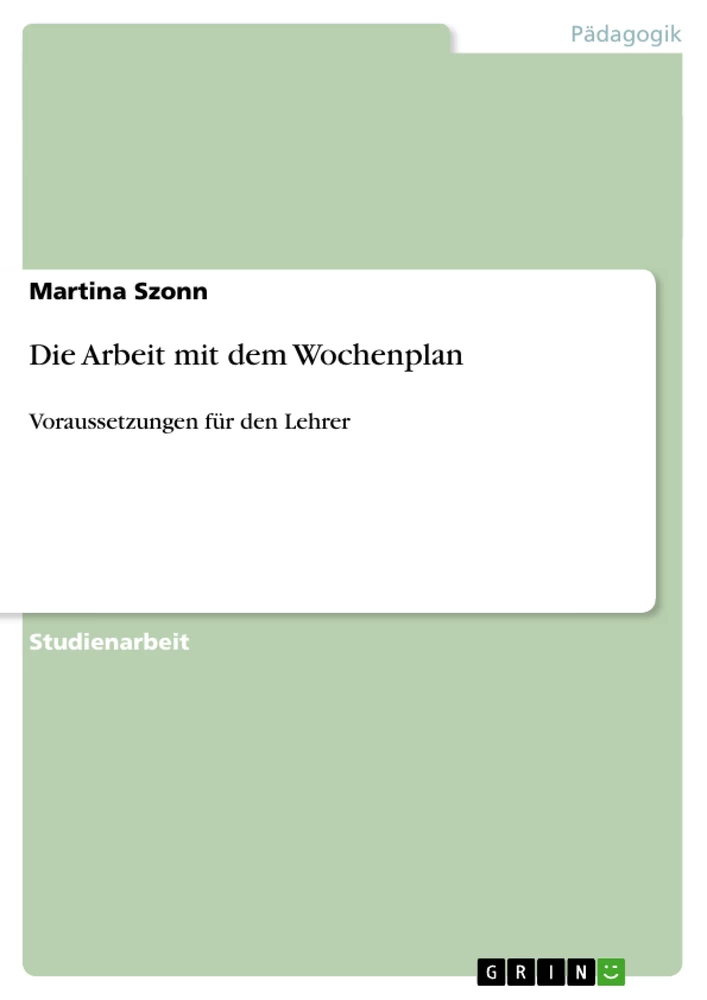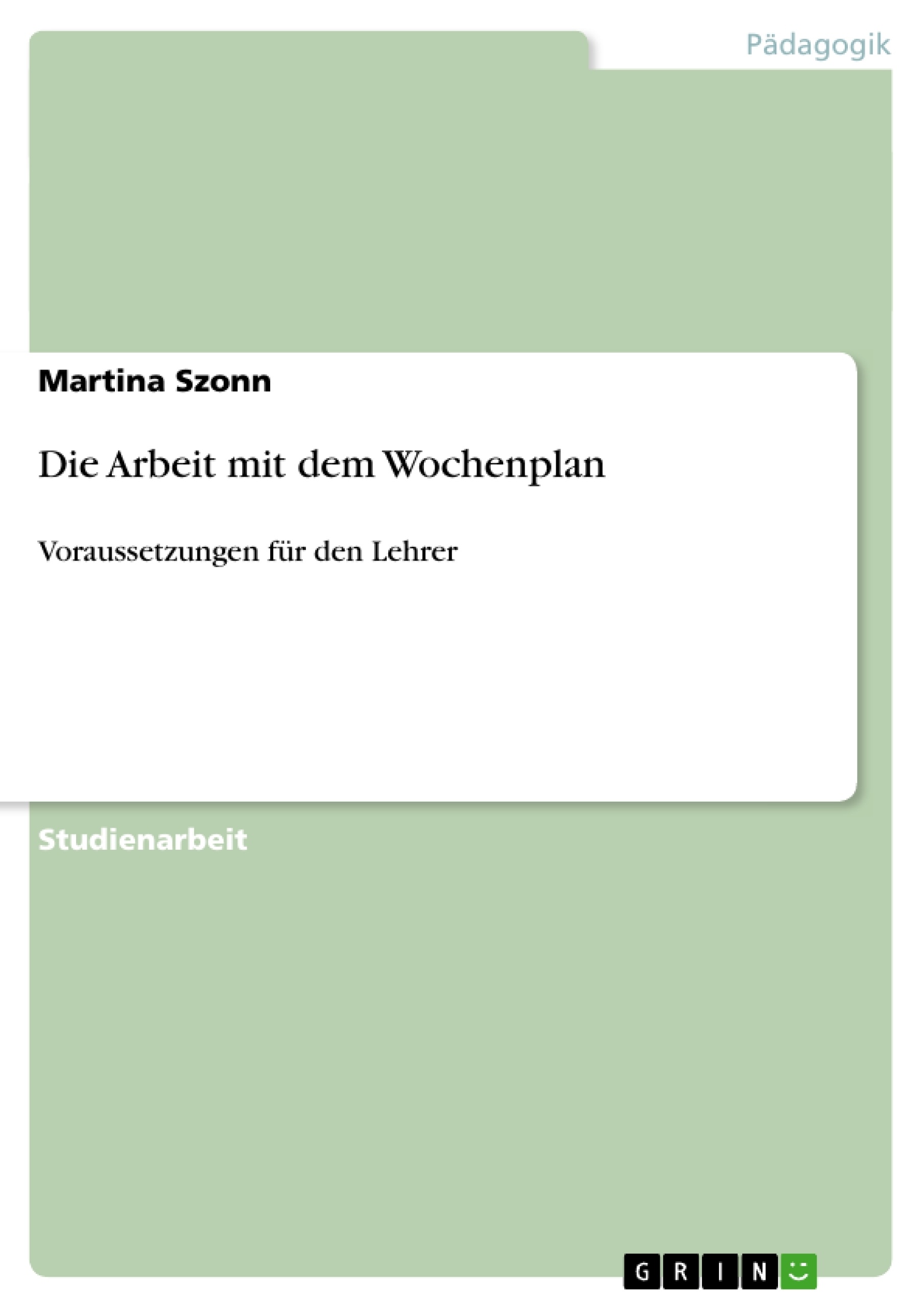Im Laufe meines Studiums und meiner geleisteten Praktika habe ich mehrfach die
Erfahrungen des „offenen Unterrichts“ machen können. Zu Beginn meiner eigenen
Grundschulzeit wurde hauptsächlich frontal unterrichtet. Erst in der Orientierungsstufe
wurde ich das erste Mal mit Wochenplanarbeit konfrontiert.
Die Kinder können mit dieser Lernform ihre Selbstständigkeit und Teamfähigkeit fördern
sowie neue Arbeitstechniken kennen lernen und erfahren auf welche verschiedene Art und
Weisen neue Dinge gelernt werden können.
In meiner folgenden Hausarbeit werde ich die Arbeit mit dem Wochenplan näher erörtern
sowie die Voraussetzungen, die der Lehrer für diese Arbeiten schaffen muss.
Des Weiteren werde ich die Vor- und Nachteile erläutern und ein Beispiel geben, wie die
Arbeit mit einem Wochenplan aussehen kann. Aus dem Marburger Grundschulprojekt, unter der Leitung von Wolfgang Klafi, ist in den
Jahren 1971 bis 1979 die Wochenplanarbeit entstanden. Mit der Hilfe von 16
Grundschullehrerinnen sollte das Projekt einen Beitrag zur Reform der staatlichen
Regelschule leisten. Das Wochenplan-Projekt soll dem Lehrer in der heutigen Schule ein
pragmatisches und flexibel variierbares Hilfsmittel sein, um erste praktische Schritte in
diese Richtung zu leisten.
Die Begriffe Selbstständigkeit, Selbststeuerung, innere Differenzierung etc. sind nicht erst
in den letzten Jahren aufgetaucht, sondern bereits in der Zeit der Reformpädagogik in den
20er Jahren.
Der Reformpädagoge Peter Petersen hat versucht, mit seinem damals entwickelten Jena-
Plan die Reformversuche umzusetzen. Während der Umsetzung hat Peter Petersen eine
ähnliche Methodik verwendet, wie es heute der Wochenplan ist. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Geschichte der Schulpädagogik und die Entstehung des Wochenplans
- Was ist ein Wochenplan?
- Verschiedene Formen der Wochenplanarbeit
- Der einfache Klassenlernplan
- Der differenzierte Wochenplan
- Der individuelle Wochenplan
- Schritte zum Gelingen der Wochenplanarbeit
- Der Aufbau eines Wochenplans
- Vorteile und Nachteile eines Wochenplans
- Vorteile und Ziele
- Nachteile und Einwände
- Wochenplan schon in der 1. Klasse?
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Methode des Wochenplans im Unterricht. Ziel ist es, die Entstehung, verschiedene Formen und den praktischen Einsatz des Wochenplans zu erläutern, sowie Vor- und Nachteile zu diskutieren. Die Arbeit beleuchtet auch die Frage der Eignung des Wochenplans für die erste Klasse.
- Geschichte und Entwicklung des Wochenplans
- Verschiedene Arten von Wochenplänen (einfach, differenziert, individuell)
- Praktische Umsetzung und Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz
- Vor- und Nachteile des Wochenplans
- Eignung des Wochenplans für die erste Klasse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die persönlichen Erfahrungen der Autorin mit offenem Unterricht und Wochenplanarbeit und kündigt die Schwerpunkte der Arbeit an: Erörterung der Wochenplanarbeit, notwendige Voraussetzungen für den Lehrer, Vor- und Nachteile sowie ein Beispiel für die praktische Umsetzung.
Einführung in die Geschichte der Schulpädagogik und die Entstehung des Wochenplans: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Wurzeln des Wochenplans, beginnend mit dem Marburger Grundschulprojekt (1971-1979) unter Wolfgang Klafki. Es werden die Verbindungen zu reformpädagogischen Ideen der 20er Jahre (Peter Petersen, Jena-Plan) und der Nachkriegszeit ("open classroom") hergestellt. Die Autorin betont den Wunsch nach Alternativen zum Frontalunterricht und positioniert den Wochenplan als eine solche Alternative.
Was ist ein Wochenplan?: Dieses Kapitel definiert den Wochenplan als Konzept zur Unterrichtsorganisation, welches selbstständiges und aktives Lernen in den Mittelpunkt stellt. Es beschreibt die Flexibilität der Methode und die Möglichkeit der Selbststeuerung durch die Schüler. Die gegenseitige Hilfe und die Selbstkontrolle der Schüler werden hervorgehoben. Das Kapitel betont, dass der Wochenplan eine Zusammenfassung und Ausweitung von Stillarbeit, Partner- und Gruppenarbeit darstellt, und legt als Zielsetzung die eigenverantwortliche Bearbeitung umfangreicher Arbeitsaufträge durch die Schüler fest, mit dem langfristigen Ziel der Schülerbeteiligung an der Unterrichtsgestaltung.
Verschiedene Formen der Wochenplanarbeit: Dieses Kapitel präsentiert unterschiedliche Formen der Wochenplanarbeit, wobei drei Varianten im Detail beschrieben werden: Der einfache Klassenlernplan (geschlossener Plan mit vorgegebenen Aufgaben, bei denen die Schüler Reihenfolge und Zeit selbst bestimmen), der differenzierte Wochenplan (Ergänzung des Basisprogramms durch anspruchsvollere Aufgaben) und der individuelle Wochenplan (der im Ausgangstext nicht weiter erläutert wird).
Schlüsselwörter
Wochenplan, Schulpädagogik, offener Unterricht, Selbstständigkeit, Selbststeuerung, Differenzierung, Klassenlernplan, Reformpädagogik, Frontalunterricht, Gruppenarbeit, Partnerarbeit.
Häufig gestellte Fragen zum Wochenplan im Unterricht
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die Methode des Wochenplans im Unterricht. Er behandelt die Geschichte und Entwicklung des Wochenplans, verschiedene Formen der Wochenplanarbeit (einfacher Klassenlernplan, differenzierter Wochenplan, individueller Wochenplan), die praktische Umsetzung, Vor- und Nachteile sowie die Eignung für die erste Klasse. Der Text enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Arten von Wochenplänen werden beschrieben?
Der Text beschreibt drei Haupttypen von Wochenplänen: den einfachen Klassenlernplan (mit vorgegebenen Aufgaben, Reihenfolge und Zeit selbstbestimmt), den differenzierten Wochenplan (mit zusätzlichen anspruchsvolleren Aufgaben neben dem Basisprogramm) und den individuellen Wochenplan (der jedoch im Text nicht detailliert erläutert wird).
Welche historischen Wurzeln hat der Wochenplan?
Der Text verortet die Wurzeln des Wochenplans in reformpädagogischen Ideen der 20er Jahre (Peter Petersen, Jena-Plan) und der Nachkriegszeit ("open classroom"). Es wird besonders das Marburger Grundschulprojekt (1971-1979) unter Wolfgang Klafki erwähnt, welches als wichtiger Einflussfaktor hervorgehoben wird. Der Wochenplan wird als Alternative zum Frontalunterricht positioniert.
Welche Vorteile und Nachteile des Wochenplans werden genannt?
Der Text nennt Vorteile wie die Förderung von Selbstständigkeit, Selbststeuerung und aktivem Lernen, die Möglichkeit der Differenzierung und die Integration verschiedener Arbeitsformen (Stillarbeit, Partner- und Gruppenarbeit). Nachteile und Einwände werden ebenfalls erwähnt, werden aber im vorliegenden Auszug nicht explizit benannt.
Ist ein Wochenplan für die erste Klasse geeignet?
Diese Frage wird im Text aufgeworfen und soll im Rahmen der Arbeit untersucht werden. Der Auszug enthält jedoch keine abschließende Antwort auf diese Frage.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Wochenplan, Schulpädagogik, offener Unterricht, Selbstständigkeit, Selbststeuerung, Differenzierung, Klassenlernplan, Reformpädagogik, Frontalunterricht, Gruppenarbeit, Partnerarbeit.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist strukturiert in Einleitung, Einführung in die Geschichte, Definition des Wochenplans, verschiedene Formen der Wochenplanarbeit, Schritte zum Gelingen, Vor- und Nachteile, Eignung für die 1. Klasse und Schlussbemerkung. Er enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis und Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Ziel des Textes ist es, die Methode des Wochenplans im Unterricht zu untersuchen. Dies beinhaltet die Erläuterung der Entstehung, verschiedener Formen und des praktischen Einsatzes des Wochenplans sowie die Diskussion von Vor- und Nachteilen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage der Eignung des Wochenplans für die erste Klasse.
- Citation du texte
- Martina Szonn (Auteur), 2003, Die Arbeit mit dem Wochenplan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15250