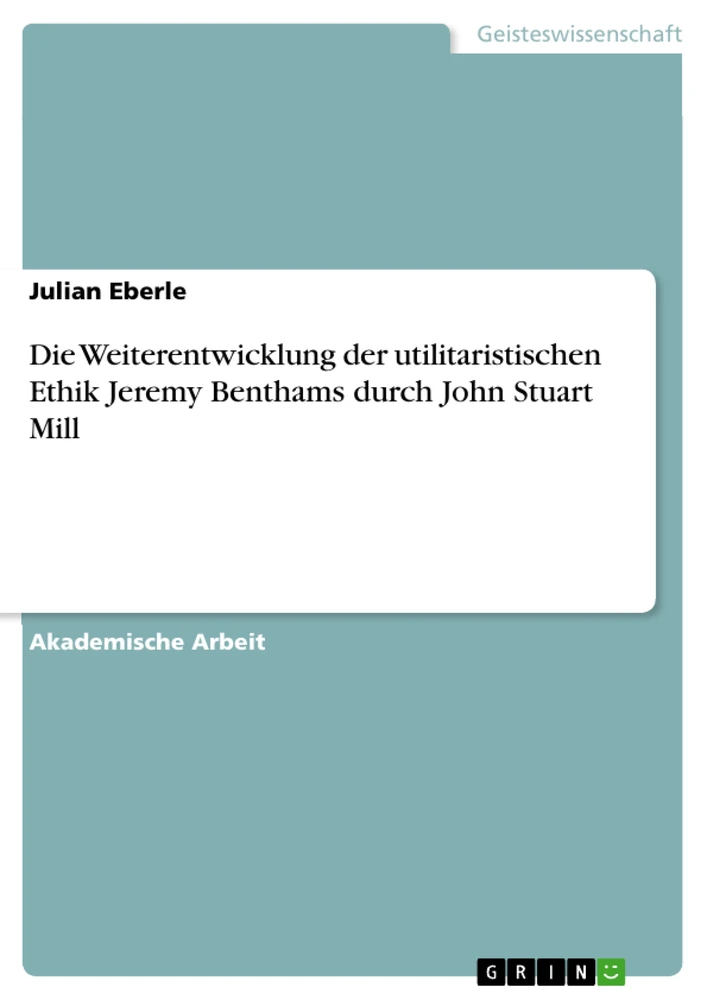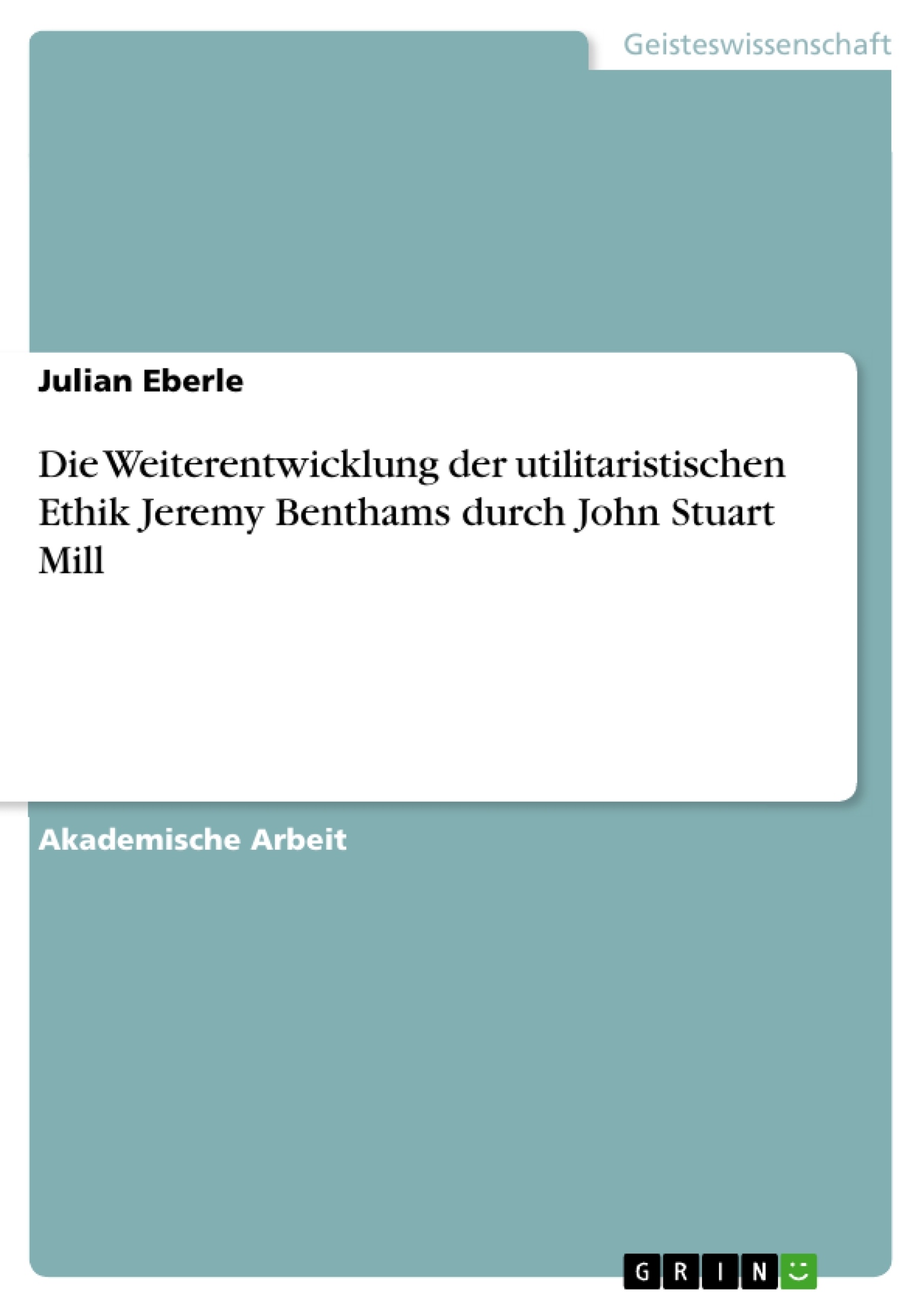Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung der klassischen utilitaristischen Ethik von Jeremy Bentham durch John Stuart Mill. Die Schriften Benthams hatten einen nachhaltigen Einfluss auf die moralphilosophischen Debatten seiner Zeit. Anstatt die Grundlage der Moral in besonderen intrinsischen Eigenschaften der Handlung oder der Motivation zu suchen, macht er die Folgen einer Handlung zu den Faktoren, die bestimmen, ob eine Handlung moralisch legitim oder illegitim erscheint. Wenn eine Handlung verspricht, das Glück derjenigen, die von ihr betroffen sind, zu erhöhen, spricht das nach Bentham für die moralische Güte dieser Handlung. Er betrachtete das Glück, als das im Handeln zu erstrebende Gut, aber als einen rein quantitativen Betrag. John Stuart Mill baute diese Theorie weiter aus, indem er forderte, dass die qualitativen Aspekte des menschlichen Glücksempfindens mit in die moralische Beurteilung einfließen müssen. Im Verlauf der Arbeit soll diese Weiterentwicklung der Theorie Benthams durch Mill dargestellt und an einigen Punkten kritisiert werden.
Zu Beginn der Arbeit wird die Theorie Benthams und sein Verfahren der ethischen Reflexion gemäß dem Nutzenkalkül vorgestellt. Anschließend wird im Zusammenhang mit der an Bentham geäußerten Kritik erklärt, an welchem Punkt Mill ansetzt, um dessen Theorie weiterzuentwickeln, und welche Aspekte der ethischen Theorie diese Weiterentwicklung umfasst. Abschließend wird diese Weiterentwicklung selbst wiederum zum Gegenstand der Kritik gemacht, indem gefragt wird, inwieweit die Theorie Mills in der Praxis tatsächlich Anwendung finden kann, und inwiefern sie möglicherweise hinter den Ansprüchen des klassischen Utilitarismus zurückbleibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Der bentham'sche Utilitarismus
- Kritik gegenläufiger Prinzipien
- Der Utilitarismus von John Stuart Mill
- Qualitativer versus quantitativer Utilitarismus
- Mills Fehlschlüsse
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Weiterentwicklung des utilitaristischen Ansatzes von Jeremy Bentham durch John Stuart Mill. Ziel ist es, Mills Modifikationen der Benthamschen Theorie darzustellen und kritisch zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Unterschiede zwischen quantitativem und qualitativem Utilitarismus und die praktische Anwendbarkeit von Mills Theorie.
- Benthams quantitativer Utilitarismus und sein Nutzenkalkül
- Kritik an konkurrierenden ethischen Prinzipien im Kontext von Benthams Theorie
- Mills Erweiterung des Utilitarismus um qualitative Aspekte des Glücks
- Vergleich und Kontrast zwischen Bentham und Mill
- Praktische Anwendbarkeit und Limitationen von Mills Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Thema der Arbeit: die Weiterentwicklung des Utilitarismus von Bentham durch Mill. Sie skizziert den Fokus auf den quantitativen Ansatz Benthams und Mills Erweiterung um qualitative Aspekte des Glücks. Die Einleitung erläutert den Aufbau der Arbeit und kündigt die kritische Auseinandersetzung mit beiden Theorien an. Der zentrale Punkt ist die Ankündigung einer Analyse der praktischen Anwendbarkeit und möglicher Schwächen von Mills Weiterentwicklung.
Der bentham'sche Utilitarismus: Dieses Kapitel stellt Benthams utilitaristischen Ansatz vor. Es beschreibt sein "principle of utility" und erklärt, wie Bentham die moralische Bewertung von Handlungen an deren Folgen in Bezug auf Glück oder Unglück misst. Die Betonung liegt auf dem quantitativen Aspekt des Glücks, wobei die Anzahl der Betroffenen und die Intensität des Glücks entscheidend sind. Der Text analysiert Benthams Kritik an konkurrierenden ethischen Prinzipien, um die Stärke seines utilitaristischen Ansatzes hervorzuheben. Das Kapitel legt den Grundstein für den Vergleich mit Mills Ansatz.
Kritik gegenläufiger Prinzipien: Dieses Kapitel befasst sich mit Benthams Kritik an gegensätzlichen ethischen Prinzipien. Es wird erläutert, wie Bentham sein Nutzenprinzip gegen andere Ansätze, wie beispielsweise den Asketismus, abgrenzt und verteidigt. Die Kritik an diesen Prinzipien unterstreicht die empirische Basis und die pragmatische Ausrichtung des Benthamschen Utilitarismus, indem sie die klare Messbarkeit der Folgen menschlicher Handlungen hervorhebt und die Grenzen subjektiver Bewertungen aufzeigt.
Der Utilitarismus von John Stuart Mill: Dieses Kapitel widmet sich Mills Weiterentwicklung des Utilitarismus. Es betont den Übergang von einem rein quantitativen zu einem qualitativen Verständnis von Glück. Mill argumentiert, dass verschiedene Arten von Glück unterschiedlichen Wert haben und nicht einfach addiert werden können. Das Kapitel beleuchtet die Unterschiede in der Bewertung von Glück und die komplexeren Überlegungen, die Mills Theorie mit sich bringt. Die Diskussion konzentriert sich auf die Verbesserung von Benthams rein quantitativer Herangehensweise durch die Berücksichtigung qualitativer Unterschiede im menschlichen Glück.
Schlüsselwörter
Utilitarismus, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, quantitativer Utilitarismus, qualitativer Utilitarismus, Nutzenkalkül, Glück, moralische Bewertung, Konsequentialismus, ethische Prinzipien, Prinzip der Nützlichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis behandelt die Weiterentwicklung des Utilitarismus von Jeremy Bentham durch John Stuart Mill.
Was ist das Hauptziel dieser Arbeit?
Ziel ist es, Mills Modifikationen der Benthamschen Theorie darzustellen und kritisch zu beleuchten, wobei der Fokus auf den Unterschieden zwischen quantitativem und qualitativem Utilitarismus und der praktischen Anwendbarkeit von Mills Theorie liegt.
Was sind die Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Themenschwerpunkte umfassen Benthams quantitativen Utilitarismus, Kritik an konkurrierenden ethischen Prinzipien im Kontext von Benthams Theorie, Mills Erweiterung des Utilitarismus um qualitative Aspekte des Glücks, einen Vergleich zwischen Bentham und Mill, sowie die praktische Anwendbarkeit und Limitationen von Mills Theorie.
Was behandelt die Einleitung?
Die Einleitung beschreibt das Thema der Arbeit, skizziert den Fokus auf den quantitativen Ansatz Benthams und Mills Erweiterung um qualitative Aspekte des Glücks, erläutert den Aufbau der Arbeit und kündigt die kritische Auseinandersetzung mit beiden Theorien an. Der zentrale Punkt ist die Ankündigung einer Analyse der praktischen Anwendbarkeit und möglicher Schwächen von Mills Weiterentwicklung.
Was wird im Kapitel über den bentham'schen Utilitarismus behandelt?
Dieses Kapitel stellt Benthams utilitaristischen Ansatz vor, beschreibt sein "principle of utility" und erklärt, wie Bentham die moralische Bewertung von Handlungen an deren Folgen in Bezug auf Glück oder Unglück misst. Die Betonung liegt auf dem quantitativen Aspekt des Glücks. Der Text analysiert Benthams Kritik an konkurrierenden ethischen Prinzipien.
Worauf konzentriert sich das Kapitel "Kritik gegenläufiger Prinzipien"?
Dieses Kapitel befasst sich mit Benthams Kritik an gegensätzlichen ethischen Prinzipien und erläutert, wie Bentham sein Nutzenprinzip gegen andere Ansätze, wie beispielsweise den Asketismus, abgrenzt und verteidigt.
Was ist der Fokus des Kapitels über John Stuart Mills Utilitarismus?
Dieses Kapitel widmet sich Mills Weiterentwicklung des Utilitarismus und betont den Übergang von einem rein quantitativen zu einem qualitativen Verständnis von Glück. Mill argumentiert, dass verschiedene Arten von Glück unterschiedlichen Wert haben und nicht einfach addiert werden können.
Welche Schlüsselwörter werden in der Arbeit verwendet?
Zu den Schlüsselwörtern gehören Utilitarismus, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, quantitativer Utilitarismus, qualitativer Utilitarismus, Nutzenkalkül, Glück, moralische Bewertung, Konsequentialismus, ethische Prinzipien und Prinzip der Nützlichkeit.
- Quote paper
- Julian Eberle (Author), 2022, Die Weiterentwicklung der utilitaristischen Ethik Jeremy Benthams durch John Stuart Mill, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1523962