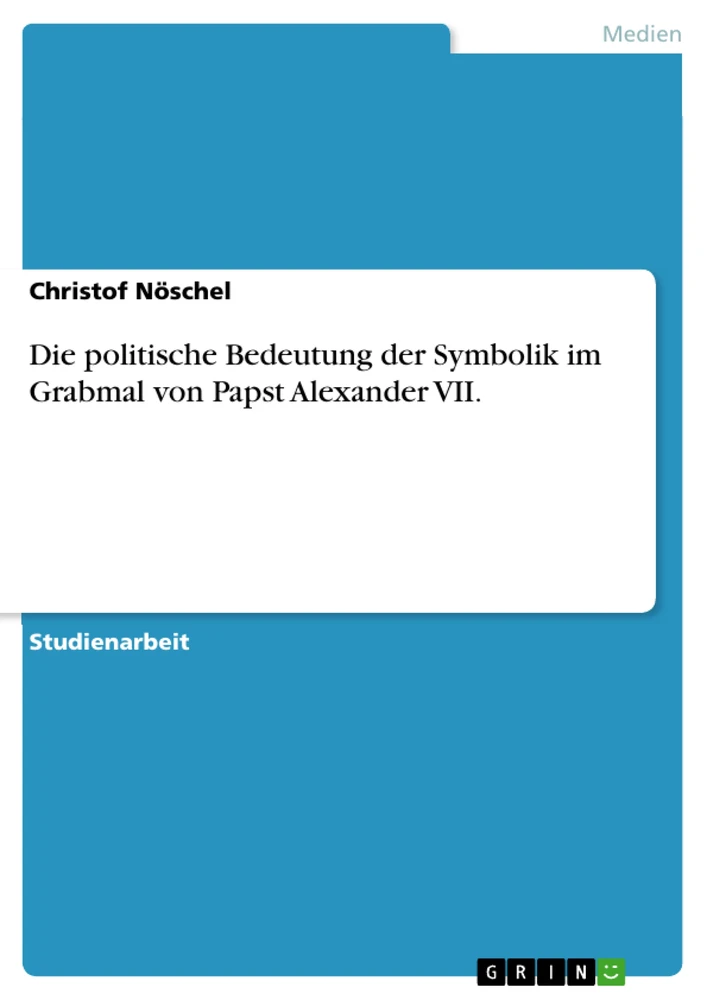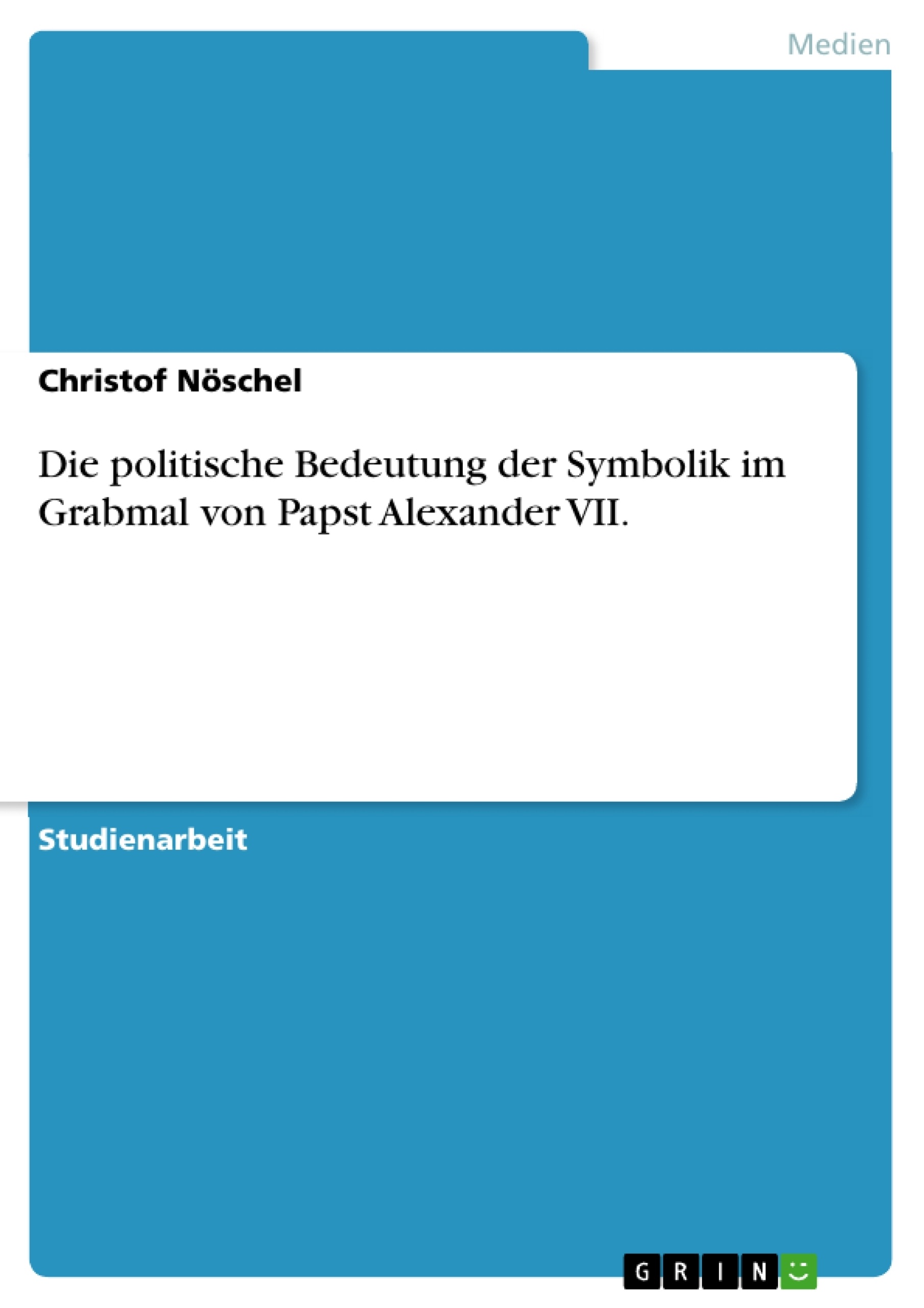In dieser Hausarbeit werden wir uns eingehend mit der Entstehungsgeschichte, der Ikonographie und der politischen Bedeutung des Grabmals von Alexander VII. befassen. Wir werden untersuchen, wie dieses beeindruckende Kunstwerk entstand, welche politischen und religiösen Kontexte es prägten und welche Botschaften es vermittelt. Durch eine detaillierte Analyse der allegorischen Figuren, der architektonischen Gestaltung und der historischen Hintergründe werden wir versuchen, ein umfassendes Bild von diesem bedeutenden Denkmal zu zeichnen und seine Bedeutung für die Geschichte Europas zu verstehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Zur Entstehungsgeschichte des Grabmals
- Beschreibung
- Die Spannungen im Europa des 17. Jahrhunderts
- Die Selbstdarstellung Alexander's VII und Ikonographie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Grabmal von Papst Alexander VII. im Petersdom. Ziel ist es, die Entstehungsgeschichte, die Ikonographie und die politische Bedeutung dieses monumentalen Werkes zu ergründen und seine Rolle im Kontext des 17. Jahrhunderts zu beleuchten.
- Die Entstehungsgeschichte des Grabmals und die Rolle von Bernini und Flavio Chigi
- Die Ikonographie des Grabmals und ihre allegorischen Bedeutungen
- Die politische Bedeutung des Grabmals im Kontext des europäischen 17. Jahrhunderts
- Die Selbstdarstellung Alexanders VII. durch das Grabmal
- Die Verbindung zwischen Kunst, Politik und Religion im Barock
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einführung stellt das Grabmal von Alexander VII. als ein komplexes Kunstwerk vor, das mehr ist als nur ein kunsthistorisches Artefakt. Es spiegelt die politische Macht und religiöse Autorität des 17. Jahrhunderts wider und vermittelt eine Botschaft über die Rolle des Papsttums in einer sich wandelnden Welt. Die Arbeit kündigt eine detaillierte Analyse der Entstehungsgeschichte, Ikonographie und politischen Bedeutung des Grabmals an.
Zur Entstehungsgeschichte des Grabmals: Dieses Kapitel beleuchtet die Planungs- und Entstehungsphase des Grabmals, beginnend kurz nach der Papstwahl Alexanders VII. im Jahr 1655. Es beschreibt die Beteiligung von Kardinalnepoten Flavio Chigi und Gian Lorenzo Bernini, die Herausforderungen bei der Quellenfindung (geringe Anzahl schriftlicher Dokumente) und die verschiedenen Planungsstadien, die durch erhaltene Zeichnungen und Bozetti rekonstruiert werden. Besonders hervorzuheben sind die unterschiedlichen Entwürfe und die letztendlich gewählte Nische im Petersdom, die von der ursprünglich geplanten abweicht. Der Tagebucheintrag Alexanders VII. von 1660 zeigt sein aktives Mitwirken an der ikonographischen Gestaltung. Die Analyse der erhaltenen Zeichnungen (Windsor und Christie's) zeigt unterschiedliche Kompositionen, insbesondere bezüglich der allegorischen Figuren und deren Anordnung.
Beschreibung: Dieses Kapitel beschreibt die endgültige Ausführung des Grabmals. Es konzentriert sich auf die architektonischen und skulpturalen Elemente, wie die Säulen aus rotem Marmor, das Gebälk, das Wappen Alexanders VII. mit dem entwurzelten Eichenbaum und das Andreaskreuz, und die allegorischen Figuren. Die Beschreibung fokussiert auf die materiellen Aspekte des Denkmals und deren künstlerische Gestaltung. Die detaillierte Beschreibung der Materialien und der künstlerischen Ausführung vermittelt ein anschauliches Bild des Grabmals.
Schlüsselwörter
Papst Alexander VII., Gian Lorenzo Bernini, Grabmal, Petersdom, Barock, Ikonographie, politische Bedeutung, Allegorie, 17. Jahrhundert, Europa, Papsttum, Macht, Religion, Kunstgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit analysiert das Grabmal von Papst Alexander VII. im Petersdom und untersucht seine Entstehungsgeschichte, Ikonographie und politische Bedeutung im Kontext des 17. Jahrhunderts.
Welche Zielsetzung verfolgt diese Hausarbeit?
Ziel ist es, die Entstehungsgeschichte, Ikonographie und politische Bedeutung des Grabmals zu ergründen und seine Rolle im Kontext des 17. Jahrhunderts zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Verbindung zwischen Kunst, Politik und Religion im Barock.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Themenschwerpunkte sind die Entstehungsgeschichte des Grabmals und die Rolle von Bernini und Flavio Chigi, die Ikonographie des Grabmals und ihre allegorischen Bedeutungen, die politische Bedeutung des Grabmals im Kontext des europäischen 17. Jahrhunderts, die Selbstdarstellung Alexanders VII. durch das Grabmal und die Verbindung zwischen Kunst, Politik und Religion im Barock.
Was wird in der Einführung behandelt?
Die Einführung stellt das Grabmal von Alexander VII. als ein komplexes Kunstwerk vor, das die politische Macht und religiöse Autorität des 17. Jahrhunderts widerspiegelt. Sie kündigt eine detaillierte Analyse der Entstehungsgeschichte, Ikonographie und politischen Bedeutung des Grabmals an.
Was wird im Kapitel zur Entstehungsgeschichte des Grabmals behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Planungs- und Entstehungsphase des Grabmals, beginnend kurz nach der Papstwahl Alexanders VII. im Jahr 1655. Es beschreibt die Beteiligung von Kardinalnepoten Flavio Chigi und Gian Lorenzo Bernini, die Herausforderungen bei der Quellenfindung und die verschiedenen Planungsstadien, die durch erhaltene Zeichnungen und Bozetti rekonstruiert werden.
Was wird im Kapitel zur Beschreibung des Grabmals behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die endgültige Ausführung des Grabmals. Es konzentriert sich auf die architektonischen und skulpturalen Elemente, wie die Säulen aus rotem Marmor, das Gebälk, das Wappen Alexanders VII. und die allegorischen Figuren. Die Beschreibung fokussiert auf die materiellen Aspekte des Denkmals und deren künstlerische Gestaltung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Hausarbeit?
Papst Alexander VII., Gian Lorenzo Bernini, Grabmal, Petersdom, Barock, Ikonographie, politische Bedeutung, Allegorie, 17. Jahrhundert, Europa, Papsttum, Macht, Religion, Kunstgeschichte.
- Quote paper
- Christof Nöschel (Author), 2024, Die politische Bedeutung der Symbolik im Grabmal von Papst Alexander VII., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1522948