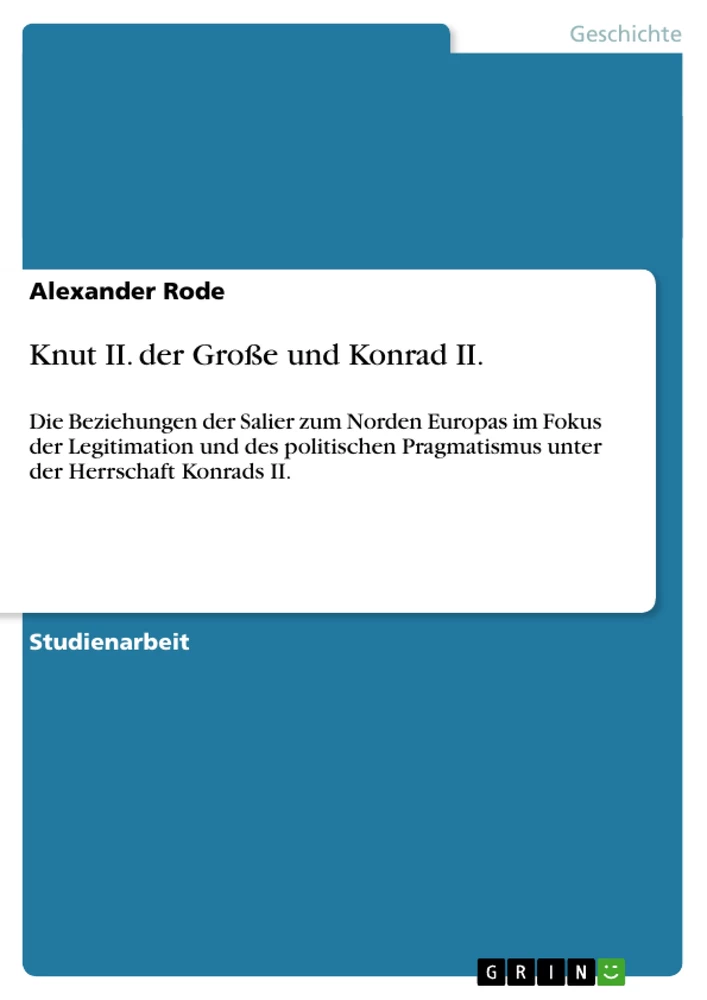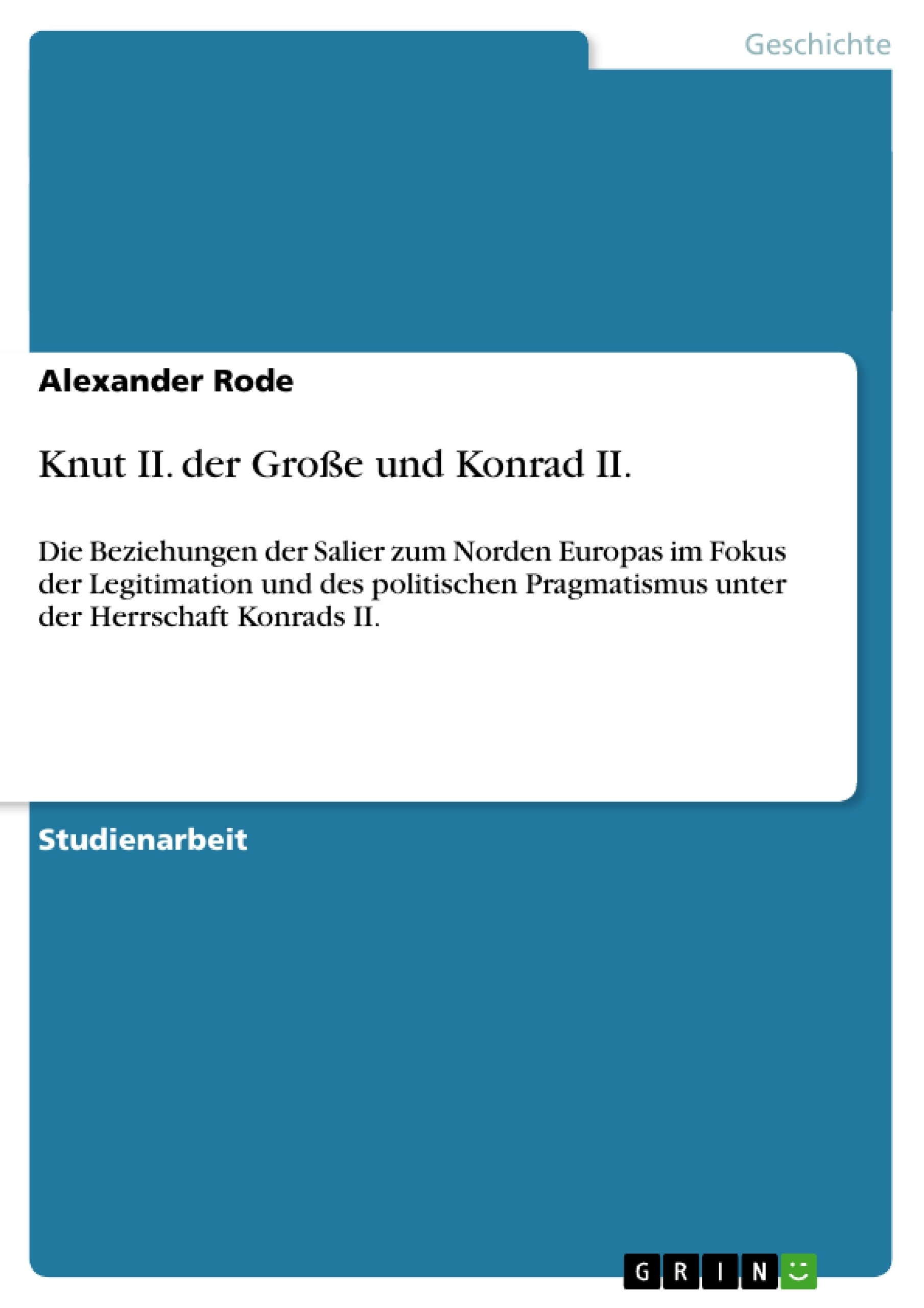Der Europäische Norden des frühen und hohen Mittelalters stellt in der deutschen Historiografie noch weitgehend eine Schattenlandschaft dar. Ein Grundproblem ist der Mangel an schriftlich tradierter Überlieferung aus dem Norden, so ist über die Geschichte des frühen skandinavischen Mittelalters vergleichsweise wenig bekannt. Wir verdanken das Wissen über diese Zeit im Wesentlichen der archäologischen Forschung.
Bei der Betrachtung der Geschichte des Nordens im 10. Und 11. Jahrhunderts erscheint, sowohl unter den skandinavischen Reichen, als auch bei den nordisch – fränkischen Beziehungen, das Christentum als wichtigste Klammer der transnationalen Beziehungen. Die Taufe, allen voran die der jeweiligen Könige, der mächtigsten Männer des Stammes, war dabei das zentrale Integrationsmittel. Dem Thing kam bei der Frage der Christianisierung eine entscheidende Rolle zu, denn hier musste beraten und beschlossen werden, ob der neue Glauben angenommen werden sollte. Wie schwierig sich die Christianisierung in Skandinavien erwies, zeigten die seit dem 9. Jahrhundert immer wieder aufscheinenden Missionsbestrebungen des fränkischen Klerus und der Könige. Die Erfolge der Missionare, die den Norden für den christlichen Glauben gewinnen wollten, waren oftmals nur von kurzer Dauer. Und dennoch blieb die Mission der Dänen, Norweger und Schweden immer eine wichtige Intention beider Frankenreiche. Nur durch die Mission und Christianisierung konnte es gelingen, die immer wieder den abendländischen Kontinent bedrohenden Wikinger zu befrieden. Das Gefühl der Fremdheit, der Feindlichkeit des Nordens und der darin lebenden Wikinger bestimmte auch die zeitgenössische Geschichtsschreibung. In Dänemark war das Christentum seit dem 8./ 9. Jahrhundert bekannt, konnte sich aber lange Zeit nicht dauerhaft etablieren. Vielerorts hielten die Skandinavier an ihrem heidnischen Glauben fest. Auch konnte es vorkommen, dass sich der christliche und der heidnische Glauben verbanden oder der christliche Gott in das heidnische Pantheon eingereiht wurde, dass sich heidnische und christliche Glaubenselemente verbanden und gegenseitig überformten. Erst im Verlauf des 10. Jahrhunderts kann auch im Norden die Etablierung und Festigung des Christentums festgestellt werden. Eine umfassende skandinavische Geschichtsschreibung setzt erst im 12. Jahrhundert ein.
Inhaltsverzeichnis
I. Die Christianisierung Norwegens, Schwedens und Dänemarks und die Gormiden
II. Knuts II. des Großen Weg zur Herrschaft
III. Die Frage der Legitimität Knuts
IV. Die Eroberung Norwegens
V. 1. Beziehungen zwischen den Gormiden, den Ottonen und den Saliern
2. Konrad II. (1024 - 1039)
3. Der Kirchenstreit des Hamburg - Bremer Erzbischofs mit Knut II. dem Großen
4. Die Kaiserkrönung Konrads II
5. Die Heirat Heinrichs III. und Gunhildes 1036
Ausblick und Fazit
Quellen und Literaturnachweis
Der Europäische Norden des frühen und hohen Mittelalters stellt in der deutschen Historiografie noch weitgehend eine Schattenlandschaft dar. Ein Grundproblem ist der Mangel an schriftlich tradierter Überlieferung aus dem Norden, so ist über die Geschichte des frühen skandinavischen Mittelalters vergleichsweise wenig bekannt. Wir verdanken das Wissen über diese Zeit im Wesentlichen der archäologischen Forschung.
Bei der Betrachtung der Geschichte des Nordens im 10. Und 11. Jahrhunderts erscheint, sowohl unter den skandinavischen Reichen, als auch bei den nordisch - fränkischen Beziehungen, das Christentum als wichtigste Klammer der transnationalen Beziehungen. Die Taufe, allen voran die der jeweiligen Könige, der mächtigsten Männer des Stammes, war dabei das zentrale Integrationsmittel. Dem Thing kam bei der Frage der Christianisierung eine entscheidende Rolle zu, denn hier musste beraten und beschlossen werden, ob der neue Glauben angenommen werden sollte1.
Wie schwierig sich die Christianisierung in Skandinavien erwies, zeigten die seit dem 9. Jahrhundert immer wieder aufscheinenden Missionsbestrebungen des fränkischen Klerus und der Könige. Die Erfolge der Missionare, die den Norden für den christlichen Glauben gewinnen wollten, waren oftmals nur von kurzer Dauer. Und dennoch blieb die Mission der Dänen, Norweger und Schweden immer eine wichtige Intention beider Frankenreiche. Nur durch die Mission und Christianisierung konnte es gelingen, die immer wieder den abendländischen Kontinent bedrohenden Wikinger zu befrieden. Das Gefühl der Fremdheit, der Feindlichkeit des Nordens und der darin lebenden Wikinger bestimmte auch die zeitgenössische Geschichtsschreibung.
In Dänemark war das Christentum seit dem 8./ 9. Jahrhundert bekannt, konnte sich aber lange Zeit nicht dauerhaft etablieren2. Vielerorts hielten die Skandinavier an ihrem heidnischen Glauben fest. Auch konnte es vorkommen, dass sich der christliche und der heidnische Glauben verbanden oder der christliche Gott in das heidnische Pantheon eingereiht wurde, dass sich heidnische und christliche Glaubenselemente verbanden und gegenseitig überformten3.
Erst im Verlauf des 10. Jahrhunderts kann auch im Norden die Etablierung und Festigung des Christentums festgestellt werden. Eine umfassende skandinavische Geschichtsschreibung setzt erst im 12. Jahrhundert ein. Die wenigen Quellen verdankt die Historiografie missionierenden Mönchen und vor allem der für die Arbeit maßgeblichen, zwischen 1075 und 1080 entstandenen Hamburgischen Kirchengeschichte Adams von Bremen4. Daneben wird das Bild der salisch - gormidischen Beziehungen durch Wipos Gesta Chuonradi und Thietmar von Merseburgs Chronik erweitert werden.
Wichtig für die Untersuchung des Themas ist dabei die Betrachtung der Christianisierung des Nordens, im Besonderen die Dänemarks und Norwegens. Da England das Kernland der Herrschaft Knuts darstellte, wird auch hier ein genauerer Blick von Nöten sein. In einem weiteren Schritt werde ich auf die Hintergründe eingehen, die sowohl Knut II. den Großen als auch Konrad II. veranlassten, den gemeinsamen Bund zu suchen. Hier wird die Frage der Legitimation ein zentraler Punkt der Untersuchung sein. Abschließend erfolgt die Schilderung der Beziehungen zwischen Knut II. dem Großen und Konrad II. unter genauerer Betrachtung des Kirchenstreits zwischen Knut und dem Hamburg - Bremer Erzbischof, der Kaiserkrönung Konrads und der Heirat Heinrichs III. und Gunhildes.
I. Die Christianisierung Norwegens, Schwedens und Dänemarks und die Gormiden
Die Skandinavische Geschichte des frühen und hohen Mittelalters liegt weitgehend im Dunkeln. Erst im Verlauf des 9. und 10. Jahrhunderts verdichteten sich, durch zumeist kriegerische Kontakte, die Erfahrungen mit dem Norden. Mit Gorm dem Alten (um 940 - 958) begann die dänische Geschichte festere Konturen anzunehmen. Jener Stammvater der Jellingen - Dynastie, blieb Zeit seines Lebens Heide, gleichwohl er die Missionsbemühungen in seinen Gebieten tolerierte5. Die Gründung der drei dänischen Bistümer Schleswig, Ribe und Aarhus im Jahr 947/ 948 verfestigte diese Annahme6.
Mit König Harald Blauzahn (um 958 - 987), der vermutlich um 960, spätestens aber 965 getauft wurde, begann das Christentum in Dänemark Fuß zu fassen7. Als Ausdruck des neuen herrscherlichen Selbstverständnisses ließ sich Harald als Herr über Dänemark und Norwegen auf dem Runenstein von Jelling in Jütland verewigen8. Auch sei mit ihm das Christentum nach Dänemark gekommen. Sicherlich entsprang diese Aussage einer idealisierten, propagandistisch geprägten Herrschaftsauffassung, denn es brauchte noch einige Jahrzehnte, bis sich das Christentum bei den Dänen festigen konnte9. Ferner ist anzunehmen, wenn die Selbstdarstellung stimmig ist, dass Harald nicht einzig aus christlichem Eifer den neuen Glauben annahm. Politisches Kalkül mag seine Entscheidung beeinflusst haben, denn angesichts der Missionsbemühungen der Ottonen war es um die Unabhängigkeit vom ottonischen Reich zu demonstrieren wichtig, selbst als Wegbereiter des christlichen Glaubens in Dänemark aufzutreten.
Daneben wird Harald nicht entgangen sein, wie sehr die Macht in den fränkischen Reichen auf der Kirche beruhte und wie nützlich auch ihm das Christentum sein konnte. Bezieht man in die Überlegung ein, dass Harald auch in Norwegen die Oberhoheit erlangte, scheint eine systematische Christianisierungspolitik durchaus dienlich gewesen zu sein10. In der Tat kann schon bei Harald von einer gezielten Christianisierung - viel später als im kontinentalen Europa - von oben gesprochen werden.
Sven Gabelbart (986 - 1014) - der Sohn Haralds und Vater Knuts des Großen - war ebenfalls getauft und erschien dennoch bei Adam von Bremen als Heide11. Er wurde im Gegensatz zum christlichen Harald mit klar barbarischen Zügen gezeichnet. Nach Adams Schilderung habe sich Sven sogar als Christenverfolger erwiesen12. Diese Darstellung ist sicherlich übersteigert, wenngleich sich Sven nicht mit dem gleichen Eifer an der Mission des Nordens beteiligte wie sein Vater Harald. Zu dem negativen Urteil über Sven hatten sicherlich die Überfälle der Dänen auf das nördliche Sachsen und die Erhebung gegen seinen Vater Harald beigetragen13. Außerdem hatte sich der Bischof Grimkil von Norwegen dem Hamburg - Bremer Erzbischof unterstellt, was vor dem Hintergrund des noch zu erläuternden Kirchenstreits unter Unwan eine eindeutige Parteinahme Adams begründet14. Erst um das Jahr 1000 erwies sich Sven auch bei Adam als christlicher Herrscher15.
Es ist anzunehmen, dass Sven der Eroberung Englands Priorität einräumte, die ihm 1013 auch gelang16. Auch konnte er eine dänische Oberhoheit über Norwegen installieren und durch die Heirat mit einer Schwester (und Witwe des schwedischen Königs Olaf Schoßkönig) Boleslaw Chrobrys ein einflussreiches Bündnis mit Polen abschließen17. Schlussendlich begann der Norden unter Sven einen Platz in Europa einzunehmen. Das Jahr 1000 gilt dabei als einschneidendes Jahr: langsam begannen sich die fremd erscheinenden Wikinger zu Nachbarn und einzubeziehenden Partner zu entwickeln. Der Norden wurde in Europa integriert.
Zwar kam es auch unter Sven Gabelbart und Knut dem Großen zu Eroberungen, doch sind diese klar von den Wikingerzügen zu differenzieren, da sie eine deutlichere politische Signatur trugen. Sie hatten politische Ziele, standen unter herrschaftssichernden oder herrschaftsausbauenden Prämissen und waren von „zielbewusster großstaatlicher Politik“18 gekennzeichnet.
Dem entspricht die Annahme Hoffmanns, dass sich „zunächst die Energien des Königtums auf die Schaffung des drei Reiche umfassenden Nordseeimperiums konzentriert(e), und (Dänemark) nach dem Erwerb Englands (…) zum Nebenland der Gormiden (sank). Der Ausbau der staatlichen Macht wie der kirchlichen Organisation stockte“19. Erst unter Knuts Herrschaft lässt sich wieder eine stärkere königliche Aktivität innerhalb der regna nachzeichnen.
Harald Blauzahn, Sven Gabelbart und später auch Knut II. dem Großen gelang eine Verfestigung der Herrschaft, bei der sich die Jellingen mehr oder minder auch immer des Christentums bedienten. Das Christentum war zum Mittel der Herrschaftslegitimation geworden20. Christentum, Mission und Herrschaft hatten sich zu einer Einheit verbunden.
Die Christianisierung in Norwegen fand vor allem unter Olav Tryggvasson (995 - 1000) und Olav dem Heiligen (1015 - 1030) statt21. Besonders Olav Tryggvasson stand in dem Ruf die Missionierung äußerst kompromisslos vorangetrieben zu haben22. Es ist denkbar, dass er den christlichen Glauben zu nutzen wusste, um sich gegen die nach der Krone strebenden norwegischen Jarle durchzusetzen.
Unter dem Aspekt der konkurrierenden Missionsbestrebungen zwischen Norwegern und Dänen, einer Mission die immer auch die eigene Macht legitimieren und die Herrschaft stabilisieren sollte, erscheint die Christianisierung durch die Norweger als Gegenmaßnahme gegen die dänischen Hegemonialbestrebungen23. Es ist vorstellbar, dass in einer Zeit in der sich heidnische und christliche Glaubenselemente durchaus noch verbinden konnten, sich das Christentum weniger einheitlich, denn vielmehr als eine in der Person des Königs fokussierten und durch ihn präsentierten Religion darstellte.
In Schweden vollzog sich die Christianisierung langsamer als in den skandinavischen Nachbarländern. Obwohl es schon früh christliche Könige gegeben hatte, waren die Schweden noch lange Zeit in ihrem heidnischem Glauben verhaftet24.
II. Knuts II. des Großen Weg zur Herrschaft
Unter seinen regna stellte für Knut England das Kernland des Königtums dar und war mit dem meisten Prestige verbunden. Auf eine ausführliche Darstellung der englischen Geschichte des 10. Jahrhundert werde ich verzichten. Hervorheben möchte ich lediglich, dass es gegen Ende des Jahrhunderts mehrere Eroberungswellen durch zumeist norwegische Wikinger gegeben hatte. Von Interesse sei hier nur die Invasion aus dem Jahr 994, als Olav Tryggvason und Sven Gabelbart die Süd - Ost und die Südküste Englands verheerten25.
Olav schloss schnell Frieden, doch die Dänen unter Sven verheerten in den folgenden Jahren weiterhin die Küsten Südenglands26. Der englische König Aethelred reagierte und fühlte sich 1002 mächtig genug anzuordnen, alle Dänen, denen er in seinem regnum habhaft werden konnte, zu töten27. Diese folgenreiche Maßnahme beschwor darauf hin mehrere Kriegszüge Sven Gabelbarts herauf, die 1013 mit der Eroberung Englands durch Sven endeten28. Jedoch starb Sven schon ein Jahr später und übergab die Herrschaft über Dänemark an seinen Sohn Harald (1014 - 1018)29. Knut wurde in England vom Heer zum König akklamiert. Zunächst gelang es Aethelred noch Knut aus England zu vertreiben, doch kehrte Knut wenig später mit der Unterstützung des Jarls Erich Håkonsson zurück30. Währenddessen hatte sich Olav der Heilige 1015 Norwegens bemächtigt31.
1016 konnte sich Knut gegen Aethelreds Sohn Edmund Ironside - Aethelred selbst war inzwischen gestorben und Edmund war dessen Nachfolger geworden - durchsetzen32. England wurde zwischen Knut und Edmund aufgeteilt. Als aber auch Edmund schon 1016 starb, war diese Abmachung hinfällig und die meisten angelsächsischen Großen huldigten Knut und erhoben ihn zum englischen König33. Um die Herrschaft in England zu sichern, ehelichte Knut 1017 die Witwe Aethelreds Emma und heiratete so in die königliche Sippe ein34. Möglicherweise wollte er dadurch verhindern, dass die Söhne Edmund Ironsides Ansprüche auf den englischen Thron geltend machen konnten35.
Nur bedingt erscheint Knuts Herrschaft in England als die eines Invasoren. Charakteristisch für seine Herrschaft in England war eine Ausgleichspolitik zwischen Angelsachsen und Dänen. Bezeichnenderweise verzichtete er darauf, sein Heer mit Besitzungen in England zu entlohnen und erhob stattdessen ein Danegeld36. Dem gegenüber stand jedoch die Neubesetzung einflussreicher Stellungen und Ämter in England mit Dänen37.
[...]
1 Vgl. M. KAUFHOLD, Europas Norden, S. 38; Vgl. K. v. SEE, Königtum und Staat, S. 17, S. 42 und S. 65 f.
2 Vgl. N. LUND, Dänenreich, S. 173: In Haitabu und Ribe wurden zur Mitte des 9. Jahrhunderts Kirchen gebaut.
3 Vgl. L.E. v. PADBERG, Die Christianisierung Europas, S. 113; Vgl. N. LUND, Dänenreich, S. 173
4 V. SCIOR, Das Eigene und das Fremde, S. 15 - 31: Adam wurde 1066/67 von Erzbischof Adalbert als Domkanoniker aufgenommen und war bald darauf als magister scolarum in Bremen tätig. Wahrscheinlich begann er die Arbeiten an den Gesta 1072, nach dem Tod Adalberts. Tendenziell versuchte Adam stets die Bremer Stellung und das Missionsvorrecht zu legitimieren, da in der Zeit der Entstehung die kirchenhierarchische Position Bremens bereits umstritten war (V. SCIOR, Das Eigene und das Fremde, S. 36). An Adams Authensität ist trotz einiger Unstimmigkeiten, nicht zu zweifeln. Die Schrift selbst ist nicht im Original überliefert, jedoch existieren mehrere, teils divergierende Abschriften.
5 Vgl. M. KAUFHOLD, Europas Norden, S. 54; Vgl. ADAM v. BREMEN, I, 57 - 59
6 Vgl. C. LÜBKE, Elb - und Ostseeslawen, S. 27; Vgl. N. LUND, Dänenreich, S. 173
7 ADAM VON BREMEN, II, 25; Vgl. N. LUND, Dänenreich, S. 168 ff. und S. 175; W. SEEGRÜN, Papsttum, S. 49;
HUBATSCH, Deutschland und Skandinavien, S. 25
8 Vgl. L. v. PADBERG, Christianisierung Europas, S. 114; M.KAUFHOLD, Europas Norden, S. 54 - 55: Vermutlich konnte Harald um 970 die Oberhoheit über Norwegen durchsetzen.
9 Vgl. E. HOFFMANN, Die Salier, S. 240
10 Vgl. N. LUND, Dänenreich, S. 176
11 ADAM von BREMEN II, 27: Als inimicus homo habe Sven, zusammen mit einigen zwangsgetauften Getreuen dem Christentum in Dänemark durch das Vorgehen gegen seinen Vater Harald geschadet. Nach Adam hätten sich die Dänen durch die Erhebung Svens vom Christentum losgesagt. Vermutlich spielte Adam auch auf die Obodriten an, denen es 983 im Bund Sven Gabelbart gelang, sich gegen die ottonische Oberhoheit zu erheben. Vgl. M. KAUFHOLD, Europas Norden, S. 67
12 ADAM von BREMEN, II, 28; ADAM V. BREMEN II, 36: Laut Adam sei Olav Tryggvasson der erste christliche König Norwegens gewesen. Zum Bild Thietmars von Sven und Knut: THIETMAR, VII, 36 - 40
13 Vgl. ADAM v. BREMEN II, 28 - 32, Vgl. THIETMAR, IV, 23 - 25; Vgl. N. LUND, Dänenreich, S. 177; Vgl. W. SEEGRÜN, Papsttum, S. 56
14 Nach SEEGRÜN erfolgte diese Subordination zwischen 1020 - 1023 (Vgl. W. SEEGRÜN, Papsttum, S. 51). Vgl. MAY, Regesten n. 186; Vgl. M. KAUFHOLD, Europas Norden, S. 88: Der Ehestreit des dänischen Königs mit Adalbert wird sein Übriges getan haben Adams Sicht zu prägen.
15 ADAM v. BREMEN II, 40
16 Vgl. M.K. LAWSON, Cnut, S. 20; Vgl. N. LUND, Dänenreich, S. 178f.; Vgl. ENCOMIUM, I, cap. 1- 5, S. 8 - 14
17 ADAM, II, 34; Vgl. THIETMAR, VII, 39; E. HOFFMANN, Die Salier, S.24; Vgl. M.K. LAWSON, Cnut, S.93; Norwegen ging 1015 durch die Eroberung Olav Haraldsons für die Dänen verloren. Vgl. N. LUND, Dänenreich, S. 179
18 K. v. SEE, Königtum und Staat, S. 15; Vgl. M. KAUFHOLD, Europas Norden, S. 64
19 E. HOFFMANN, Die Salier, S. 243
20 Vgl. M. KAUFHOLD, Europas Norden, S. 58 und S. 83; Vgl. A. FORTE, Viking Empires, S. 182: „… by the year 1000 Christianity was dominant in burial customs and pagan symbols, such as the hammer of Thor had been replaced by the christian cross.“
21 M. KAUFHOLD, Europas Norden, S. 57; L.E. v. PADBERG, Christianisierung Europas, S. 119; E. HOFFMANN,
Heilige Könige, S. 60; K.F. KRIEGER, Geschichte Englands, S. 71; A. FORTE, Viking Empires, S. 187: Die Taufe Olav Tryggvassons ging vermutlich mit dem Friedensschluss in England einher.
22 Vgl. J. SANDNES, Germanisches Widerstandsrecht, S. 64 f; Vgl. K. v. SEE, Königtum und Staat, S. 40 f.
23 Vgl. M. KAUFHOLD, Europas Norden, S. 57 - 58 und S. 83; Vgl. A. FORTE, Viking Empires, S. 187 f.; Vgl. W. SEEGRÜN, Papsttum, S. 50
24 Vgl. L.E. v. PADBERG, Christianisierung Europas, S. 120 ff.; Vgl. E. HOFFMANN, Die Salier, S. 242, Vgl. ADAM v. BREMEN II, 38 ; Vgl. W. SEEGRÜN, Papsttum, S. 53
25 Vgl. M.K. LAWSON, Cnut, S. 25 - 27, K.F. KRIEGER, Geschichte Englands, S. 71 ; Vgl. A. FORTE, Viking Empires,
S. 183: Diese Begebenheit zeigt deutlich, dass die Fronten zwischen den skandinavischen Ländern nicht eindeutig gesteckt worden waren. Im Sinne einer Gleichgewichtspolitik, war es durchaus möglich, sich gegen den jeweils mächtigsten der drei Könige zu verbünden. Vgl. THIETMAR, VII 36-37; Vgl. N. LUND, Dänenreich, S. 178f.
26 Vgl. K.F. KRIEGER, Geschichte Englands, S. 71; Vgl. M.K. LAWSON, Cnut, S. 27; Vgl. KEYNES, Wikinger, S. 84
27 Vgl. A. FORTE, Viking Empires, S. 188; Vgl. K.F. KRIEGER, Geschichte Englands, S. 72
28 Vgl. ADAM v. BREMEN II, 51; Vgl. K.F. KRIEGER, Geschichte Englands, S. 72; Vgl. M.K. LAWSON, Cnut, S. 27; Vgl. A. FORTE, Viking Empires, S. 188; Vgl. KEYNES, Wikinger, S. 86
29 Vgl. ADAM v. BREMEN II, 51; Vgl. N. LUND, Dänenreich, S. 181
30 Vgl. M.K. LAWSON, Cnut, S. 27; Vgl. THIETMAR VII, 40
31 Vgl. ADAM v. BREMEN II, 52; Vgl. H. BRESSLAU, Jahrbücher, S. 141; Vgl. N. LUND, Dänenreich, S. 181f.
32 Vgl. ADAM v. BREMEN II, 53; Vgl. K.F. KRIEGER, Geschichte Englands, S. 72, Vgl. A. FORTE, Viking Empires, S. 188
33 Vgl. M.K. LAWSON, Cnut, S. 27; A. FORTE, Viking Empires, S. 192 f., Vgl. THIETMAR, VII 40 - 42; Vgl. KEYNES; Wikinger, S. 86; Vgl. ENCOMIUM, II, cap. 14 - 15, S. 30 - 32
34 Diese vorteilhafte Verbindung sicherte Knut die Loyalität der angelsächsischen Großen. Von seiner ersten Frau Aelfgifu trennte er sich. Die Ehe mit ihr war nicht kirchlich geschlossen worden und hätte Knut in Schwierigkeiten bringen können (K.F.KRIEGER, Geschichte Englands, S. 73). Zudem war seine neue Frau Emma auch die Tochter Richards I. von der Normandie und Schwester Richards II. Seine eigene Schwester Margarete gab er dem Sohn Richards II. Robert I. zur Frau, die von diesem verstoßen wurde. Dazu: T. SCHIEDER, Handbuch der europäischen Geschichte, S. 983; M.K. LAWSON, Cnut, S. 85 ff.; Vgl. ENCOMIUM, II, cap. 16 - 18, S. 32 - 34
35 Vgl. M.K. LAWSON, Cnut, S. 85 ff; Vgl. K.F. KRIEGER, Geschichte Englands, S. 73
36 Vgl. K.F. KRIEGER, Geschichte Englands, S. 73; Vgl. A. FORTE, Viking Empires, S. 194; KEYNES, Wikinger, S. 87
M.K. LAWSON, Cnut, S. 27 und 83; Vgl. T. SCHIEDER, Handbuch der europäischen Geschichte, S. 986: Diese Notsteuer wurde unter Knut in eine ständige Grundsteuer umgewandelt.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist eine Vorschau einer wissenschaftlichen Arbeit über die Christianisierung Norwegens, Schwedens und Dänemarks sowie die Gormiden im frühen und hohen Mittelalter. Es behandelt Knuts II. des Großen Weg zur Herrschaft, die Frage seiner Legitimität, die Eroberung Norwegens und die Beziehungen zwischen den Gormiden, den Ottonen und den Saliern.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Hauptthemen sind: die Christianisierung Skandinaviens, die politische Rolle der Taufe, die Bedeutung des Christentums für die Herrschaftslegitimation, die Beziehungen zwischen Knut II. dem Großen und Konrad II., der Kirchenstreit zwischen Knut und dem Hamburger Erzbischof und die Heiratsstrategien der Herrscherhäuser.
Welche geografischen Regionen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf Skandinavien (Dänemark, Norwegen, Schweden), England und das Heilige Römische Reich (insbesondere die Gebiete unter ottonischer und salischer Herrschaft).
Welche historischen Figuren spielen eine wichtige Rolle in der Arbeit?
Wichtige historische Figuren sind: Gorm der Alte, Harald Blauzahn, Sven Gabelbart, Knut II. der Große, Olav Tryggvasson, Olav der Heilige, Konrad II., Heinrich III., Adam von Bremen, Thietmar von Merseburg und Wipo.
Welche Quellen werden für die Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf schriftliche Quellen wie die Hamburgische Kirchengeschichte Adams von Bremen, die Gesta Chuonradi Wipos und die Chronik Thietmars von Merseburg. Archäologische Funde werden ebenfalls berücksichtigt.
Was wird über die Christianisierung gesagt?
Die Christianisierung wird als ein komplexer Prozess dargestellt, der von politischen und militärischen Interessen der Herrscher begleitet wurde. Die Taufe der Könige und mächtigsten Männer war ein zentrales Integrationsmittel. Das Christentum wurde zur Herrschaftslegitimation genutzt.
Was wird über Knut II. den Großen gesagt?
Knut II. der Große wird als wichtiger Herrscher dargestellt, der England, Dänemark und Norwegen beherrschte. Seine Herrschaft in England war durch eine Ausgleichspolitik zwischen Angelsachsen und Dänen gekennzeichnet. Er heiratete Emma, die Witwe Aethelreds, um seine Herrschaft zu festigen.
Welche Rolle spielte die Kirche in dieser Zeit?
Die Kirche spielte eine wichtige Rolle bei der Christianisierung Skandinaviens und der Herrschaftslegitimation. Der Hamburger Erzbischof hatte eine wichtige Position in der Missionierung des Nordens. Es gab einen Kirchenstreit zwischen Knut II. dem Großen und dem Hamburger Erzbischof.
Was ist die Bedeutung der Ehe in dieser Zeit?
Die Ehe wurde als politisches Instrument genutzt, um Bündnisse zu schmieden und die Herrschaft zu festigen. Knuts Heirat mit Emma und die Heirat seiner Schwester Margarete mit Robert I. von der Normandie sind Beispiele dafür.
Was wird über die Wikinger gesagt?
Die Wikingerzüge wurden im 10. und 11. Jahrhundert zunehmend von politisch motivierten Eroberungen abgelöst. Die Eroberungen unter Sven Gabelbart und Knut dem Großen hatten politische Ziele und standen unter herrschaftssichernden oder herrschaftsausbauenden Prämissen.
- Quote paper
- Alexander Rode (Author), 2009, Knut II. der Große und Konrad II. , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152066