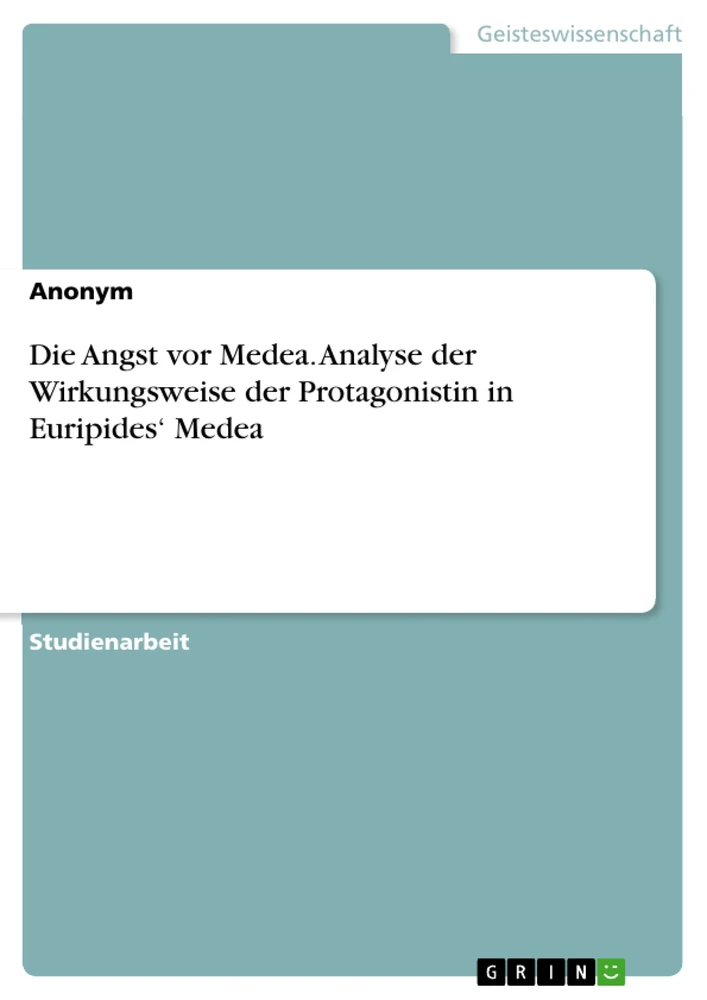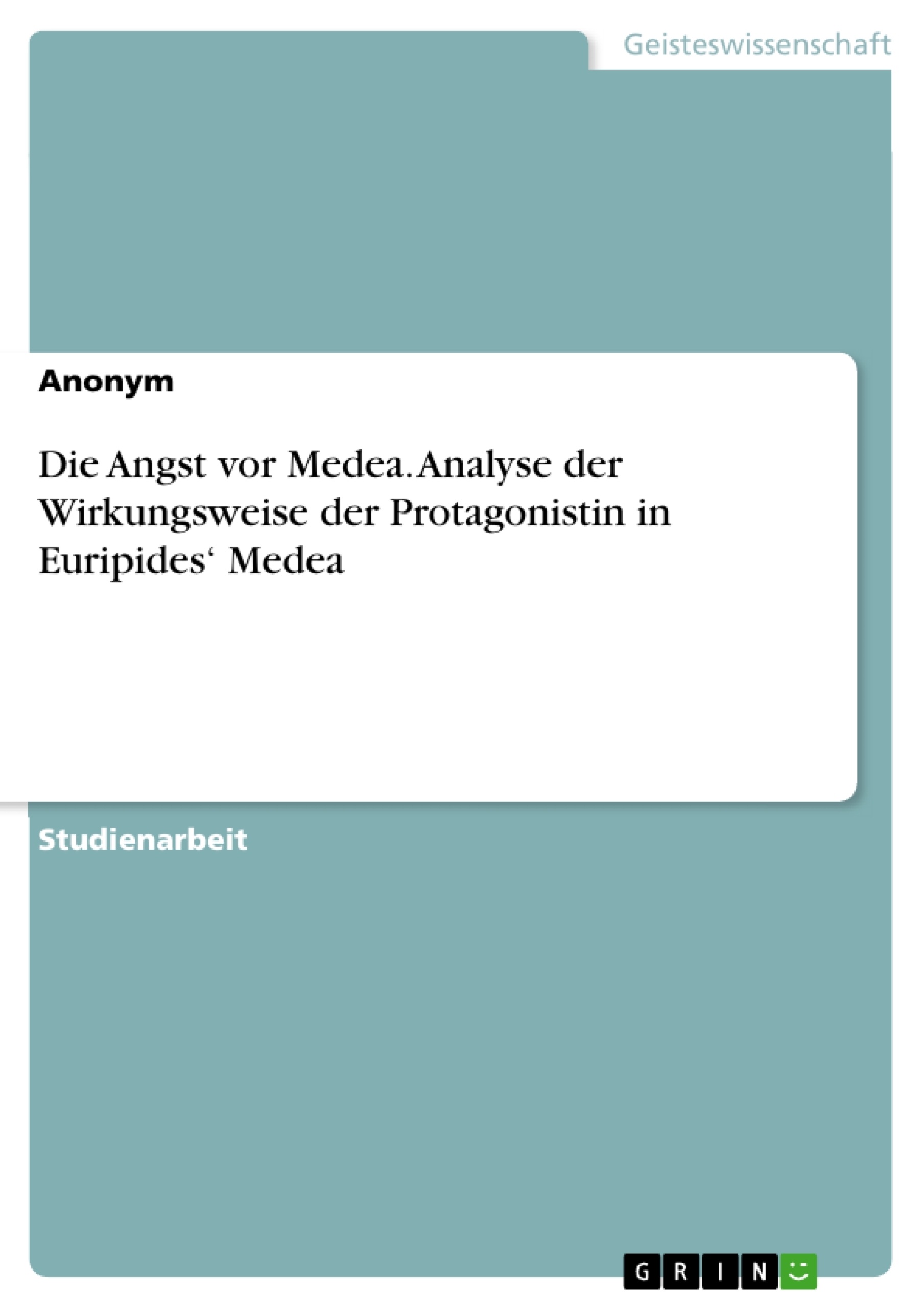Im antiken Griechenland waren dem Gott Dionysos gewidmete Theaterfeste eine beliebte Attraktion. Es bewarben sich drei Dichter, die jeweils eine Tragödie aufführen ließen. 431 v. Chr. gehörte zu diesen Tragödiendichtern auch Euripides, welcher das antike Drama "Medea" vorstellte.
Die Frage, wieso die Figur der Medea so fasziniert, lässt sich unter anderem ihrer auffallenden Stärke und Durchsetzungsfähigkeit zuschreiben. Aber auch die verschiedenen Reaktionen auf den Charakter der Protagonistin sind spannend zu verfolgen. Ob Abneigung und Missbilligung oder Bewunderung und Mitleid – Medea löst seit Jahrhunderten verschiedenste Resonanz aus.
Interessant ist, dass sich eben diese zwiegespaltenen Meinungen ebenfalls bei den Figuren des Dramas wiederfinden lassen. Auch die Furcht vor der Medea ist ein Thema, welches von unterschiedlichsten Gesichtspunkten betrachtet werden kann und viel über den Charakter der Protagonistin, aber auch den der anderen Personen verrät. Anhand einer Analyse der Wirkungsweise Medeas, soll geklärt werden, inwiefern und wieso die Protagonistin für die mitwirkenden Figuren furchteinflößend erscheint.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hauptteil
- 2.1 Medea und die Frauen von Korinth
- 2.1.1 Medeas Kritik an den Geschlechterverhältnissen
- 2.1.2 Weiblichkeitskonzepte
- 2.2 Medea und Kreon
- 2.3 Medea und Jason
- 2.4 Jammer und Schauder in Medea
- 3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Wirkungsweise der Protagonistin Medea in Euripides' gleichnamigem Drama. Ziel ist es zu klären, warum und inwiefern Medea für die anderen Figuren furchteinflößend erscheint. Die Analyse konzentriert sich auf Medeas Interaktion mit anderen Figuren und ihren Einfluss auf deren Handlungen und Entscheidungen.
- Medeas Kritik an den Geschlechterverhältnissen im antiken Griechenland
- Die Rolle des Chores der korinthischen Frauen und deren Reaktion auf Medea
- Medeas rhetorische Fähigkeiten und ihre manipulative Wirkung
- Die Angst und Furcht, die Medea bei anderen Figuren hervorruft
- Die ambivalenten Reaktionen auf Medeas Charakter (Bewunderung und Abscheu)
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das antike Drama "Medea" von Euripides ein und beschreibt den historischen Kontext der Aufführung. Sie hebt die anhaltende Faszination und die kontroversen Reaktionen auf die Figur der Medea hervor, die von Abneigung bis hin zu Bewunderung reichen. Die Arbeit kündigt die Analyse der Wirkungsweise Medeas und die Untersuchung der Gründe für ihre furchteinflößende Wirkung auf andere Figuren an.
2 Hauptteil: Der Hauptteil der Arbeit analysiert Medeas Interaktionen mit verschiedenen Figuren im Drama. Es wird besonders auf das Verhältnis Medeas zu den korinthischen Frauen, Kreon, Jason und den damit verbundenen Konflikten eingegangen. Die Analyse beleuchtet Medeas rhetorische Fähigkeiten und ihre manipulative Wirkung auf die anderen Figuren, sowie die ambivalenten Reaktionen auf ihren Charakter.
2.1 Medea und die Frauen von Korinth: Dieses Kapitel untersucht die Beziehung zwischen Medea und dem Chor der korinthischen Frauen. Es zeigt, wie Medea den Chor geschickt manipuliert und instrumentalisiert, um Unterstützung für ihre Rachepläne zu gewinnen. Die anfängliche Sympathie der Frauen wandelt sich durch Medeas Schilderung ihres Leids und ihrer Kritik an den Geschlechterverhältnissen in Zustimmung zu ihrer Rache. Der Chor fungiert als Spiegel der gesellschaftlichen Moralvorstellungen, aber auch als Empfänger von Medeas rhetorischer Macht.
2.1.1 Medeas Kritik an den Geschlechterverhältnissen: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf Medeas feministische Kritik an den ungerechten Geschlechterverhältnissen im antiken Griechenland. Medea prangert die Unterdrückung von Frauen an, ihre fehlende Selbstbestimmung in Bezug auf Körper, Ehe und gesellschaftliche Teilhabe. Ihr Vergleich des Krieges mit der Geburt unterstreicht ihre Sehnsucht nach Freiheit und Selbstverwirklichung, die ihr in der patriarchalen Gesellschaft verwehrt wird.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der Analyse im "Medea"-Drama von Euripides?
Die Analyse konzentriert sich auf die Wirkungsweise der Protagonistin Medea und untersucht, warum und inwiefern sie für andere Figuren im Drama furchteinflößend erscheint. Die Arbeit analysiert Medeas Interaktion mit anderen Figuren und ihren Einfluss auf deren Handlungen und Entscheidungen.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse behandelt folgende Themenschwerpunkte:
- Medeas Kritik an den Geschlechterverhältnissen im antiken Griechenland
- Die Rolle des Chores der korinthischen Frauen und deren Reaktion auf Medea
- Medeas rhetorische Fähigkeiten und ihre manipulative Wirkung
- Die Angst und Furcht, die Medea bei anderen Figuren hervorruft
- Die ambivalenten Reaktionen auf Medeas Charakter (Bewunderung und Abscheu)
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit enthält folgende Kapitel:
- Einleitung
- Hauptteil
- Medea und die Frauen von Korinth
- Medeas Kritik an den Geschlechterverhältnissen
- Weiblichkeitskonzepte
- Medea und Kreon
- Medea und Jason
- Jammer und Schauder in Medea
- Fazit
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das antike Drama "Medea" von Euripides ein und beschreibt den historischen Kontext der Aufführung. Sie hebt die anhaltende Faszination und die kontroversen Reaktionen auf die Figur der Medea hervor und kündigt die Analyse der Wirkungsweise Medeas an.
Worauf konzentriert sich der Hauptteil der Arbeit?
Der Hauptteil analysiert Medeas Interaktionen mit verschiedenen Figuren im Drama, insbesondere das Verhältnis zu den korinthischen Frauen, Kreon und Jason. Es beleuchtet Medeas rhetorische Fähigkeiten, ihre manipulative Wirkung und die ambivalenten Reaktionen auf ihren Charakter.
Was untersucht das Kapitel "Medea und die Frauen von Korinth"?
Dieses Kapitel untersucht die Beziehung zwischen Medea und dem Chor der korinthischen Frauen, wie Medea den Chor manipuliert, um Unterstützung für ihre Rachepläne zu gewinnen, und wie sich die Sympathie der Frauen durch Medeas Schilderung ihres Leids in Zustimmung zu ihrer Rache wandelt.
Was wird im Abschnitt "Medeas Kritik an den Geschlechterverhältnissen" analysiert?
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf Medeas feministische Kritik an den ungerechten Geschlechterverhältnissen im antiken Griechenland. Medea prangert die Unterdrückung von Frauen und ihre fehlende Selbstbestimmung an.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Die Angst vor Medea. Analyse der Wirkungsweise der Protagonistin in Euripides‘ Medea, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1520299