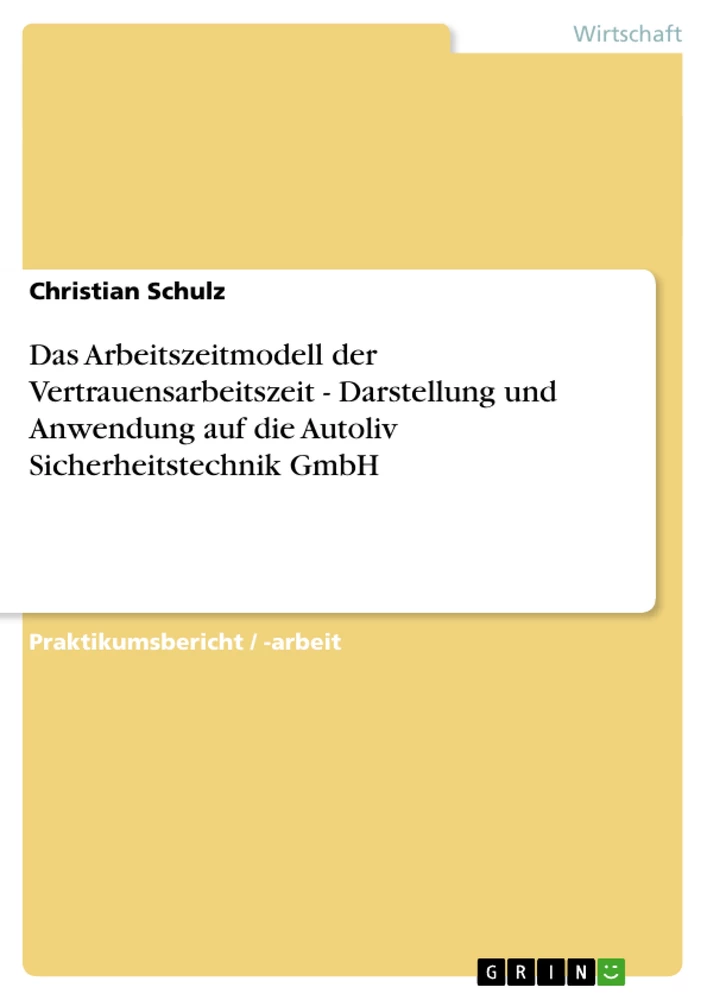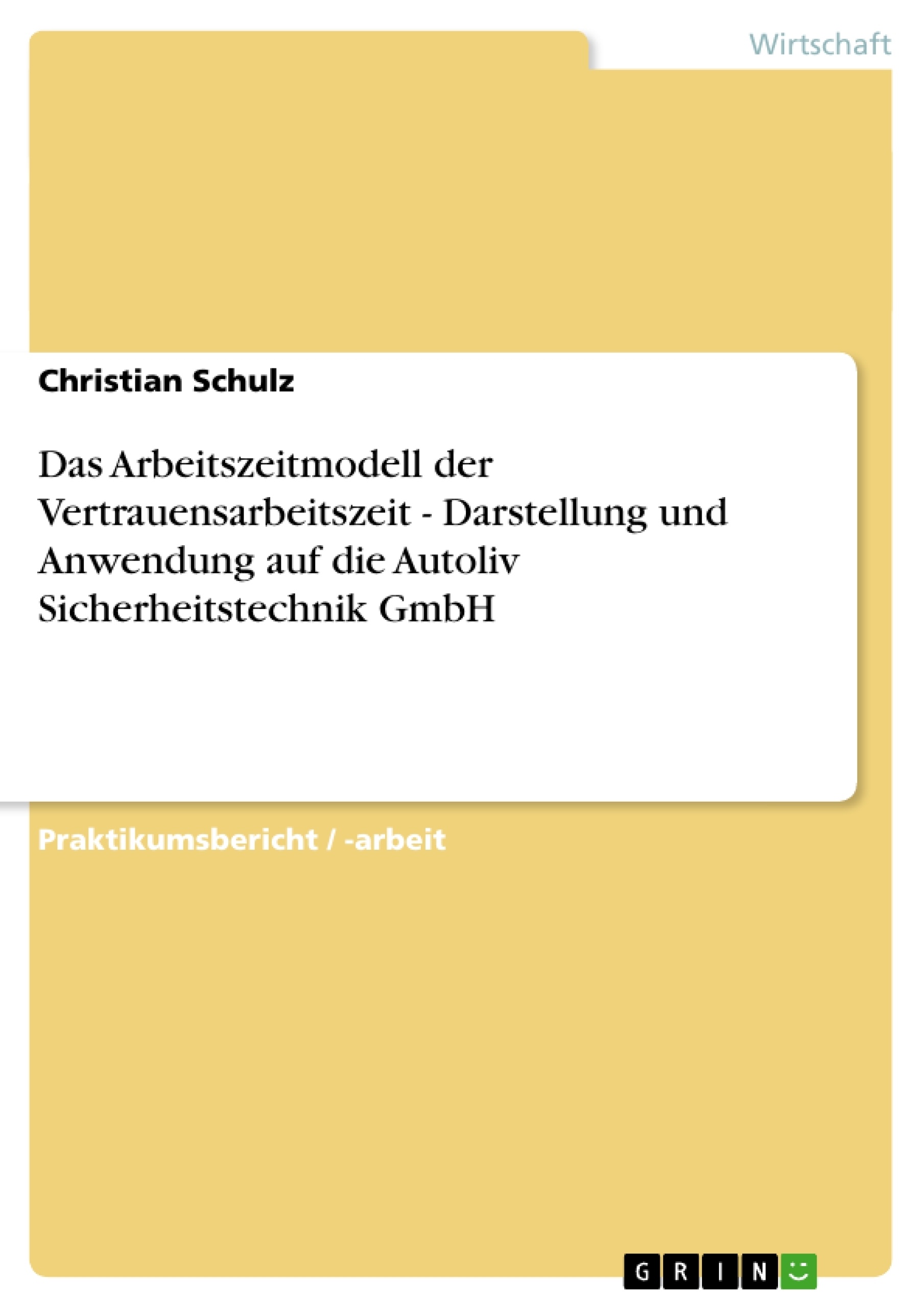Zielstellung dieser Arbeit
Die Zielstellung dieser Arbeit ist es, das Modell Vertrauensarbeitszeit zu untersuchen, es im Kontext bisheriger flexibler Arbeitszeitmodelle zu bewerten, es auf den Führungskreis der Autoliv Sicherheitstechnik GmbH am Standort Döbeln zu übertragen und Handlungsempfehlungen für die konkrete Ausgestaltung einer Vertrauensarbeitszeitregelung zu geben.
Aufbau der Arbeit
Als Voraussetzung hierfür soll das Modell zunächst definiert und gegenüber anderen flexiblen Arbeitszeitmodellen abgegrenzt werden um seinen hohen Grad an Flexibilität deutlich zu machen und eine Diskussionsgrundlage zu schaffen. Danach soll das Modell detailliert so dargestellt werden, wie es derzeit in vorherrschender Literatur existiert.
Hierzu werden die Philosophie der Vertrauensarbeitszeit anhand von Charaktermerkmalen erläutert, ihre Chancen den Gefahren gegenübergestellt und Erfolgsfaktoren für das Gelingen eines Vertrauensarbeitszeitsystems in Form von Soll- Elementen betrachtet.
Im Anschluss an diese Darstellung soll die Firma Autoliv Sicherheitstechnik vorgestellt werden. Vor allem werden der Standort Döbeln betrachtet und dessen förderliche und hemmende Faktoren in Bezug auf die Einführung von Vertrauensarbeitszeit im Führungskreis aufgezeigt um daraufhin Handlungsempfehlungen zur Gestaltung des Vertrauensarbeitszeitsystems geben zu können.
Abschließend soll das Ergebnis der Arbeit zusammengefasst und ein kurzer Ausblick mit Hinweis auf ggf. vorhandenen Forschungsbedarf gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Diskussion und Stellenwert in Theorie und Praxis
- 1.2 Zielstellung dieser Arbeit
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Betrachtung der Vertrauensarbeitszeit
- 2.1 Definition(en) der Vertrauensarbeitszeit
- 2.2 Abgrenzung gegenüber anderen flexiblen Arbeitszeitmodellen
- 2.3 Merkmale der Vertrauensarbeitszeit
- 2.3.1 Eigenverantwortliche Bestimmung der Arbeitszeit
- 2.3.2 Unterscheidung zwischen Anwesenheits- und Arbeitszeit
- 2.3.3 Verzicht auf arbeitgeberseitige Kontrolle der Arbeitszeit
- 2.3.4 Neuartige Führungsinstrumente
- 2.4 Vorteile der Vertrauensarbeitszeit
- 2.4.1 Vorteile aus Arbeitgebersicht
- 2.4.2 Vorteile aus Arbeitnehmersicht
- 2.5 Nachteile der Vertrauensarbeitszeit
- 2.5.1 Nachteile aus Arbeitgebersicht
- 2.5.2 Nachteile aus Arbeitnehmersicht
- 2.6 Soll- Elemente einer Vertrauensarbeitszeitregelung
- 2.6.1 Ziele und Grundsätze
- 2.6.2 Begleitende Maßnahmen
- 2.6.3 Geltungsbereich
- 2.6.4 Grundverteilung der Arbeitszeit
- 2.6.5 Definition von Arbeitszeit und Nichtarbeitszeit
- 2.6.6 Verfügbarkeit
- 2.6.7 Umgang mit Überlastsituationen
- 2.6.8 Aufzeichnungspflicht laut Arbeitszeitgesetz
- 2.6.9 Geltungsdauer und Kündigungsmöglichkeiten
- 2.6.10 Zusätzliche Elemente
- 3. Anwendung des Modells auf die Autoliv Sicherheitstechnik GmbH
- 3.1 Darstellung des Konzerns Autoliv sowie des Unternehmens
- 3.2 Rahmenbedingungen und Anwendungsmöglichkeiten
- 3.2.1 Gestaltende Faktoren
- 3.2.2 Zuschnitt des Modells auf lokale Gegebenheiten / Handlungsempfehlungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Modell der Vertrauensarbeitszeit. Ziel ist die Bewertung im Kontext flexibler Arbeitszeitmodelle und die Übertragung auf die Autoliv Sicherheitstechnik GmbH. Die Arbeit analysiert die Vor- und Nachteile des Modells aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerperspektive. Die praktische Anwendbarkeit und die Gestaltung von Rahmenbedingungen werden ebenfalls beleuchtet.
- Definition und Abgrenzung der Vertrauensarbeitszeit
- Vorteile und Nachteile aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerperspektive
- Soll-Elemente einer Vertrauensarbeitszeitregelung
- Anwendbarkeit auf die Autoliv Sicherheitstechnik GmbH
- Rahmenbedingungen und Handlungsempfehlungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Vertrauensarbeitszeit ein und beleuchtet die kontroverse Diskussion um deren Stellenwert in Theorie und Praxis. Es zeigt die unterschiedlichen Auffassungen zum Modell und die Notwendigkeit einer umfassenderen Betrachtung auf. Die Zielsetzung der Arbeit und der Aufbau werden klar definiert. Die Einleitung unterstreicht die Bedeutung des Themas angesichts der zunehmenden Flexibilisierung von Arbeitszeitmodellen und der Notwendigkeit, ein einheitlicheres Verständnis zu schaffen.
2. Betrachtung der Vertrauensarbeitszeit: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der Vertrauensarbeitszeit. Es definiert das Modell, grenzt es von anderen flexiblen Arbeitszeitmodellen ab und beschreibt seine charakteristischen Merkmale, wie die eigenverantwortliche Arbeitszeitgestaltung, die Unterscheidung zwischen Anwesenheits- und Arbeitszeit und den Verzicht auf eine direkte Kontrolle durch den Arbeitgeber. Die Vor- und Nachteile aus Sicht von Arbeitgebern und Arbeitnehmern werden ausführlich diskutiert, gefolgt von einer detaillierten Beschreibung der idealen Elemente einer Vertrauensarbeitszeitregelung, inklusive der Aspekte Ziele, Grundsätze, Begleitmaßnahmen, Geltungsbereich, Arbeitszeitdefinition, Verfügbarkeit, Umgang mit Überlastung, Aufzeichnungspflicht, Geltungsdauer und Kündigungsmöglichkeiten. Das Kapitel legt den Fokus auf die Herausforderungen und Chancen, die mit der Implementierung verbunden sind.
3. Anwendung des Modells auf die Autoliv Sicherheitstechnik GmbH: Das Kapitel wendet die theoretischen Erkenntnisse auf die Autoliv Sicherheitstechnik GmbH an. Es beschreibt zunächst den Konzern und das Unternehmen selbst, bevor es die Rahmenbedingungen und Anwendungsmöglichkeiten der Vertrauensarbeitszeit in diesem spezifischen Kontext untersucht. Besondere Bedeutung kommt den gestaltenden Faktoren und den konkreten Handlungsempfehlungen zu, die für eine erfolgreiche Implementierung des Modells in diesem Unternehmen notwendig sind. Die Analyse konzentriert sich auf die Übertragbarkeit des Modells und die notwendigen Anpassungen an die lokalen Gegebenheiten.
Schlüsselwörter
Vertrauensarbeitszeit, flexible Arbeitszeitmodelle, Arbeitszeitgestaltung, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Vor- und Nachteile, Autoliv Sicherheitstechnik GmbH, Führung, Implementierung, Rahmenbedingungen, Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Vertrauensarbeitszeit bei Autoliv
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Modell der Vertrauensarbeitszeit umfassend. Sie bewertet es im Kontext flexibler Arbeitszeitmodelle und analysiert seine Übertragbarkeit auf die Autoliv Sicherheitstechnik GmbH. Die Analyse umfasst Vor- und Nachteile aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerperspektive sowie die praktische Anwendbarkeit und Gestaltung der Rahmenbedingungen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Definition und Abgrenzung der Vertrauensarbeitszeit, Vorteile und Nachteile aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerperspektive, Soll-Elemente einer Vertrauensarbeitszeitregelung, Anwendbarkeit auf die Autoliv Sicherheitstechnik GmbH, sowie die relevanten Rahmenbedingungen und Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Implementierung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und beschreibt die Zielsetzung. Kapitel 2 analysiert die Vertrauensarbeitszeit detailliert, inklusive Definition, Abgrenzung zu anderen Modellen, Merkmalen, Vor- und Nachteilen und Soll-Elementen einer Regelung. Kapitel 3 wendet das Modell auf die Autoliv Sicherheitstechnik GmbH an, betrachtet die Rahmenbedingungen und gibt Handlungsempfehlungen.
Welche Vorteile bietet die Vertrauensarbeitszeit laut der Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet die Vorteile der Vertrauensarbeitszeit sowohl aus Arbeitgeber- als auch aus Arbeitnehmerperspektive. Für Arbeitgeber können beispielsweise gesteigerte Produktivität und Mitarbeitermotivation genannt werden. Arbeitnehmer profitieren von größerer Flexibilität und Autonomie bei der Arbeitszeitgestaltung.
Welche Nachteile werden in Bezug auf die Vertrauensarbeitszeit genannt?
Die Arbeit benennt auch Nachteile. Für Arbeitgeber besteht beispielsweise das Risiko von Überstunden oder einer schwierigen Kontrolle der Arbeitsleistung. Arbeitnehmer könnten unter dem Druck stehen, immer erreichbar zu sein oder Schwierigkeiten mit der Selbstorganisation haben.
Welche Kernpunkte sollte eine Vertrauensarbeitszeitregelung enthalten?
Die Arbeit beschreibt die Soll-Elemente einer effektiven Vertrauensarbeitszeitregelung. Hierzu gehören Ziele und Grundsätze, Begleitmaßnahmen, der Geltungsbereich, die Grundverteilung der Arbeitszeit, die Definition von Arbeits- und Nichtarbeitszeit, Verfügbarkeit, der Umgang mit Überlastsituationen, die Aufzeichnungspflicht, die Geltungsdauer und Kündigungsmöglichkeiten sowie zusätzliche, individuelle Elemente.
Wie wird die Vertrauensarbeitszeit auf die Autoliv Sicherheitstechnik GmbH angewendet?
Kapitel 3 untersucht die Übertragbarkeit des Vertrauensarbeitszeitmodells auf die Autoliv Sicherheitstechnik GmbH. Es betrachtet die spezifischen Rahmenbedingungen des Unternehmens und gibt konkrete Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Implementierung, wobei die Anpassung an die lokalen Gegebenheiten im Vordergrund steht.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Vertrauensarbeitszeit, flexible Arbeitszeitmodelle, Arbeitszeitgestaltung, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Vor- und Nachteile, Autoliv Sicherheitstechnik GmbH, Führung, Implementierung, Rahmenbedingungen und Handlungsempfehlungen.
- Quote paper
- Christian Schulz (Author), 2006, Das Arbeitszeitmodell der Vertrauensarbeitszeit - Darstellung und Anwendung auf die Autoliv Sicherheitstechnik GmbH, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152020