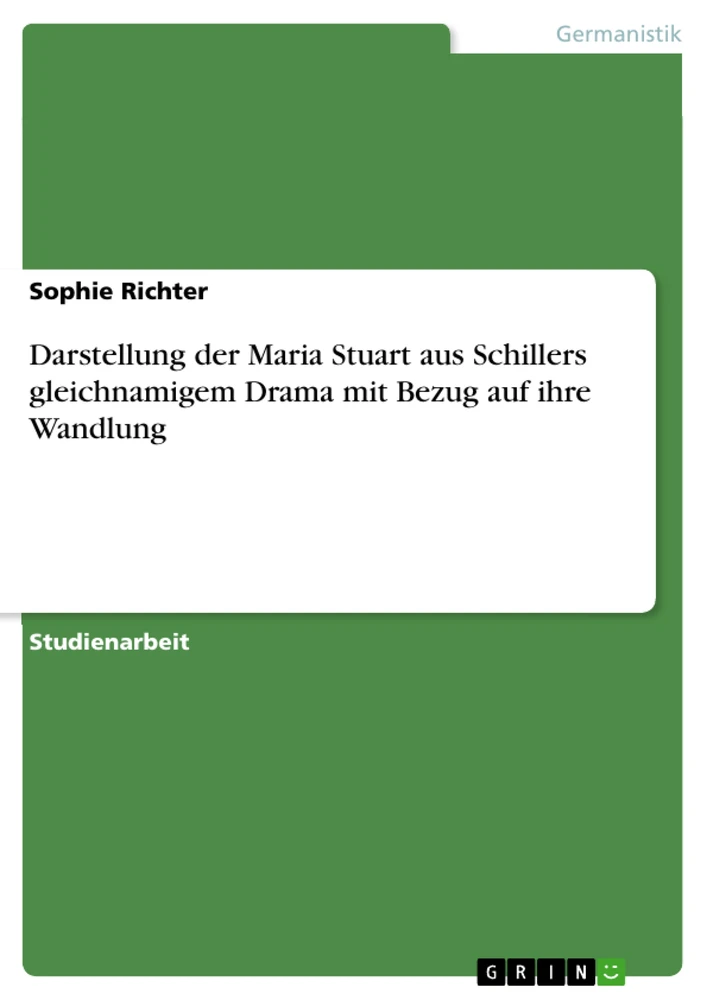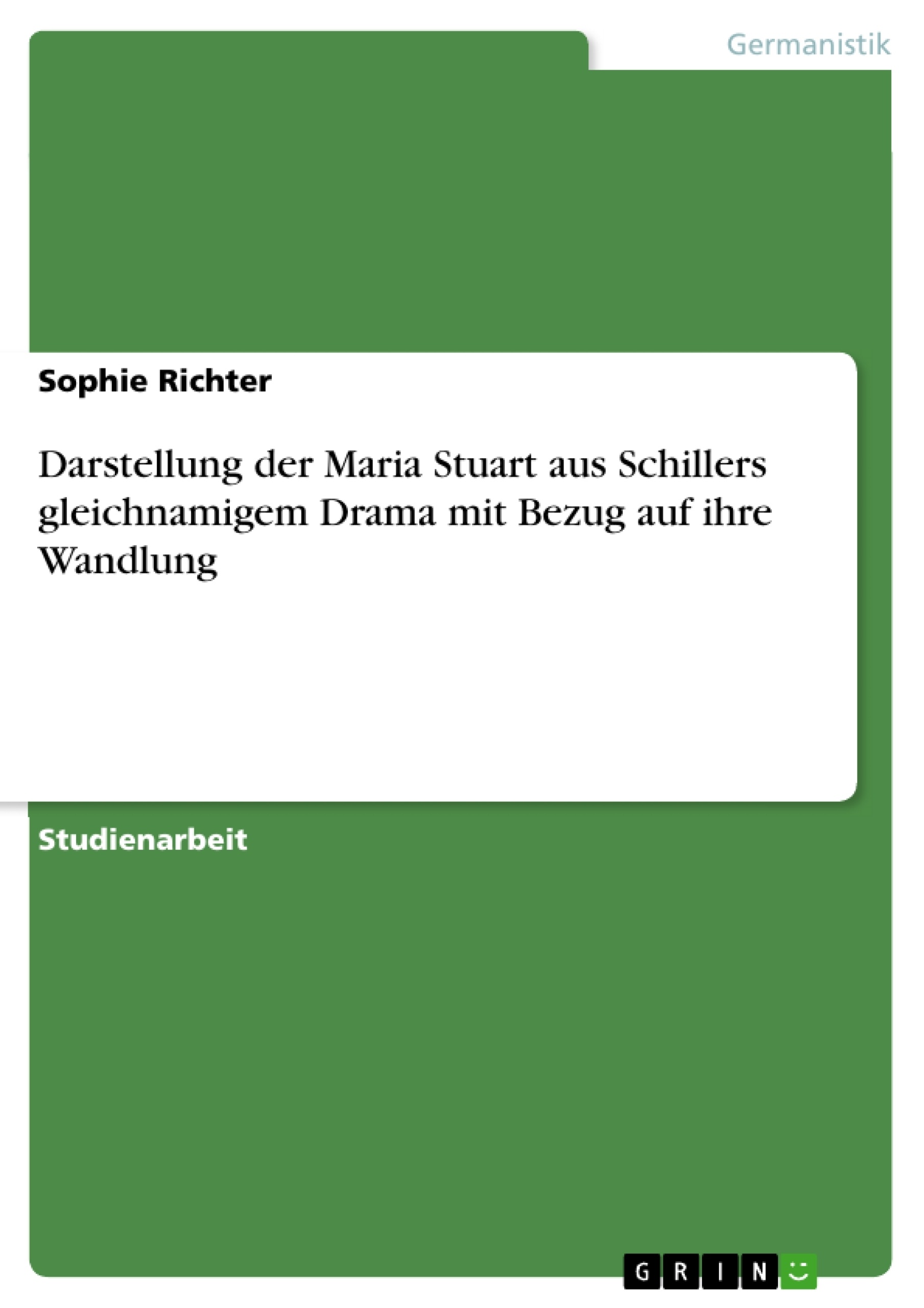Das am 14. Juni 1800 uraufgeführte und Ostern 1801 veröffentlichte Drama Maria Stuart von Friedrich Schiller, ein im Titel als historisch ausgewiesenes Stück, ist paradoxerweise laut Schiller aus einem „frei phantasierten, nicht historischen“, sondern „bloß leidenschaftlichen und menschlichen Stoff“ entstanden. Auch während seiner Vorstudien zu dem Drama dringt aus seinen Briefen die Lust an dem Dramaturgisch-Formalen des Themas durch, die die geschichtlichen Fakten an den Rand drängen. Auch, dass die als reizvoll empfundenen Darstellungen, dazu dienen, den Blick auf die Charaktere der zentralen Figuren zu richten, verrät ein Brief vom 11. Juni 1799 an Goethe:
„Die Idee, aus diesem Stoff ein Drama zu machen, gefällt mir nicht übel. Er hat schon den wesentlichen Vortheil bei sich, daß die Handlung in einen thatvollen Moment concentriert ist und zwischen Furcht und Hoffnung rasch zum Ende eilen muß. Auch sind vortreffliche dramatische Charaktere darinn schon von der Geschichte hergegeben.“
Später formuliert er sein Ansinnen noch deutlicher und beabsichtigt, die Hauptfiguren zwar aus dem geschichtlichen Kontext zu entnehmen, sie aber dennoch ausschließlich über das Menschlich-Personenhafte darzustellen. Die Freiheit der Fantasie soll über die Geschichte gestellt werden. Trotzdem will Schiller sich an allem Brauchbarem aus der Geschichte bedienen:
„Ich fange schon jetzt an, bei der Ausführung, mich von der eigentlich tragischen Qualität meines Stoffs immer mehr zu überzeugen, und darunter gehört besonders, daß man die Catastrophe gleich in den ersten Scenen sieht, und indem die Handlung des Stücks sich davon wegzubewegen scheint, ihr immer näher und näher geführt wird. An der Furcht des Aristoteles fehlt es also nicht, und das Mitleid wird sich auch schon finden.
Meine Maria wird keine weiche Stimmung erregen, es ist meine Absicht nicht, ich will sie immer als ein physisches Wesen halten, und das pathetische muß mehr eine allgemeine tiefe Rührung als ein persönlich und individuelles Mitgefühl seyn. Sie empfindet und erregt keine Zärtlichkeit, ihr Schicksal ist nur, heftige Paßionen zu erfahren und zu entzünden. Bloß die Amme fühlt Zärtlichkeit für sie.“
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- ELEMENTE POLITISCHEN HANDELNS IN DER FIGUR MARIA STUART.
- DIE BEDEUTUNG DES RELIGIÖSEN MOTIVS FÜR SCHILLERS MARIA STUART
- DIE „SCHÖNE SEELE“ IN DER FIGUR DER MARIA STUART.
- WANDLUNG ALS ERWECKUNG STATT ALS ENTWICKLUNG.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse der Figur Maria Stuart in Schillers gleichnamigem Drama. Im Fokus steht die Untersuchung der Wandlung des Charakters und die Rolle politischer Handlungsmotive in der Geschichte der beiden Königinnen.
- Die politische Dimension des Dramas
- Die Konfrontation von Rolle und Individualität
- Die Rolle des religiösen Motivs in Schillers Maria Stuart
- Die Darstellung der Wandlung des Charakters von Maria Stuart
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit Schillers Inszenierung von Maria Stuart als Drama, das zwar historische Elemente aufgreift, jedoch in erster Linie auf fiktiven Motiven basiert. Im Fokus stehen die Dramaturgie und die charakterlichen Besonderheiten der Figuren.
Im zweiten Kapitel wird die Frage beleuchtet, inwieweit die Figuren des Dramas, insbesondere Maria Stuart, von politischen Handlungsmustern beeinflusst sind. Es wird untersucht, wie die politischen Rollenbilder der beiden Königinnen mit ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen kollidieren.
Schlüsselwörter
Schiller, Maria Stuart, Drama, politische Handlung, Rolle und Individualität, religiöses Motiv, Wandlung, Charakteranalyse, Elisabeth, Leicester, Protestantismus, Katholizismus.
- Quote paper
- Sophie Richter (Author), 2009, Darstellung der Maria Stuart aus Schillers gleichnamigem Drama mit Bezug auf ihre Wandlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151877