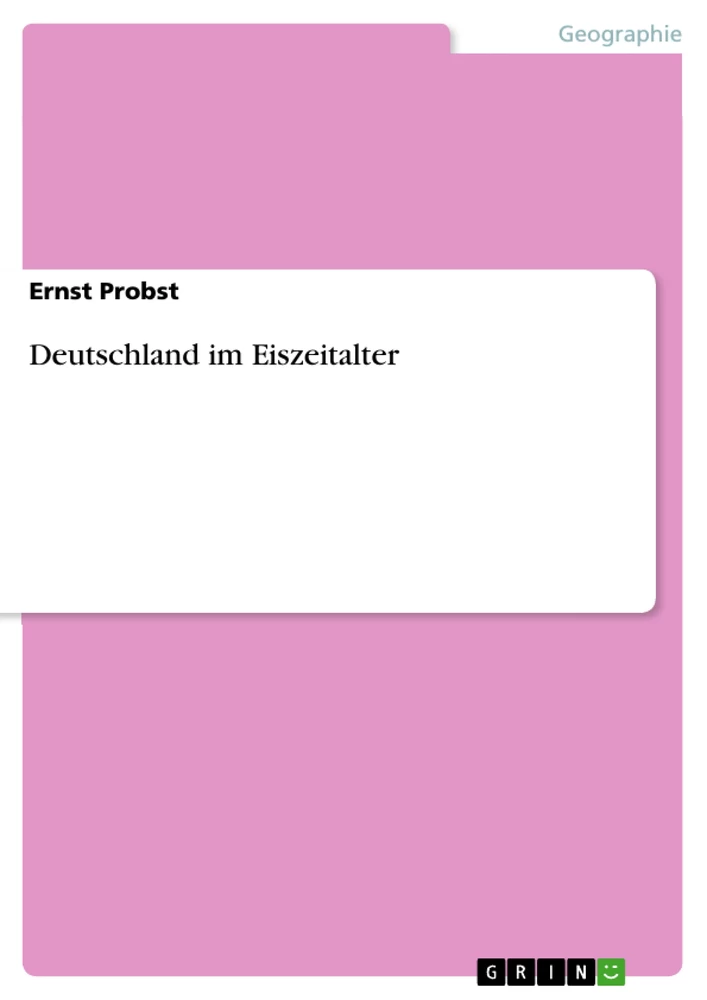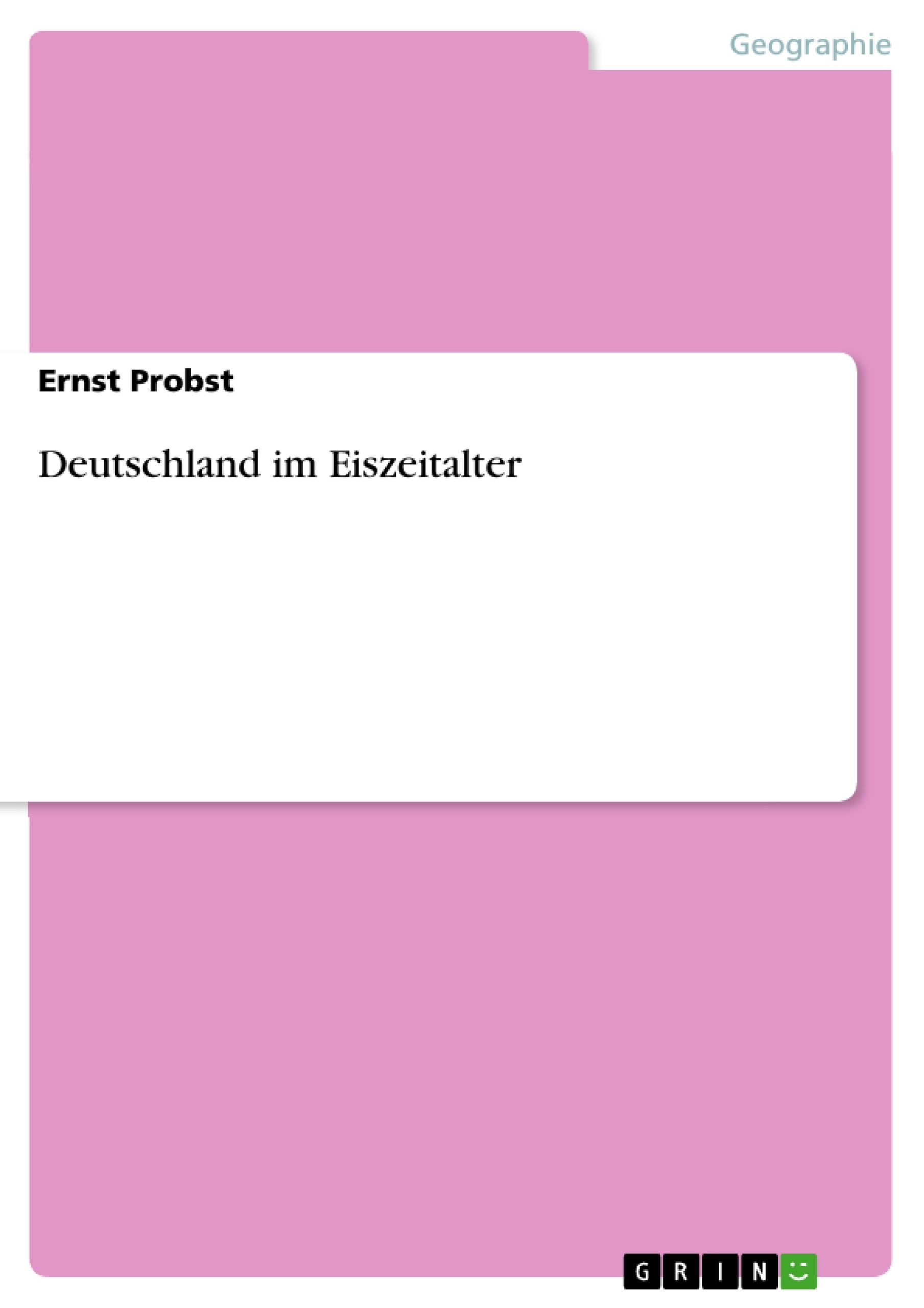Das Taschenbuch „Deutschland im Eiszeitalter“ des Wiesbadener Wissenschaftsautors Ernst Probst schildert den wechselvollen Verlauf der von starken Klimaschwankungen geprägten Epoche der Erdgeschichte vor etwa 2,6 Millionen bis 11.700 Jahren. In diesem Zeitabschnitt, der Eiszeitalter oder Pleistozän genannt wird, gab es Warmzeiten, in denen zwischen Nordseeküste und Alpenrand ähnliche Verhältnisse wie heute in Afrika herrschten. Andererseits rückten in Eiszeiten die Gletscher aus dem Norden bis in die Gegend von Dresden, Erfurt und Recklinghausen sowie aus dem Süden bis Biberach an der Riss, Fürstenfeldbruck und Burghausen an der Salzach vor und begruben die Landschaft unter einem dicken Eispanzer. Während der Warmphasen schwammen Flusspferde im Rhein und in anderen Flüssen. Dagegen lebten in Kaltphasen zottelige Mammute, Fellnashörner und Moschusochsen auf dem Festland. Im Eiszeitalter existierten zu unterschiedlichen Zeiten die „Heidelberg-Menschen“, Neandertaler und ersten anatomisch modernen Menschen. Aus der Feder von Ernst Probst stammen auch die Taschenbücher „Rekorde der Urzeit“, „Rekorde der Urmenschen“, „Der Ur-Rhein“, „Höhlenlöwen“, „Der Mosbacher Löwe“, Säbelzahnkatzen“ und „Der Höhlenbär“.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort: Gletscher bis Dresden und Fürstenfeldbruck
- Deutschland im Eiszeitalter
- Die Prätegelen-Kaltzeit und die Biber-Eiszeiten
- Die Tegelen-Warmzeit
- Die Eburon-Kaltzeit und die Donau-Kaltzeiten
- Die Waal-Warmzeit
- Das Bavelium
- Die Menap-Kaltzeit und die Günz-Eiszeit
- Der Cromer-Komplex
- Die Elster- und die Mindel-Eiszeit
- Die Holstein-Warmzeit
- Die Saale- und die Riss-Eiszeit
- Die Eem-Warmzeit
- Die Weichsel- und die Würm-Eiszeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Werk verfolgt das Ziel, den Verlauf der Eiszeit in Deutschland vor etwa 2,6 Millionen bis 11.700 Jahren in verständlicher Form darzustellen. Es beleuchtet die wechselvollen Klimabedingungen und deren Einfluss auf die Flora und Fauna dieser Epoche. Der Fokus liegt auf der Erläuterung der verschiedenen Kalt- und Warmzeiten sowie deren Auswirkungen auf die damalige Tier- und Menschenwelt.
- Die Gliederung des Quartärs und die verschiedenen Kalt- und Warmzeiten
- Die Auswirkungen der Klimaveränderungen auf die Tierwelt Deutschlands
- Die Entwicklung der menschlichen Besiedlung im Eiszeitalter
- Wichtige Fundstätten und ihre Bedeutung für die Forschung
- Die Geologie und Paläontologie der Eiszeit in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Gletscher bis Dresden und Fürstenfeldbruck: Das Vorwort gibt einen knappen Überblick über das Buch "Deutschland im Eiszeitalter" und beschreibt die starken Klimaschwankungen des Pleistozäns, mit Warmzeiten, in denen die Landschaft afrikanischen Verhältnissen glich, und Eiszeiten, in denen Gletscher bis weit in das heutige Deutschland vordrangen. Es hebt die Tierwelt der jeweiligen Phasen hervor und erwähnt weitere Werke des Autors zu verwandten Themen.
Deutschland im Eiszeitalter: Dieses Kapitel stellt das Quartär und seine Epochen Pleistozän und Holozän vor und würdigt die Beiträge deutscher Wissenschaftler zu dessen Erforschung. Es beschreibt die verschiedenen Gliederungen der Eiszeiten und Warmzeiten (nach Alpenflüssen wie Günz, Mindel, Riss und Würm, und nach norddeutschen Flüssen wie Elster, Saale und Weichsel) und erklärt den Unterschied zwischen Kaltzeiten und Eiszeiten. Das Kapitel betont die Unsicherheiten und die unterschiedlichen Gliederungsvorschläge in der Fachliteratur.
Die Prätegelen-Kaltzeit und die Biber-Eiszeiten: Dieses Kapitel behandelt die älteste Phase des Eiszeitalters, die Prätegelen-Kaltzeit, charakterisiert durch trockene Bedingungen und das Fehlen von Gletschervorstößen in Norddeutschland. Der Nachweis der Klimaverschlechterung durch niederländische Wissenschaftler wird erläutert, ebenso wie die zeitgleich stattfindenden Biber-Eiszeiten im Süden Deutschlands, die durch Gletschervorstöße gekennzeichnet waren. Die magnetischen Eigenschaften der Gesteine aus dieser Zeit (Gauss- und Matuyama-Epoche) werden ebenfalls erklärt.
Die Tegelen-Warmzeit: Die Tegelen-Warmzeit wird als Periode der Klimaverbesserung beschrieben, die zum Wachstum von Wäldern führte. Die Einführung des Begriffs "Tegelen-Warmzeit" durch den niederländischen Paläontologen Eugène Dubois wird erwähnt, und der Fortbestand der umgekehrt magnetisierten Gesteine (Matuyama-Epoche) während dieser Warmzeit wird hervorgehoben.
Die Eburon-Kaltzeit und die Donau-Eiszeiten: Das Kapitel beschreibt die Eburon-Kaltzeit im Norden und die zeitlich vergleichbaren Donau-Eiszeiten im Süden Deutschlands. Es erklärt den Nachweis der Eburon-Kaltzeit durch den Rückgang wärmeliebender Pflanzen und die Entdeckung der Donau-Eiszeiten durch Bartholomäus Eberl. Die Ausdehnung der Gletscher während der Donau-Eiszeiten wird ebenfalls thematisiert.
Die Waal-Warmzeit: Dieses Kapitel behandelt die Waal-Warmzeit (auch Waal-Interglazial), beschrieben durch Waldo H. Zagwijn. Es thematisiert die erneute Klimaverbesserung und den wiederauflebenden Vulkanismus in der Eifel. Die magnetische Umkehrung der Gesteine (Matuyama-Epoche) während dieser Warmzeit wird erneut erwähnt.
Das Bavelium: Das Kapitel beschreibt den Bavelium-Komplex, inklusive dem Jaramillo-Event, einer Periode normaler Magnetisierung der Gesteine innerhalb der Matuyama-Epoche. Der Fokus liegt auf den reichen Funden von Untermaßfeld, Thüringen, die faszinierende Einblicke in die Tierwelt des Bavelium bieten und die Bedeutung dieser Fundstelle für die europäische Paläontologie hervorheben. Der vorgeschlagene Begriff „Epi-Villafranchium“ durch Ralf-Dietrich Kahlke wird ebenfalls erwähnt.
Die Menap-Kaltzeit und die Günz-Eiszeit: Dieses Kapitel beschreibt die Menap-Kaltzeit im Norden, gekennzeichnet durch weniger extreme Temperaturen als spätere Eiszeiten. Der Fokus liegt auf dem Verschwinden wärmeliebender Pflanzen und der Verarmung der mitteleuropäischen Flora im Vergleich zu Nordamerika und Ostasien. Die zeitgleiche Günz-Eiszeit im Süden, benannt nach dem Fluss Günz, wird beschrieben, inklusive der Ausdehnung der Gletscher.
Der Cromer-Komplex: Das Kapitel beschreibt den Cromer-Komplex mit seinen wechselnden milden und kühlen Phasen und unterteilt ihn in Warm- und Kaltzeiten. Es erklärt die Matuyama/Brunhes-Grenze als Möglichkeit zur Datierung von Ablagerungen anhand der Magnetisierung der Gesteine. Der Zusammenhang zwischen Vulkanismus und Warmzeiten wird erörtert, ebenso wie die Tier- und Pflanzenwelt des Cromer und bedeutende Fundstellen wie die Mosbach-Sande.
Die Elster- und die Mindel-Eiszeit: Das Kapitel beschreibt die Elster-Eiszeit im Norden und die vermutlich gleichzeitige Mindel-Eiszeit im Süden. Es beschreibt den Vorstoß der skandinavischen Gletscher und den Wechsel der Tierwelt von wärmeliebenden zu kälteangepassten Arten. Die Ausdehnung der Gletscher während der Mindel-Eiszeit wird detailliert beschrieben, und die Diskussion über den Elster-Komplex (mit Elster-I- und Elster-II-Kaltzeit) wird einbezogen.
Die Holstein-Warmzeit: Das Kapitel beschreibt die Holstein-Warmzeit mit ihrem milden Klima, das das Vorkommen von wärmeliebenden Pflanzen und Tieren ermöglichte, und bedeutende Fundstellen wie Steinheim an der Murr und das Heppenloch. Die Diskussion über den Holstein-Komplex (mit mehreren Warm- und Kaltzeiten) und die Bedeutung von Bilzingsleben und Steinheim für die Erforschung des frühen Menschen wird einbezogen.
Die Saale- und die Riss-Eiszeit: Das Kapitel behandelt die Saale-Eiszeit im Norden, mit ihren verschiedenen Vorstößen und Rückzügen des Eises und der Bildung von Urstromtälern. Es beschreibt die Tierwelt dieser Zeit und die Funde von Steinböcken. Das Kapitel stellt die vermutlich gleichzeitige Riss-Eiszeit im Süden vor, mit der Ausbreitung der Gletscher und der Bildung eines großen Sees durch den gestauten Verlauf der Donau. Die Diskussion um den Saale-Komplex wird ebenfalls berücksichtigt.
Die Eem-Warmzeit: Das Kapitel beschreibt die Eem-Warmzeit als jüngste Warmzeit des Eiszeitalters, gekennzeichnet durch die Überflutung des Nord- und Ostseebeckens. Es beschreibt die Pflanzen- und Tierwelt und erwähnt die wenigen und unsicher datierten Funde von menschlichen Überresten. Die Verbreitung von Flusspferden bis nach England wird hervorgehoben.
Die Weichsel- und die Würm-Eiszeit: Das Kapitel behandelt die Weichsel-Eiszeit im Norden und die Würm-Eiszeit im Süden als letzte Eiszeiten des Pleistozäns. Es beschreibt den geringeren Umfang der Vereisung im Vergleich zu früheren Eiszeiten, die Gliederung in Früh-, Hoch- und Spätglazial und die Tierwelt dieser Zeit. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Stadien der Weichsel-Eiszeit und deren Auswirkungen. Die Würm-Eiszeit wird als letzte Eiszeit in Süddeutschland beschrieben und deren Auswirkung auf die Vegetation und Tierwelt wird diskutiert. Die Ankunft des modernen Menschen (Homo sapiens sapiens) wird erwähnt.
Häufig gestellte Fragen zu "Deutschland im Eiszeitalter"
Was ist der Inhalt des Buches "Deutschland im Eiszeitalter"?
Das Buch bietet einen umfassenden Überblick über die Eiszeit in Deutschland (vor etwa 2,6 Millionen bis 11.700 Jahren). Es beschreibt die verschiedenen Kalt- und Warmzeiten, deren Auswirkungen auf Flora, Fauna und die menschliche Besiedlung, wichtige Fundstätten und die geologische sowie paläontologische Entwicklung dieser Epoche.
Welche Kalt- und Warmzeiten werden im Buch behandelt?
Das Buch behandelt zahlreiche Kalt- und Warmzeiten, darunter die Prätegelen-Kaltzeit, die Biber-Eiszeiten, die Tegelen-Warmzeit, die Eburon-Kaltzeit, die Donau-Eiszeiten, die Waal-Warmzeit, das Bavelium, die Menap-Kaltzeit, die Günz-Eiszeit, der Cromer-Komplex, die Elster- und Mindel-Eiszeiten, die Holstein-Warmzeit, die Saale- und Riss-Eiszeiten, die Eem-Warmzeit sowie die Weichsel- und Würm-Eiszeiten. Die Gliederung erfolgt nach verschiedenen Systemen (Alpenflüsse, norddeutsche Flüsse).
Welche Themenschwerpunkte werden im Buch behandelt?
Die Schwerpunkte liegen auf der Gliederung des Quartärs, den Auswirkungen der Klimaveränderungen auf die Tierwelt, der Entwicklung der menschlichen Besiedlung im Eiszeitalter, wichtigen Fundstätten und ihrer Bedeutung für die Forschung sowie der Geologie und Paläontologie der Eiszeit in Deutschland.
Wie sind die Kapitel des Buches aufgebaut?
Jedes Kapitel widmet sich einer spezifischen Kalt- oder Warmzeit. Es beginnt mit einer Einführung in die jeweilige Periode und beschreibt deren klimatische Bedingungen, die Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt, sowie relevante Fundstätten und deren Bedeutung. Die Kapitel beleuchten auch die wissenschaftlichen Diskussionen und unterschiedlichen Gliederungsvorschläge in der Fachliteratur.
Welche Bedeutung haben die Fundstätten im Buch?
Die verschiedenen Fundstätten (z.B. Untermaßfeld, Steinheim an der Murr, Heppenloch, Bilzingsleben) werden im Buch als wichtige Quellen für die Erforschung der Eiszeit in Deutschland hervorgehoben. Sie liefern Informationen über die Tier- und Pflanzenwelt der jeweiligen Epochen sowie über die Entwicklung der menschlichen Besiedlung.
Wie wird die Datierung der Eiszeiten im Buch behandelt?
Das Buch erwähnt die Bedeutung der Magnetisierung von Gesteinen (z.B. Matuyama-Epoche, Brunhes-Epoche) für die Datierung von Ablagerungen und die Herausforderungen bei der genauen Bestimmung der zeitlichen Abfolge der Kalt- und Warmzeiten.
Wer sind die wichtigsten Wissenschaftler, die im Buch erwähnt werden?
Das Buch erwähnt zahlreiche Wissenschaftler, darunter Eugène Dubois, Bartholomäus Eberl, Waldo H. Zagwijn und Ralf-Dietrich Kahlke, die maßgeblich zur Erforschung der Eiszeit beigetragen haben.
Gibt es Unsicherheiten in der Gliederung der Eiszeiten?
Ja, das Buch betont die Unsicherheiten und die unterschiedlichen Gliederungsvorschläge in der Fachliteratur hinsichtlich der Abgrenzung und Benennung der verschiedenen Kalt- und Warmzeiten.
Für wen ist das Buch geeignet?
Das Buch richtet sich an alle, die sich für die Eiszeit in Deutschland interessieren, insbesondere an Leser mit einem akademischen Hintergrund oder einem starken Interesse an Geologie, Paläontologie und Archäologie. Der verständliche Schreibstil macht das Buch aber auch für ein breiteres Publikum zugänglich.
- Quote paper
- Ernst Probst (Author), 2010, Deutschland im Eiszeitalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151809