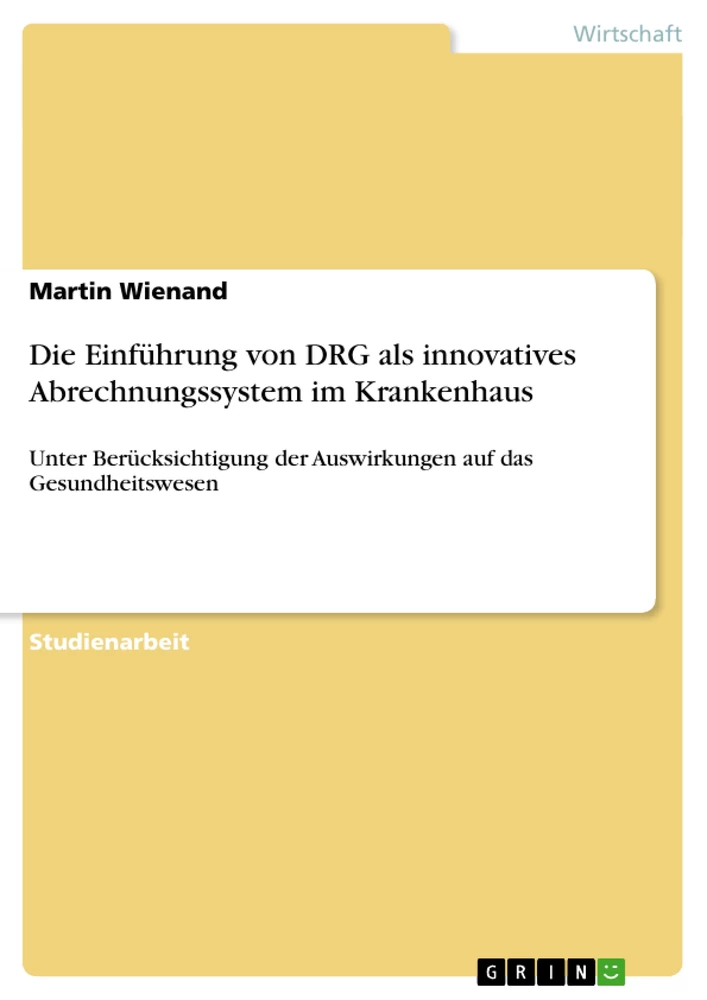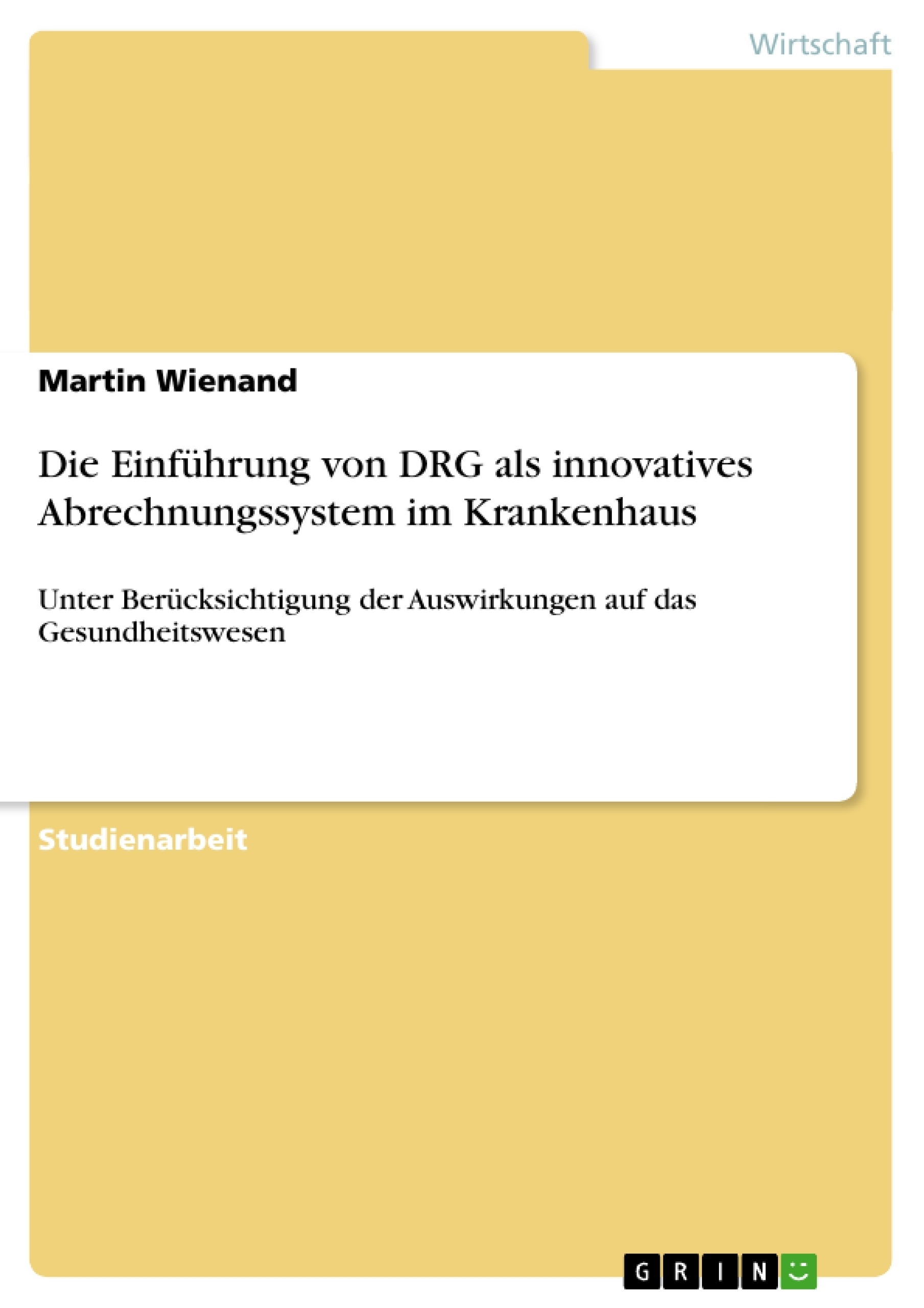Die Einführung von DRGs, genauer gesagt G-DRGs (German Diagnosis Related Groups) auf Basis der Ar-DRGs (Australian refined Diagnosis Related Groups) ist aus Sicht der Kostenträger, d.h. der Krankenkassen und der Beitragszahler längst überfällig. Krankenhäuser sollen ihre Vergütung nicht mehr für vorgehaltene bzw. belegte Betten erhalten, sondern pauschaliert nach „Fall“ und Diagnose. Hintergrund dafür ist die Erkenntnis, dass mehr als 80% aller Krankheiten in gleicher oder vergleichbarer Art und Weise behandelt werden können, unabhängig davon, in welchem Krankenhaus die Therapie erfolgt.
Doch selbst in Australien, das sich bei der Einführung von Fallpauschalen Anfang der neunziger Jahre an den USA orientierte, wird nicht komplett über Fallpauschalen abgerechnet. 70% des Budgets werden dort über Fallpauschalen abgerechnet. 30% aber über andere finanzielle Leistungen. In Deutschland soll allerdings das Abrechnungssystem nicht wie in Australien über einen Verlauf von nahezu einem Jahrzehnt, sondern nach einer Übergangsfrist von nur einem Jahr (2003 optional, ab 2004 verbindlich) eingeführt werden. Das würde eine Einführung in Rekordzeit bedeuten.
Dabei muss jedoch angemerkt werden, dass das neue Abrechnungssystem so neu doch nicht ist, u.a.O. auch noch genauer auf eine Diskussion in Deutschland über die Einführung von DRGs nach amerikanischem Vorbild eingegangen werden wird, die in den 80er Jahren geführt wurde.
Sicher ist, dass die knapp 2000 deutschen Krankenhäuser unter Druck stehen. 2003 ist eine Nullrunde für die Einnahmen vorgesehen. Gleichzeitig fordert Verdi 3% mehr Lohn für die ungefähr 1 Million im Krankenhaussektor Beschäftigten. Das neue Abrechnungsmodell erhöht den Druck auf die Kliniken weiter.
Die Veränderungen, die sich im Krankenhausinformationssystem und pauschal gesagt bei der „Abrechnung“ ergeben, werden ebenfalls beleuchtet.
Zuletzt wird behandelt inwiefern Krankenhäuser innovativ auf die neuen Anforderungen reagieren können, um weiterhin zu bestehen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Grundbegriffe
- Einleitung
- Die Einführung von DRGs
- DRG-Definition
- Wie wird eine DRG ermittelt?
- DRG-Einführung
- Krankenhausinformationssystem-Definition
- Erfahrungen in Australien
- Unterschiede zwischen den Gesundheitssystemen
- Auswirkungen in Australien
- DRG-Definition
- Erwartete Auswirkungen von G-DRGs
- Veränderungen im Gesundheitswesen
- DRG als Prozessinnovator im Krankenhaus?
- Veränderungen im Krankenhausinformationssystem
- „Blutige“ Entlassungen?
- Wettbewerb unter den Krankenhäusern
- Krankenkassen
- Qualitätssicherung
- Hochschulmedizin und Innovation
- Veränderungen im Gesundheitswesen
- Lösungsvorschläge
- Kurz-OP-Tag
- Die Einführung von DRG-Koordinatoren
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einführung des Diagnosis Related Groups (DRG)-Systems, speziell der German DRGs (G-DRGs), im deutschen Gesundheitswesen. Die Zielsetzung ist es, die erwarteten Auswirkungen auf Krankenhäuser, Patienten und das gesamte System zu analysieren und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet sowohl die Erfahrungen aus anderen Ländern, insbesondere Australien, als auch die Herausforderungen und Chancen der Implementierung in Deutschland.
- Auswirkungen der DRG-Einführung auf das deutsche Gesundheitswesen
- Analyse der Veränderungen im Krankenhausinformationssystem
- Bewertung der Wettbewerbsdynamik unter den Krankenhäusern
- Untersuchung potenzieller Qualitätseinbußen und "blutiger Entlassungen"
- Diskussion möglicher Lösungsansätze zur Bewältigung der Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Einführung der G-DRGs im deutschen Gesundheitswesen vor und beschreibt den Hintergrund der pauschalierten Abrechnung nach Fall und Diagnose. Sie verweist auf die Erfahrungen in Australien und hebt die schnelle Einführungsfrist in Deutschland hervor. Die Einleitung thematisiert auch die Ängste und Befürchtungen, die mit der DRG-Einführung verbunden sind, wie beispielsweise Arbeitsplatzverluste und Qualitätseinbußen. Die knapp 2000 deutschen Krankenhäuser stehen unter Druck durch eine Nullrunde bei den Einnahmen und die Lohnforderungen der Gewerkschaft Verdi. Die Arbeit kündigt an, sich mit dem Wahrheitsgehalt der Äußerungen über negative Folgen auseinanderzusetzen und die Veränderungen im Krankenhausinformationssystem sowie innovative Reaktionen der Krankenhäuser zu beleuchten.
Die Einführung von DRGs: Dieses Kapitel definiert DRGs und G-DRGs, beschreibt die Ermittlung einer DRG und deren Einführungsprozess. Es vergleicht das deutsche System mit dem australischen, das bereits seit den 90er Jahren Fallpauschalen einsetzt, jedoch nicht vollständig auf dieses System umgestellt hat. Der Fokus liegt auf dem Unterschied in der Einführungsgeschwindigkeit und den strukturellen Unterschieden in den Gesundheitssystemen. Das Kapitel bietet einen Überblick über den historischen Kontext der DRG-Einführung in Deutschland und verweist auf frühere Diskussionen um ein ähnliches System in den 1980er Jahren.
Erwartete Auswirkungen von G-DRGs: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit den erwarteten Auswirkungen der G-DRGs auf das Gesundheitswesen, insbesondere auf Krankenhäuser und deren Informationssysteme. Es analysiert potenzielle Veränderungen im Krankenhausalltag, die durch die neue Abrechnungsmethode entstehen. Die Diskussion der "blutigen Entlassungen" sowie die Auswirkungen auf den Wettbewerb zwischen Krankenhäusern und die Rolle der Krankenkassen werden detailliert behandelt. Das Kapitel beleuchtet auch die Bedeutung von Qualitätssicherung und den Einfluss auf die Hochschulmedizin.
Lösungsvorschläge: Dieses Kapitel präsentiert mögliche Lösungsansätze, um die Herausforderungen der DRG-Einführung zu bewältigen. Es konzentriert sich auf die Einführung von Kurz-OP-Tagen und die Einrichtung von DRG-Koordinatoren in Krankenhäusern. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Effizienz zu steigern und die negativen Auswirkungen der DRG-Einführung abzumildern. Der Fokus liegt auf pragmatischen Ansätzen zur Anpassung an das neue Abrechnungssystem.
Schlüsselwörter
DRG, G-DRG, Krankenhausfinanzierung, Fallpauschalen, Gesundheitswesen, Krankenhausinformationssystem, Wettbewerb, Qualitätssicherung, Australien, Prozessinnovation, Kostenträger, Krankenkassen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einführung von DRGs im deutschen Gesundheitswesen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Einführung des Diagnosis Related Groups (DRG)-Systems, speziell der German DRGs (G-DRGs), im deutschen Gesundheitswesen. Sie untersucht die erwarteten Auswirkungen auf Krankenhäuser, Patienten und das gesamte System und präsentiert mögliche Lösungsansätze. Ein Vergleich mit den Erfahrungen in Australien wird ebenfalls gezogen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Auswirkungen der DRG-Einführung auf das deutsche Gesundheitswesen, Veränderungen im Krankenhausinformationssystem, Wettbewerbsdynamik unter den Krankenhäusern, potenzielle Qualitätseinbußen ("blutige Entlassungen"), und mögliche Lösungsansätze zur Bewältigung der Herausforderungen. Die Arbeit beinhaltet außerdem eine Definition von DRGs und G-DRGs, einen Vergleich des deutschen Systems mit dem australischen sowie eine historische Einordnung der DRG-Einführung in Deutschland.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Einführung von DRGs (inklusive Definition, Ermittlung und Vergleich mit dem australischen System), ein Kapitel zu den erwarteten Auswirkungen von G-DRGs (mit Fokus auf Krankenhäuser, Informationssysteme, Wettbewerb und Qualitätssicherung), ein Kapitel mit Lösungsvorschlägen (Kurz-OP-Tag und DRG-Koordinatoren) und ein Fazit. Zusätzlich enthält die Arbeit ein Inhaltsverzeichnis, ein Abkürzungsverzeichnis (vermutlich), ein Abbildungsverzeichnis (vermutlich), ein Literaturverzeichnis und Schlüsselwörter.
Welche Auswirkungen der G-DRGs werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen auf Krankenhäuser (Effizienz, Wettbewerb, Anpassung der Informationssysteme), Patienten (mögliche Qualitätseinbußen, "blutige Entlassungen"), das gesamte Gesundheitswesen (Kostendruck, Qualitätssicherung), und die Rolle der Krankenkassen. Der Einfluss auf die Hochschulmedizin und Innovation wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Lösungsansätze werden vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt die Einführung von Kurz-OP-Tagen und die Einrichtung von DRG-Koordinatoren in Krankenhäusern vor, um die Effizienz zu steigern und negative Auswirkungen der DRG-Einführung abzumildern.
Welche Rolle spielt der Vergleich mit Australien?
Der Vergleich mit dem australischen Gesundheitssystem, das bereits seit den 90er Jahren Fallpauschalen einsetzt, dient dazu, die Besonderheiten der deutschen Einführung (insbesondere die Geschwindigkeit) und die strukturellen Unterschiede in den Gesundheitssystemen hervorzuheben. Australien dient als Beispiel für ein Land mit längerer Erfahrung im Umgang mit Fallpauschalen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
DRG, G-DRG, Krankenhausfinanzierung, Fallpauschalen, Gesundheitswesen, Krankenhausinformationssystem, Wettbewerb, Qualitätssicherung, Australien, Prozessinnovation, Kostenträger, Krankenkassen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit dem deutschen Gesundheitswesen, Krankenhausfinanzierung, DRGs und den damit verbundenen Herausforderungen auseinandersetzen. Dies beinhaltet Krankenhausmanager, Mitarbeiter im Gesundheitswesen, Gesundheitspolitiker, Wissenschaftler und Studenten.
- Quote paper
- Martin Wienand (Author), 2003, Die Einführung von DRG als innovatives Abrechnungssystem im Krankenhaus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15174