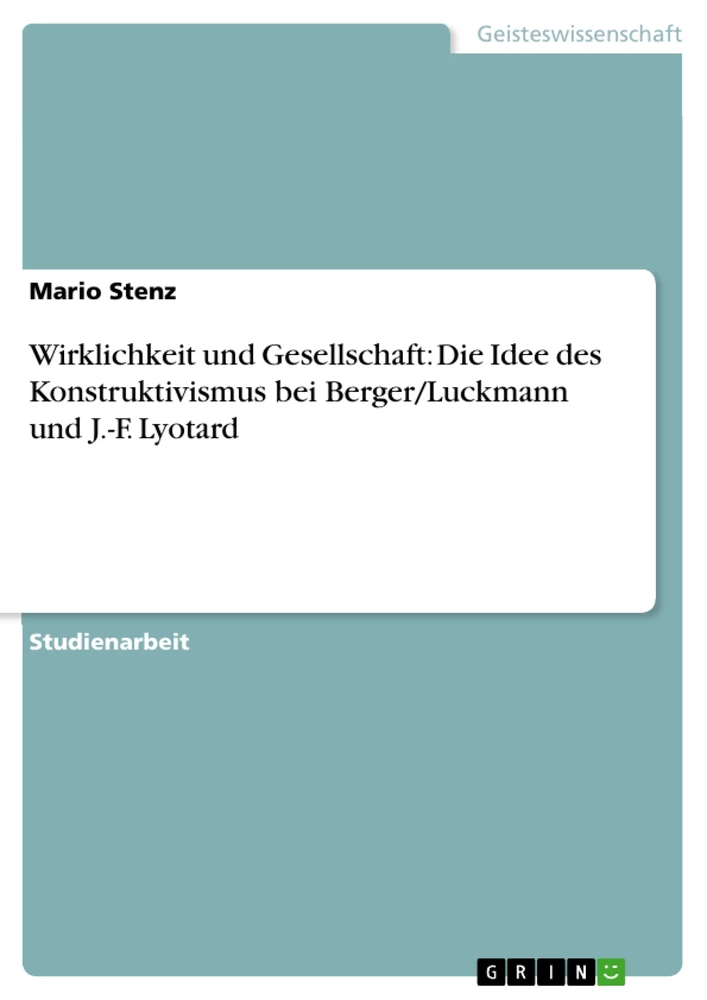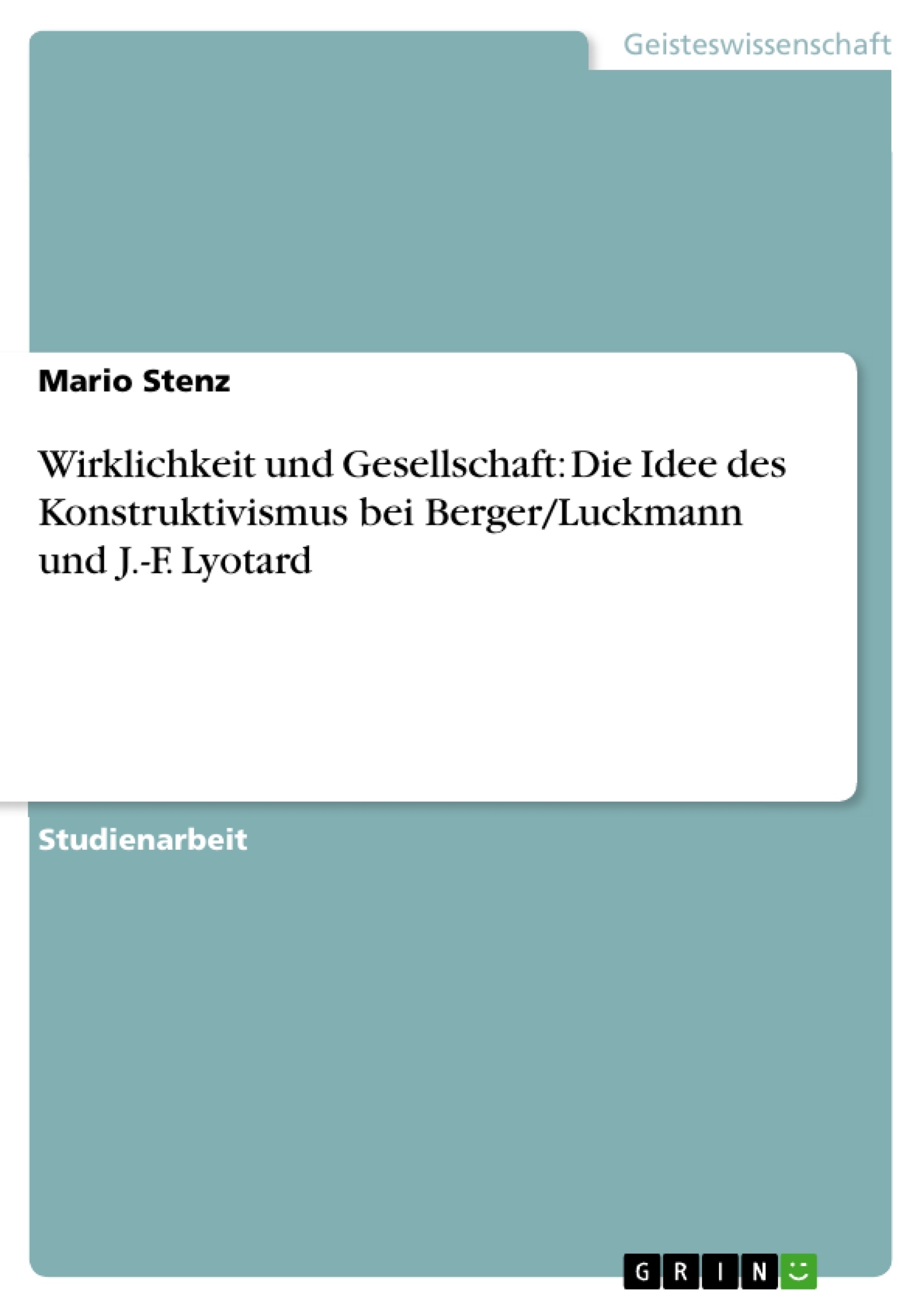Wenn Menschen als leibliche Wesen ins Dasein gelangen, treten sie unvermeidlich und ohne vorherige Zustimmungsmöglichkeit in schon bestehende Sprachgemeinschaften und damit in größere, übergreifende Sinnzusammenhänge ein, die im Laufe der Zeit ihr Bewusstsein und damit das Verhältnis der Menschen zu sich, den Mitmenschen und der Welt prägen. Alles „In-der-Welt-sein“ (Heidegger) heißt daher auch immer "In-der-Gesellschaft-sein" (Berger/Luckmann), da das „soziale A priori“ die Entwürfe für die primäre Welt- und Selbstinterpretation bereitstellen.
In der vorliegenden Arbeit werden zwei solcher Konstruktions-Konzepte behandelt, die vermehrt die gesellschaftliche Präformierung der menschlichen Weltauslegung in den Vordergrund rücken. Dazu wird zum einen die Idee des Konstruktivismus bei Berger/Luckmann untersucht, deren bahnbrechendes Werk „Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ eine Alltagswende in der Wissenssoziologie hervorrief und die dynamische Dialektik von Gesellschaft und Mensch und deren Wirklichkeitserfassung analysiert. Ferner werden vornehmlich zwei Werke des französischen Philosophen und Pioniers der Postmodernendebatte Jean-Francois Lyotard wissenssoziologisch interpretiert und dessen Idee von der Konstruktivität von Welt herausgearbeitet. Dabei werden besonders auf das „Ende der großen Erzählungen“ und die sich daraus ergebenden, sozialen Konsequenzen und die damit verbundenen Hoffnungen eingegangen.
In Gesamtzusammenhang beider Ansätze werden u. a. Bereiche wie Anthropologie, Sozialisation, Individualität, Wissen, Macht und die Bedeutung der Sprache für die Weltsicht thematisiert.
In einem letzten, abschließenden Schritt werden beide Konzeptionen auf Ähnlichkeiten und Unterschiede hin befragt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein Gedankenexperiment als Themeneinführung
- Wissenschaftliche Vorgehensweise
- Hauptteil
- Die Idee des Konstruktivismus bei Berger/ Luckmann
- Anthropologische Prämissen
- Die Voraussetzungen des Wirklichkeitsbezugs der Alltagswelt
- Bedeutung der Sprache für den Entwurf von Wirklichkeit
- Externalisierung: Wie der Mensch sich seine gesellschaftliche Welt entwirft
- Ablagerung von Wissen und Weitergabe des Gewussten
- Die Legitimation der Teile und des Ganzen
- Objektivierung: Gesellschaft als objektiv(iert)e Wirklichkeit
- Internalisierung: Wie der Mensch von der Gesellschaft entworfen wird
- Primäre Sozialisation
- Sekundäre Sozialisation und der Riss in der Wirklichkeitsauffassung
- Die dynamische Dialektik der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit
- Die Grenzen der Konstruierbarkeit
- Die Idee des Konstruktivismus bei Francois Lyotard
- Einige Gedanken über anthropologische Voraussetzungen
- Vom Ende der Erzählungen: Lyotard als skeptischer Sozialkonstruktivist
- Historische Belege für den Niedergang der großen Erzählungen
- Der offene Wirklichkeitsbezug und die Folgerungen
- Die sozialen Konsequenzen
- Die postmoderne Perspektive auf die Gesellschaft
- Die Atomarisierung der Gesellschaft
- Die hervorgehobene Stellung des Individuums im sozialen Geflecht
- Die Entgrenzung der Institutionen
- Wider den Messbarkeits- und Effizienzzwang
- Die Hoffnungen nach dem Ende der großen Erzählungen
- Schluss
- Markante Unterschiede in den Konstruktionskonzepten bei B/L und Lyotard
- Zurück zum Anfang
- Literaturverzeichnis
- Die Konstruktion der sozialen Wirklichkeit
- Die Rolle der Sprache und der Sozialisation
- Die Bedeutung von Erzählungen und großen Narrativen
- Die Folgen des postmodernen Denkens für die Gesellschaft
- Die Grenzen der Konstruierbarkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Idee des Konstruktivismus in der Soziologie, insbesondere im Kontext der Werke von Peter Berger/ Thomas Luckmann und Jean-Francois Lyotard. Ziel ist es, die Konzepte der beiden Denkschulen zu analysieren und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Die Arbeit untersucht, wie die gesellschaftliche Wirklichkeit konstruiert wird und welche Auswirkungen diese Konstruktion auf das Individuum und die Gesellschaft hat.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt ein Gedankenexperiment vor, das die unterschiedlichen Perspektiven auf die soziale Wirklichkeit verdeutlicht. Der Hauptteil der Arbeit widmet sich zunächst der Konstruktivistentheorie von Berger/ Luckmann. Hier werden die anthropologischen Prämissen, die Prozesse der Externalisierung, Objektivierung und Internalisierung sowie die dynamische Dialektik der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit beleuchtet. Anschließend wird die Idee des Konstruktivismus bei Lyotard untersucht, wobei der Fokus auf dem Ende der großen Erzählungen und den sozialen Konsequenzen des postmodernen Denkens liegt. Der Schluss der Arbeit fasst die wichtigsten Unterschiede zwischen den Konstruktionskonzepten von Berger/ Luckmann und Lyotard zusammen und reflektiert die Bedeutung der Konstruktivistentheorie für das Verständnis der sozialen Wirklichkeit.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Konstruktivismus, die soziale Wirklichkeit, die Gesellschaft, die Sprache, die Sozialisation, die Erzählungen, die großen Narrative, die Postmoderne, die Atomarisierung der Gesellschaft, die Individualisierung und die Grenzen der Konstruierbarkeit. Die Arbeit analysiert die Konzepte von Peter Berger/ Thomas Luckmann und Jean-Francois Lyotard und untersucht, wie die gesellschaftliche Wirklichkeit konstruiert wird und welche Auswirkungen diese Konstruktion auf das Individuum und die Gesellschaft hat.
- Quote paper
- Dipl. - Päd. Mario Stenz (Author), 2005, Wirklichkeit und Gesellschaft: Die Idee des Konstruktivismus bei Berger/Luckmann und J.-F. Lyotard, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151736