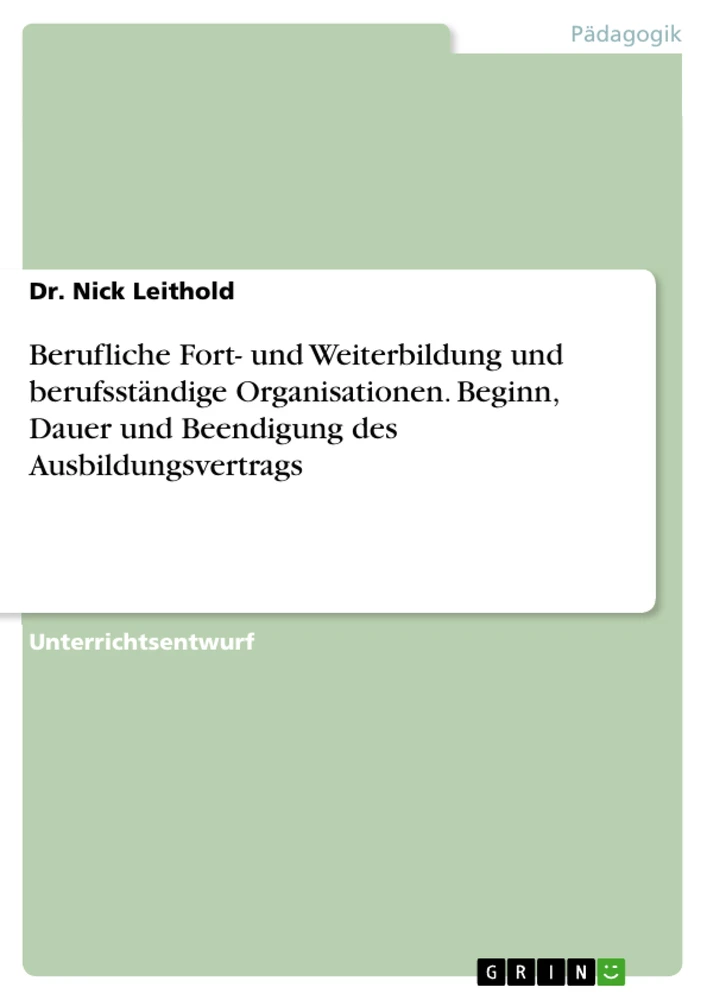In der Prüfungsstunde geht es um die Dauer und die Beendigung des Berufsausbildungsvertrags. Diese Inhalte sind in Abstimmung mit dem Rahmenlehrplan aus dem Teilgebiet "Berufliche Bildung" in dem an der Berufsschule einheitlich durch die Fachkonferenz Wirtschaftslehre entwickelten Stoffverteilungsplan verankert.
Die Unterrichtsstunde liegt am Beginn der Unterrichtsreihe zum Berufsausbildungsvertrag in dieser Turnuswoche. In den folgenden Stunden wird das Thema durch die Behandlung der beruflichen Fort- und Weiterbildung und der berufsständigen Organisationen weitergeführt.
Die Klasse EBT24 besteht aus 30 männlichen Auszubildenden, von denen 28 den Beruf des Elektronikers für Betriebstechnik (EBT) in dreieinhalb Jahren erlernen, während zwei Schüler eine zweijährige Ausbildung zum Industrieelektroniker: Fachrichtung Betriebstechnik (IE) absolvieren. Die Gruppe ist in Bezug auf Alter, schulische Vorbildung und Migrationshintergrund heterogen. 22 Schüler haben einen Realschulabschluss, während vier das Abitur, ein Schüler die Fachhochschulreife und zwei Schüler den Hauptschulabschluss besitzen. Ein 34-jähriger Schüler mit einem Bachelorabschluss in Germanistik aus China sticht altersmäßig hervor. Ohne ihn beträgt das Durchschnittsalter der Klasse 17,55 Jahre.
Vier Schüler haben einen Migrationshintergrund: Einer stammt aus Marokko, einer aus Afghanistan, einer aus China und einer hat russische Wurzeln. Der marokkanische Schüler hat bisher in beiden Turnuswochen vollständig gefehlt. Die Schüler aus China und Afghanistan benötigen sprachliche Unterstützung, um den Unterrichtsinhalten besser folgen zu können. Der russischstämmige Schüler ist in Deutschland aufgewachsen, spricht fließend Deutsch und nimmt aktiv am Unterricht teil.
Inhaltsverzeichnis
1 Beurteilung der Ausgangslage.. 1
1.1 Einschätzung der Lernenden. 1
1.3 Bewertung der äußeren Umstände. 2
2. Analyse der Lerninhalte.. 2
2.1 Einordnung und Legitimation der Stunde. 2
3 Berufliche Handlungssituation und Lernziele.. 7
A1 Berufliche Handlungssituation. 15
A3 Reduzierter Informationstext. 18
A5 Musterlösung zum Arbeitsblatt. 21
A6 Erwartungsbild zur beruflichen Handlungssituation. 23
A7 Auszug aus dem Rahmenlehrplan. 24
1 Beurteilung der Ausgangslage
1.1 Einschätzung der Lernenden
Die Klasse EBT24 besteht aus 30 männlichen Auszubildenden, von denen 28 den Beruf des Elektronikers für Betriebstechnik (EBT) in dreieinhalb Jahren erlernen, während zwei Schüler eine zweijährige Ausbildung zum Industrieelektroniker: Fachrichtung Betriebstechnik (IE) absolvieren. Die Gruppe ist in Bezug auf Alter, schulische Vorbildung und Migrationshintergrund heterogen. 22 Schüler haben einen Realschulabschluss, während vier das Abitur, ein Schüler die Fachhochschulreife und zwei Schüler den Hauptschulabschluss besitzen. Ein 34-jähriger Schüler mit einem Bachelorabschluss in Germanistik aus China sticht altersmäßig hervor. Ohne ihn beträgt das Durchschnittsalter der Klasse 17,55 Jahre.
Vier Schüler haben einen Migrationshintergrund: Einer stammt aus Marokko, einer aus Afghanistan, einer aus China und einer hat russische Wurzeln. Der marokkanische Schüler hat bisher in beiden Turnuswochen vollständig gefehlt. Die Schüler aus China und Afghanistan benötigen sprachliche Unterstützung, um den Unterrichtsinhalten besser folgen zu können. Der russischstämmige Schüler ist in Deutschland aufgewachsen, spricht fließend Deutsch und nimmt aktiv am Unterricht teil.
Die Mitarbeit im Unterricht variiert. In den vorderen Reihen wird oft aktiv teilgenommen, während einige Schüler in den hinteren Reihen Schwierigkeiten haben, ihre Aufmerksamkeit über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Dies äußert sich durch Flüstern oder private Gespräche. Einige Schüler arbeiten nicht immer über die gesamte Unterrichtszeit hinweg aktiv mit. Schüler mit Migrationshintergrund beteiligen sich trotz sprachlicher Herausforderungen engagiert am Unterricht und werden von ihren Mitschülern respektvoll integriert. Es gibt keine Anzeichen von Ausgrenzung und die Klasse pflegt insgesamt eine kooperative und respektvolle Arbeitsatmosphäre.
In Gruppenarbeiten zeigten sich anfangs Probleme: Oft übernahm ein einzelner Schüler die Aufgaben, während die anderen passiv blieben (Trittbrettfahrer-Effekt). In der Partnerarbeit, bei der die Schüler mit ihren Sitznachbarn zusammenarbeiteten, fiel auf, dass einige eher auf die Ergebnissicherungsphase warteten, anstatt aktiv mitzuarbeiten.
1.2 Analyse der Lehrperson
Seit Beginn des Schuljahres unterrichte ich die Klasse EBT24 im Fach Wirtschaftslehre, bisher über zwei Turnuswochen mit insgesamt sechs Unterrichtsstunden. Das Verhältnis zu den Schülern befindet sich noch in einer Kennenlernphase, ist jedoch durch eine freundliche und kommunikative Atmosphäre geprägt. Auf ihren Wunsch duze ich die Schüler, was zu einer offenen Kommunikation und einem vertrauensvollen Umgang beiträgt. Diese positive Grundlage erleichtert es mir, die Unterrichtsinhalte zu vermitteln und die Schüler schrittweise an die Anforderungen im Wirtschaftslehreunterricht heranzuführen.
Neben meiner Tätigkeit als Berufsschullehrer bringe ich berufliche Erfahrungen als Projektmanager und Projektleiter aus verschiedenen Unternehmen mit, wo ich bereits mit Auszubildenden gearbeitet und deren praktische Entwicklung gefördert habe. Diese Praxiserfahrungen nutze ich gezielt im Unterricht, um theoretische Inhalte anschaulich und praxisnah zu vermitteln. Als nebenamtlicher Dozent für Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Finanzwirtschaftslehre habe ich zudem fundierte Kenntnisse in wirtschaftlichen Themen erworben, die ich effektiv in den Berufsschulunterricht einfließen lasse. Seit September 2022 unterrichte ich das Lernfeld Wirtschaftslehre für die gewerblich-technischen Ausbildungsberufe sowohl in der Grundstufe als auch in den höheren Fachstufen an unserer Berufsschule.
1.3 Bewertung der äußeren Umstände
Der Unterricht findet im Raum I.2.18 im zweiten Obergeschoss von Haus 1 an der Berufsschule statt. Es gibt eine digitale multimediale Tafel mit Beamer und Internetzugang sowie zusätzliche Lautsprecher. Im Raum befinden sich zwei Fensterreihen, jeweils links und rechts vom Lehrertisch, die für eine helle und freundliche Atmosphäre sorgen. Vom Lehrertisch aus gesehen gibt es auf der linken Seite automatische Rollos, die elektronisch heruntergefahren werden können. Auf der rechten Seite der Fensterreihe sorgt ein Lamellenvorhang für Sonnenschutz und Verdunkelung. Besonders an sonnigen Tagen ist es wichtig, die Rollos zu nutzen, da die starke Sonneneinstrahlung die Sicht auf die digitale Multimediale Tafel beeinträchtigen kann. Die Anordnung der Tische umfasst vier Tischreihen mit insgesamt 16 Tischen, an denen die Schüler überwiegend zu zweit sitzen.
2. Analyse der Lerninhalte
2.1 Einordnung und Legitimation der Stunde
Laut Thüringer Handreichung zur Umsetzung der KMK-Rahmenlehrpläne für die Ausbildung im ersten Ausbildungsjahr für alle gewerblich-technischen Berufe sind für das Lernfeld Wirtschaftslehre ein Zeitrichtwert von 40 Stunden und für das Teilgebiet Berufliche Bildung ca. 12 Stunden vorgesehen.
Im ersten Ausbildungsjahr besuchen die Schüler der EBT-Klasse laut Turnusplan insgesamt 13 Wochen die Schule, in denen jeweils drei Stunden Wirtschaftslehre unterrichtet werden. In der ersten Turnuswoche habe ich volkswirtschaftliche Grundlagen unterrichtet und ab der zweiten Woche das Thema „Berufliche Bildung“ begonnen. Dabei wurden zentrale rechtliche Grundlagen des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) sowie die Rechte und Pflichten der Vertragspartner im Berufsausbildungsverhältnis behandelt. In drei Unterrichtsstunden haben wir wesentliche Inhalte wie die Mindestanforderungen an einen Berufsausbildungsvertrag und den Abschluss eines solchen Vertrags erarbeitet. Diese Grundlagen bilden die Basis für die weiterführenden Themen zur Berufsausbildung, die in den kommenden Stunden vertieft werden.
In der Prüfungsstunde geht es um die Dauer und die Beendigung des Berufsausbildungsvertrags . Diese Inhalte sind in Abstimmung mit dem Rahmenlehrplan aus dem Teilgebiet „Berufliche Bildung“ in dem an der Berufsschule einheitlich durch die Fachkonferenz Wirtschaftslehre entwickelten Stoffverteilungsplan verankert.
Die vorgestellte Unterrichtsstunde liegt am Beginn der Unterrichtsreihe zum Berufsausbildungsvertrag in dieser Turnuswoche. In den folgenden Stunden wird das Thema durch die Behandlung der beruflichen Fort- und Weiterbildung und der berufsständigen Organisationen weitergeführt.
2.2 Sachanalyse
In der vorgestellten Unterrichtsstunde geht es um ausgewählte rechtliche Grundlagen des Berufsausbildungsvertrags, die unter anderem die Vertragsdauer gemäß dem BBiG regeln. Der Berufsausbildungsvertrag bestimmt das Ausbildungsverhältnis zwischen dem Ausbildungsbetrieb und dem Auszubildenden und ist sowohl für den Beginn, die Dauer als auch die Beendigung der Ausbildung von zentraler Bedeutung.
Grundsätzlich kann die Berufsausbildung zu jedem Tag im Jahr beginnen, klassisch jedoch zum 01. August oder 01. September. Der Beginn des Ausbildungsverhältnisses wird im Berufsausbildungsvertrag schriftlich festgehalten (§ 10 BBiG). Das Datum, das im Vertrag steht, bestimmt den offiziellen Beginn der Ausbildung. Die Berufsausbildung beginnt zudem immer mit der Probezeit und muss mindestens einen Monat und darf maximal vier Monate betragen (§ 20 BBiG).
Die Dauer des Berufsausbildungsvertrags hängt von der jeweiligen Ausbildungsordnung (§ 5 BBiG) ab und beträgt in der Regel zwei bis dreieinhalb Jahre. Gemäß § 8 BBiG kann die Ausbildungszeit verkürzt werden, wenn der Auszubildende eine höhere schulische Vorbildung hat oder bereits eine Ausbildung in einem verwandten Beruf abgeschlossen hat. Bei sehr guten Leistungen kann in Absprache mit dem Betrieb eine vorzeitige Abschlussprüfung beantragt werden, was eine Verkürzung der Lehrzeit bedeutet.
Die Ausbildung kann ebenfalls verlängert werden, beispielsweise wenn der Auszubildende die Abschlussprüfung nicht besteht (§ 21 Abs. 3 BBiG). Die Verlängerung erfolgt bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, jedoch maximal für ein Jahr. Für die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik ist eine dreieinhalbjährige und für die Industrieelektriker: Fachrichtung Betriebstechnik eine verkürzte zweijährige Ausbildungszeit durch die Handwerkskammer (HWK) vorgesehen.
Ein Berufsausbildungsvertrag kann auf verschiedene Weise beendet werden. Zum einen endet das Ausbildungsverhältnis durch Zeitablauf, da es sich um einen befristeten Vertrag handelt, der in der Regel mit dem Abschluss der vereinbarten Ausbildungszeit ausläuft. Zum anderen endet der Vertrag automatisch mit dem erfolgreichen Bestehen der Abschlussprüfung (§ 21 BBiG). Besteht der Auszubildende die Prüfung vor Ablauf der regulären Ausbildungszeit, endet das Ausbildungsverhältnis mit der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses, beispielsweise durch Aushändigung des Prüfungszeugnisses oder eine schriftliche Mitteilung über das Bestehen durch die Prüfungskommission.
Neben der Beendigung durch Zeitablauf oder Bestehen der Prüfung gibt es jedoch auch Regelungen zur Kündigung des Ausbildungsvertrags. Während der Probezeit haben beide Vertragsparteien das Recht, den Vertrag jederzeit ohne Angabe von Gründen zu kündigen (§ 22 BBiG). Nach der Probezeit ist eine Kündigung jedoch nur unter bestimmten Bedingungen im Rahmen einer ordentlichen oder außerordentlichen Kündigung möglich. Die Kündigung muss gemäß § 22 Abs. 3 BBiG schriftlich erfolgen, damit sie wirksam ist.
Außerordentliche Kündigung durch den Ausbildungsbetrieb
Eine außerordentliche Kündigung kann nach der Probezeit nur aus einem wichtigen Grund erfolgen (§ 22 Abs. 2 BBiG). Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn es dem Ausbildungsbetrieb unzumutbar ist, das Ausbildungsverhältnis fortzusetzen. Beispiele hierfür sind grobe Pflichtverletzungen des Auszubildenden, wie wiederholtes unentschuldigtes Fehlen, Diebstahl im Betrieb, Beleidigungen oder körperliche Übergriffe gegenüber Mitarbeitern oder Vorgesetzten sowie Verstöße gegen die Ausbildungsordnung.
Die außerordentliche Kündigung erfolgt in der Regel fristlos. Bevor eine außerordentliche Kündigung ausgesprochen wird, muss der Ausbildungsbetrieb den Auszubildenden grundsätzlich wegen desselben Fehlverhaltens abmahnen. Es gibt keine feste gesetzliche Vorgabe, wie oft abgemahnt werden muss, jedoch hat sich in der Rechtsprechung etabliert, dass mindestens eine Abmahnung bei Angestellten schon ausreichend ist (§ 314 BGB).
In der Regel sind zwei einschlägige Abmahnungen vor einer Kündigung ausreichend (IHK, WBS). Die Abmahnungen und die Kündigung müssen sich dabei auf dasselbe Fehlverhalten beziehen, beispielsweise unentschuldigtes Fehlen in der Berufsschule und im Betrieb. Wenn nach der zweiten Abmahnung das Fehlverhalten erneut auftritt, kann eine Kündigung wirksam ausgesprochen werden. Viele Ausbildungsbetriebe sprechen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit oft zwei oder mehrere Abmahnungen aus, um dem Auszubildenden die Möglichkeit zu geben, sein Verhalten zu ändern. Der Arbeitgeber hat nach Kenntnisnahme des Fehlverhaltens zwei Wochen Zeit, die Kündigung zu erklären, damit sie wirksam wird (§ 22 Abs. 4 BBiG).
In besonders schwerwiegenden Fällen ist eine Abmahnung nicht zwingend erforderlich, da das Vertrauensverhältnis bereits irreparabel zerstört ist. Beispiele hierfür sind Diebstahl, Unterschlagung von Geldern oder andere strafbare Handlungen im Betrieb. In solchen Fällen kann der Arbeitgeber ohne vorheriges Abmahnen außerordentlich und fristlos kündigen.
Außerordentliche Kündigung durch den Auszubildenden
Auch ein Auszubildender kann außerordentlich und fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher Grund besteht beispielsweise dann, wenn der Ausbildungsbetrieb wiederholt gegen wesentliche Pflichten verstößt, wie etwa die Vergütung mehrfach verspätet oder gar nicht zahlt, oder den Auszubildenden nicht von der Arbeit freistellt, damit er die Berufsschule besuchen kann. Ebenso können Verstöße gegen die Fürsorgepflicht, wie das Nichtgewähren von Schutzmaßnahmen, eine fristlose Kündigung rechtfertigen.
Ordentliche Kündigung durch den Ausbildungsbetrieb
Nach Ablauf der Probezeit hat der Ausbildungsbetrieb keine Möglichkeit, das Ausbildungsverhältnis ordentlich zu kündigen. Gemäß § 22 Abs. 2 BBiG darf der Ausbilder das Ausbildungsverhältnis nach der Probezeit nur außerordentlich und aus einem wichtigen Grund kündigen. Eine ordentliche Kündigung durch den Ausbildungsbetrieb ist damit ausgeschlossen, was den besonderen Kündigungsschutz für Auszubildende sicherstellt.
Ordentliche Kündigung durch den Auszubildenden
Nach Ablauf der Probezeit kann der Auszubildende mit einer Frist von vier Wochen ordentlich kündigen, wenn er die Ausbildung aufgeben oder einen anderen Beruf erlernen möchte (§ 22 Abs. 2 Nr. 2 BBiG).
2.3 Didaktische Analyse
Dieses Kapitel orientiert sich an den fünf Fragen der didaktischen Analyse nach Klafki (1964).
Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung:Das Thema „Dauer und Beendigung des Berufsausbildungsvertrags“ ist für die Schüler besonders relevant, da sie alle ihre Ausbildung erst begonnen haben und die Inhalte unmittelbar ihren Ausbildungsalltag betreffen. Sie müssen verstehen, welche Rechte und Pflichten sich aus dem Vertrag ergeben, wie lange die Ausbildung dauert, wie der Vertrag beendet werden kann und welche Rolle die Probezeit spielt. Dabei stütze ich mich auf das Berufsbildungsgesetz (BBiG, §§ 21 und 22), das die rechtlichen Rahmenbedingungen klar definiert. Dies hilft den Schülern, sich im Betriebsalltag besser zurechtzufinden und ihre Rechte als Auszubildende zu kennen. Das Thema ist nicht nur für ihre aktuelle Ausbildung von Bedeutung, sondern bereitet sie auch auf zukünftige Arbeitsverhältnisse vor. Später werden sie Arbeitsverträge abschließen, die ähnliche rechtliche Rahmenbedingungen haben. Ein Verständnis von Verträgen ist daher für ihre berufliche und private Zukunft von großer Bedeutung.
Inhalt und quantitative Reduktion: Ausgehend von der umfassenden Thematik des Berufsausbildungsvertrags und der Sachanalyse habe ich den Lernstoff so reduziert, dass er auf das Unterrichtsthema „Dauer und Beendigung des Ausbildungsvertrags“ fokussiert ist. Dies ermöglichte es, aus dem weit gefassten Gegenstandsfeld gezielt diejenigen Inhalte auszuwählen, die für das Leistungsniveau der EBT24 Klasse (größtenteils mit Realschulabschluss) angemessen und innerhalb der 45-minütigen Unterrichtseinheit gut vermittelbar sind. Mithilfe der 3Z-Formel und unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den vorherigen beiden Turnuswochen habe ich den Umfang des Lernstoffs so angepasst, dass die wesentlichen Aspekte – Beginn des Ausbildungsverhältnisses, Probezeit, sowie die Dauer und Beendigungsarten des Vertrags – im Mittelpunkt stehen. Diese inhaltliche Reduktion sorgt dafür, dass die Schüler gezielt an den Kernfragen des Themas arbeiten können, ohne von der Menge des Stoffes überfordert zu werden, und das Unterrichtsthema in der vorgegebenen Zeit entsprechend entwickelt werden kann.
Horizontale Reduktion und Zugänglichkeit: Um den Schülern den Zugang zum Lernstoff zu ermöglichen, wurden komplizierte Gesetzestexte in konkrete und verständliche Informationstexte umgewandelt. Dabei habe ich die relevanten gesetzlichen Grundlagen aus dem BBiG ausgewählt und entsprechend aufbereitet. Für Schüler mit sprachlichen Barrieren biete ich einen vereinfachten Informationstext mit Sprechblasen an, die schwierige Fachbegriffe ergänzend erklären. Diese Reduktion stellt sicher, dass der fachliche Lernstoff für die Schüler der EBT24 greifbarer bzw. fasslicher wird. Ein strukturiertes Arbeitsblatt unterstützt die Lernenden dabei, die wesentlichen Informationen herauszufiltern.
Vertikale Reduktion und Exemplarität:Mein Anliegen ist es, die abstrakten Inhalte der Sachanalyse – wie Paragrafen und Gesetzestexte – möglichst anschaulich zu gestalten. Dafür setze ich eine berufliche Handlungssituation ein, die den Schülern hilft, sich mithilfe eines praxisnahen Beispiels in die Thematik hineinzuversetzen. So wird ein realistischer Bezug zu den abstrakten gesetzlichen Inhalten hergestellt und vorhandenes Schülerwissen wird aktiviert. Der Berufsausbildungstrag dient dabei als konkretes Beispiel, das den Schülern bereits vertraut ist, da sie selbst einen solchen Vertrag unterschrieben haben und wir im zweiten Turnus das Berufsausbildungsverhältnis thematisiert haben. Durch diese Verbindung können die Schüler die Vertragsgestaltung und deren Bedingungen besser nachvollziehen. Das erworbene Wissen lässt sich anschließend auf andere Vertragstypen wie Arbeitsverträge, Dienstleistungsverträge oder Kaufverträge übertragen und erweitert so ihr grundlegendes Verständnis für rechtliche Vereinbarungen.
3 Berufliche Handlungssituation und Lernziele
Auf Basis der didaktischen Analyse habe ich mich entschieden, eine berufliche Handlungssituation zu wählen, um den Schülern einen praxisnahen Zugang zu den Lerninhalten zu ermöglichen. Dadurch können sie die gesetzlichen Grundlagen besser nachvollziehen und in ihren Ausbildungsalltag übertragen. Die Lernziele wurden so formuliert, dass sie sowohl die praktische Anwendung als auch das Verständnis der zugrunde liegenden Gesetze aus dem BBiG fördern und ausgewählte Fähigkeiten und Kompetenzen der Schüler erweitern.
Lukas braucht Hilfe – was würdest du tun?
Du hast gerade dein erstes Ausbildungsjahr als Elektroniker für Betriebstechnik in einem mittelständischen Handwerksbetrieb begonnen. Du bist motiviert, lernst viele neue Dinge und beginnst langsam zu verstehen, wie der Arbeitsalltag in einem Betrieb abläuft. Auch dein Freund Lukas hat die gleiche Ausbildung begonnen, jedoch in einem anderen Handwerksbetrieb. Seine Probezeit hat er bereits erfolgreich überstanden. Doch bei ihm läuft es in letzter Zeit nicht gut.
Lukas wirkt unsicher und erzählt dir, dass er wiederholt zu spät zur Berufsschule gekommen ist und auch unentschuldigt bei der Arbeit gefehlt hat. Sein Ausbildungsleiter hat ihm deshalb bereits mehrere Abmahnungen erteilt. Nun hat Lukas die Nachricht erhalten, dass ihm fristlos gekündigt werden soll. Verzweifelt wendet er sich an dich und fragt dich um Rat.
Lernziel 1 (LZ1):
Indem die Schüler im Partnertandem die rechtlichen Grundlagen zu Beginn, Dauer und Beendigung des Berufsausbildungsvertrags im Informationstext lesen, ihre Lösungsansätze besprechen und die wesentlichen Informationen in das Arbeitsblatt übertragen, fördern sie ihre Fähigkeit zur Informationsverarbeitung und erweitern ihre Fach- und Kommunikationskompetenz.
Die Tandemarbeit bietet den Schülern die Möglichkeit, sich gegenseitig bei der Erarbeitung der Inhalte zu unterstützen und von den unterschiedlichen Ansätzen und Perspektiven ihres Sitznachbarn zu profitieren. Durch den Austausch im Tandem werden Missverständnisse vermieden und die Inhalte gemeinsam erarbeitet. Dabei lernen sie, die wesentlichen Informationen aus dem Text zu filtern und in das Arbeitsblatt zu übertragen, was ihr Verständnis der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Berufsausbildungsvertrag verbessert. Die Schüler lernen nicht nur, die wesentlichen Informationen aus dem Text zu filtern und in das Arbeitsblatt zu übertragen, sondern verbessern auch ihre Fähigkeit, komplexe Inhalte in einem Dialog zu vermitteln und zu verarbeiten. Diese Zusammenarbeit stärkt somit nicht nur das inhaltliche Verständnis, sondern auch die kommunikative Kompetenz der Schüler.
Lernziel 2 (LZ2):
Indem die Schüler ihre Lösungsvorschläge zur Kündigungssituation von Lukas im Plenum formulieren und mitteilen, wenden sie die bereits erarbeiteten rechtlichen Grundlagen aus dem Informationstext an und fördern somit ihre Problemlösungsfähigkeit und Fachkompetenz.
Durch die Anwendung dieser erlernten Grundlagen in einem praxisnahen Fall wie der Kündigungssituation von Lukas übertragen die Schüler ihr Wissen auf eine konkrete Handlungssituation. Sie entwickeln dabei gemeinsam Lösungsvorschläge und besprechen ihre Handlungsoptionen im Austausch mit den Mitschülern. Dieser Austausch fördert nicht nur das Verständnis der rechtlichen Grundlagen, sondern stärkt auch die Fähigkeit, Problemlösungen im Team zu erarbeiten. Gleichzeitig lernen die Schüler, wie sie in ähnlichen Situationen in ihrem beruflichen Alltag angemessen handeln können. Dies fördert ihre Problemlösungsfähigkeit und bereitet sie darauf vor, rechtliche und berufliche Herausforderungen in ihrer Praxis kompetent zu bewältigen.
Lernziel 3 (LZ3):
Indem die Schüler in der abschließenden Reflexion zunächst in einer Murmelphase und anschließend mit einem One-Minute Paper ihre Gedanken und Antworten zur Reflexionsfrage formulieren und aufschreiben, stärken sie ihre Fähigkeit zur Selbstreflexion und erweitern ihre Methodenkompetenz.
Die Reflexionsphase bietet den Schülern die Möglichkeit, sich über ihren Lernfortschritt bewusst zu werden und das Gelernte in Bezug auf ihre Ausbildung zu reflektieren. Durch den Austausch mit dem Sitznachbarn in der Murmelphase können die Schüler ihre Gedanken zur Unterrichtsstunde kurz und prägnant diskutieren, was ihnen hilft, ihre Erkenntnisse zu festigen. Anschließend wird das Besprochene in einem One-Minute Paper zusammengefasst, wodurch die Schüler lernen, das Wesentliche der Stunde auf den Punkt zu bringen. Dies fördert ihre Fähigkeit, Inhalte zu reduzieren und in einer klaren Struktur darzustellen.
4 Methodische Analyse
Die Unterrichtsstunde ist schülerzentriert und bietet eine praxisnahe Einführung in die rechtlichen Grundlagen des Berufsausbildungsvertrags, insbesondere zu Beginn, Dauer und Beendigung. Da sich die Schüler im ersten Ausbildungsjahr befinden und ihren Vertrag erst kürzlich unterzeichnet haben, ist die berufliche Handlungssituation von Lukas, der von einer fristlosen Kündigung bedroht ist, ein passender Ausgangspunkt. Diese Situation ermöglicht es den Schülern, praxisorientierte Handlungsempfehlungen zu erarbeiten und fördert ihre Identifikation mit dem Thema. So wird der direkte Bezug zum Ausbildungsalltag hergestellt, was das Thema für die Schüler relevant und zugänglich macht.
Zu Beginn der Stunde lasse ich die Handlungssituation von einem Schüler an der digitalen Tafel laut vorlesen. Die Handlungssituation wird dabei auch auf Papier bereitgestellt, sodass alle anderen Schüler mitlesen können. Dieser methodische Ansatz dient dazu, die Schüleraktivität zu erhöhen und sicherzustellen, dass möglichst alle Schüler aktiv mitlesen und den Inhalt der Situation verstehen. So sind alle auf dem gleichen Wissensstand und können besser in die anschließende Analyse einsteigen. Im Anschluss gebe ich den Schülern Zeit, das Szenario zu analysieren und das zentrale Problem zu erkennen. Dabei erhalten sie den Raum, ihre ersten Eindrücke und Ideen frei zu äußern, ohne dass ich zu stark lenke. Auf diese Weise fördere ich eine selbstständige Beschäftigung mit dem Thema und die Schüler können ihre eigenen Überlegungen einbringen. In der folgenden Phase nutzen wir die von den Schülern geäußerten Ansichten, um das Problem klar zu definieren und leiten in die ausführende Erarbeitungsphase über.
Nachdem wir die berufliche Handlungssituation besprochen haben, werde ich die Schüler anweisen, in Partnertandems zu arbeiten. Dabei arbeiten sie nach der bestehenden Sitzordnung mit ihrem direkten Sitznachbarn zusammen. Zunächst erhalten sie den Auftrag, gemeinsam den Informationstext zu den rechtlichen Grundlagen von Beginn, Dauer und Beendigung des Berufsausbildungsvertrags gründlich durchzulesen. Anschließend sollen sie sich im Tandem darüber austauschen, wie die wesentlichen Informationen aus dem Text korrekt auf das Arbeitsblatt übertragen und die Lücken ausgefüllt werden. Durch die Zusammenarbeit im Partnertandem möchte ich sicherstellen, dass die Schüler sich gegenseitig unterstützen und die Informationen besser erfassen. Diese Methode erlaubt es den Schülern, sich aktiv mit dem Stoff auseinanderzusetzen und die Inhalte gemeinsam zu erarbeiten, bevor wir die Ergebnisse später im Plenum besprechen.
Ich werde während dieser Erarbeitungsphase zur Verfügung stehen, um Fragen zu beantworten und unterstützend einzugreifen, falls die Schüler Schwierigkeiten haben. Die Arbeit im Partnertandem ermöglicht es den Schülern, sich intensiv mit dem Unterrichtsmaterial zu beschäftigen und fördert ihre Fähigkeit zur Informationsverarbeitung. Im Rahmen der Binnendifferenzierung erhalten Schüler mit sprachlichen Barrieren einen reduzierten Informationstext, der auf ihre Fähigkeiten zugeschnitten ist. Darüber hinaus werden ausgewählte Fremd- und Fachbegriffe in Sprechblasen direkt auf dem Informationstext näher erklärt, um den Schülern das Verständnis dieser Begriffe zu erleichtern. Das Arbeitsblatt ist für alle Schüler einheitlich gestaltet, um eine gemeinsame Arbeitsgrundlage zu schaffen. Dadurch arbeiten alle Schüler auf das gleiche Ergebnis hin, was den Austausch und die Zusammenarbeit verbessert. Zudem ermöglicht es jedem Schüler, die Aufgaben strukturiert zu bearbeiten, wodurch das Lernziel effizienter erreicht wird.
In der Ergebnissicherung werde ich die Schüler fragen, welches Tandem-Paar freiwillig seine Ergebnisse vorstellen möchte. Finden sich keine freiwilligen Schüler, werden diese nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Die beiden Schüler treten dann vor die Klasse und visualisieren ihre Arbeitsblätter mit Hilfe einer Dokumentenkamera und präsentieren ihre Ergebnisse. Falls notwendig gehe ich gezielt auf Ergänzungen ein.
Nachdem wir die erarbeiteten Lösungen besprochen haben, werde ich die berufliche Handlungssituation über Lukas erneut visualisieren. Die Schüler sollen daraufhin ihre Lösungsvorschläge äußern, die ich im Textfeld auf dem Glass Room Screen notieren werde, sodass alle Schüler die Antworten einsehen können.
Nun haben die Schüler die Möglichkeit, die zuvor erarbeiteten rechtlichen Grundlagen zur Kündigung anzuwenden und auf die reale Problematik von Lukas zu übertragen. Ziel ist es, gemeinsam herauszufinden, ob und wie Lukas sich gegen die drohende Kündigung wehren kann. Diese Phase fördert das praxisnahe Anwenden des Wissens und die Fähigkeit der Schüler, Lösungsansätze für reale Probleme zu entwickeln.
Zum Abschluss der Unterrichtsstunde möchte ich, dass die Schüler durch die von mir gestellte Frage " Welchen Aspekt aus der heutigen Stunde haltet ihr für eure Ausbildung am wichtigsten?“ den Inhalt reflektieren. Dafür werden die Tandempartner in einer Murmelphase sich gezielt unterhalten und anschließend durch das One-Minute Paper, ihre Antworten schriftlich festhalten. Ich stelle einen Timer über den Glass Room Screen und nutze anschließend den Random Name Picker, um zufällig drei Schüler auszuwählen, die ihre Antworten vor der Klasse mündlich präsentieren. Dies fördert gleichzeitig die Aufmerksamkeit, weil die Schüler bis zum Ende der Stunde aktiv bleiben, in Erwartung, dass sie vielleicht ausgewählt werden. Durch die zufällige Auswahl wird zudem sichergestellt, dass keine unbewusste Bevorzugung bestimmter Schüler stattfindet, was zu mehr Objektivität führt. Zudem werden durch die Methode auch ruhigere Schüler in den Reflexionsprozess einbezogen, was ihre aktive Beteiligung steigert.
Sollte noch Zeit bleiben, werde ich Fünf Fragen zum Stundenthema stellen, um das Gelernte zu festigen. Die Fragen werden sich auf die Dauer und Beendigung des Berufsausbildungsvertrags beziehen und einfache Anwendungsbeispiele enthalten. Diese Wiederholung im Lehrer-Schüler-Gespräch ermöglicht es den Schülern, das Thema zu vertiefen und ihr Wissen zu überprüfen.
Anmerkung des Lektorats: Tabellen sind in der Leseprobe nicht enthalten.
Literaturverzeichnis
Brüggemann, Martin, Dietmar Lindner, Claudia Rückoldt, et al. (2021): Wirtschaftslehre für gewerblich-technische Berufe. 19. Auflage. Bildungsverlag EINS.
Grob, Helmut, Andreas Hansen, Ingrid Overlack (2019): Betriff: Wirtschaft - Wirtschafts- und Sozialkunde für die Berufsbildung. 11. Auflage. Bildungsverlag EINS.
Klafki, Wolfgang (1964). Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. 1. Auflage. Weinheim: Beltz.
Klafki, Wolfgang (2007). Bildungstheorie und Didaktik. Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. 6. Auflage. Weinheim: Beltz.
Meyer, Hilbert (2015). Leitfaden Unterrichtsvorbereitung. 8. Auflage. Berlin: Cornelsen.
Positionspapier zur Formulierung von Lernzielen (2024). Leitfaden zur Erstellung kompetenzorientierter Lernziele in der Berufsbildung. Erfurt: Thüringer Institut für Lehrerbildung.
Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (2020). Rahmenlehrplan Wirtschaft und Recht für die berufsbildenden Schulen in Thüringen. Erfurt.
Wüst, Ivo (2015). Didaktik und Methodik im Unterricht. Praxisorientierte Ansätze für den Berufsschulunterricht. München: Oldenburg Verlag.
Ziegler, Birgit (2019): Bildungsziele und Kompetenzen: Die Taxonomien von Bloom und ihre Weiterentwicklungen“, in: Sacher, Werner (Hrsg.): Bildungsstandards, Kompetenzen und Kompetenzmodelle: Theoretische Grundlagen und empirische Befunde. Verlag: Springer VS, Wiesbaden.
Internetquellen
Kanzlei Hasselbach (2024). Kündigung und Kündigungsschutz von Auszubildenden. Abgerufen am 15. September 2024, von https://www.kanzlei-hasselbach.de/blog/kuendigung-und-kuendigungsschutz-von-auszubildenden/#ablauf.
Bundesministerium der Justiz (2024). § 314 BGB – Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund. Abgerufen am 15. September 2024, von https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__314.html.
Bundesinstitut für Berufsbildung (2024). Berufsbildungsgesetz (BBiG). Abgerufen am 15. September 2024, von https://tlbg.thueringen.de/fileadmin/TLBG/Wir_ueber_Uns/Karriere/Berufsausbildung/BBiG.pdf.
Niederrheinische IHK. (2020). Späterer Ausbildungsstart. Abgerufen am 15. September 2024, von https://www.nw-ihk.de/2020/07/spaeterer-ausbildungsstart/.
Industrie- und Handelskammer Stuttgart. (2024). Kündigung des Ausbildungsverhältnisses. Abgerufen am 15. September 2024, von https://www.ihk.de/stuttgart/fuer-unternehmen/fachkraefte-und-ausbildung/ausbildung/waehrend-der-ausbildung/kuendigung-688576.
Canva. (2024). Designs und Vorlagen für den Unterricht. Abgerufen am 15. September 2024, von https://www.canva.com.
Schulportal Thüringen (2024). Berufsausbildung – Schulportal. Abgerufen am 15. September 2024, von https://schulportal.de/?cmd=suche&s=berufsausbildung&ls=0&smd%5Btyp%5D%5B%5D=9.
Karlsruher Institut für Technologie (2024). Personalentwicklung / Hochschuldidaktik, von https://www.peba.kit.edu/downloads/One-Minute-Paper.pdf.
Industrie und Handelskammer. (2024) Abgerufen am 06. Oktober 2024, von https://www.ihk.de/oldenburg/geschaeftsfelder/ausbildungweiterbildung/ausbildung/tipps-zur-ausbildung/abmahnung-von-auszubildenden-3346912#:~:text=In%20der%20Regel%20muss%20der,von%20vertragswidrigem%20Verhalten%20beziehen%20müssen.
Bundeszentrale für politische Bildung (2013). Abgerufen am 06. Oktober 2024, von https://www.bpb.de/lernen/angebote/grafstat/partizipation-vor-ort/155247/partnertandem/.
Wikipedia (2024). Murmelgruppe, abgerufen am 07. Oktober 2024, von https://de.wikipedia.org/wiki/Murmelgruppe.
IHK (2024). Aufhebungsvertrag, abgerufen am 06. Oktober 2024, von https://www.ihk.de/duesseldorf/ausbildung/ausbildung-von-a-z/aufhebungsvertrag-2596798.
IHK (2024). Insolvenz in der Ausbildung, abgerufen am 07. Oktober 2024, von https://www.ihk.de/oldenburg/geschaeftsfelder/ausbildungweiterbildung/ausbildung/tipps-zur-ausbildung/insolvenz-des-ausbildungsbetriebes-3346838.
WBS Legal (2024). Abgerufen am 13. Oktober 2024, von https://www.wbs.legal/arbeitsrecht/abmahnung/auszubildende/.
Anmerkung des Lektorats: Der Anhang ist in der Leseprobe nicht enthalten.