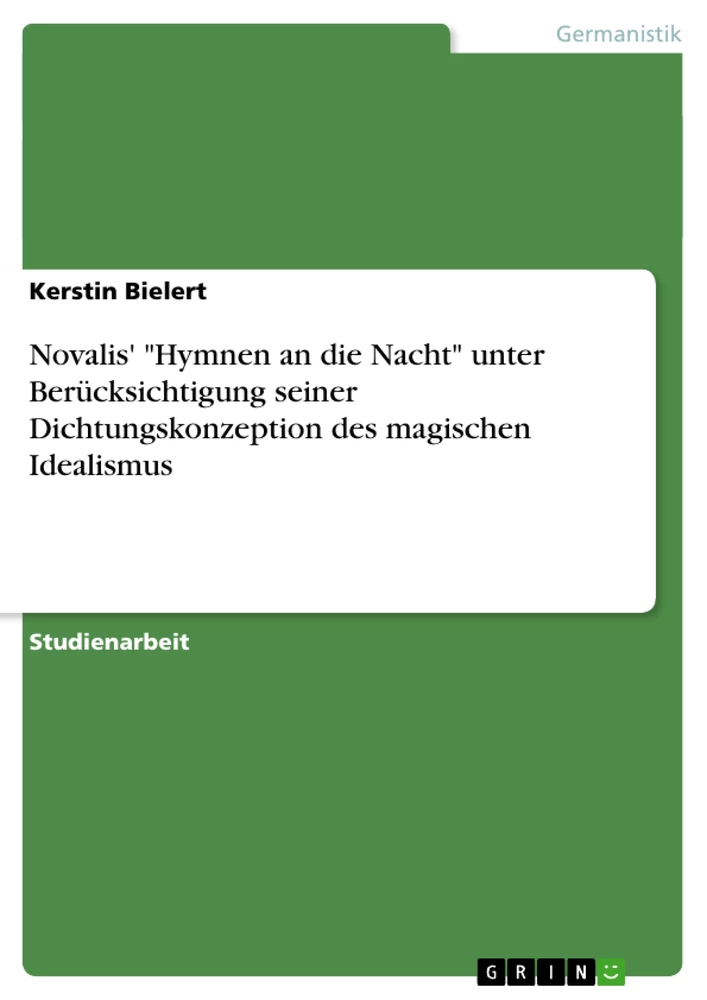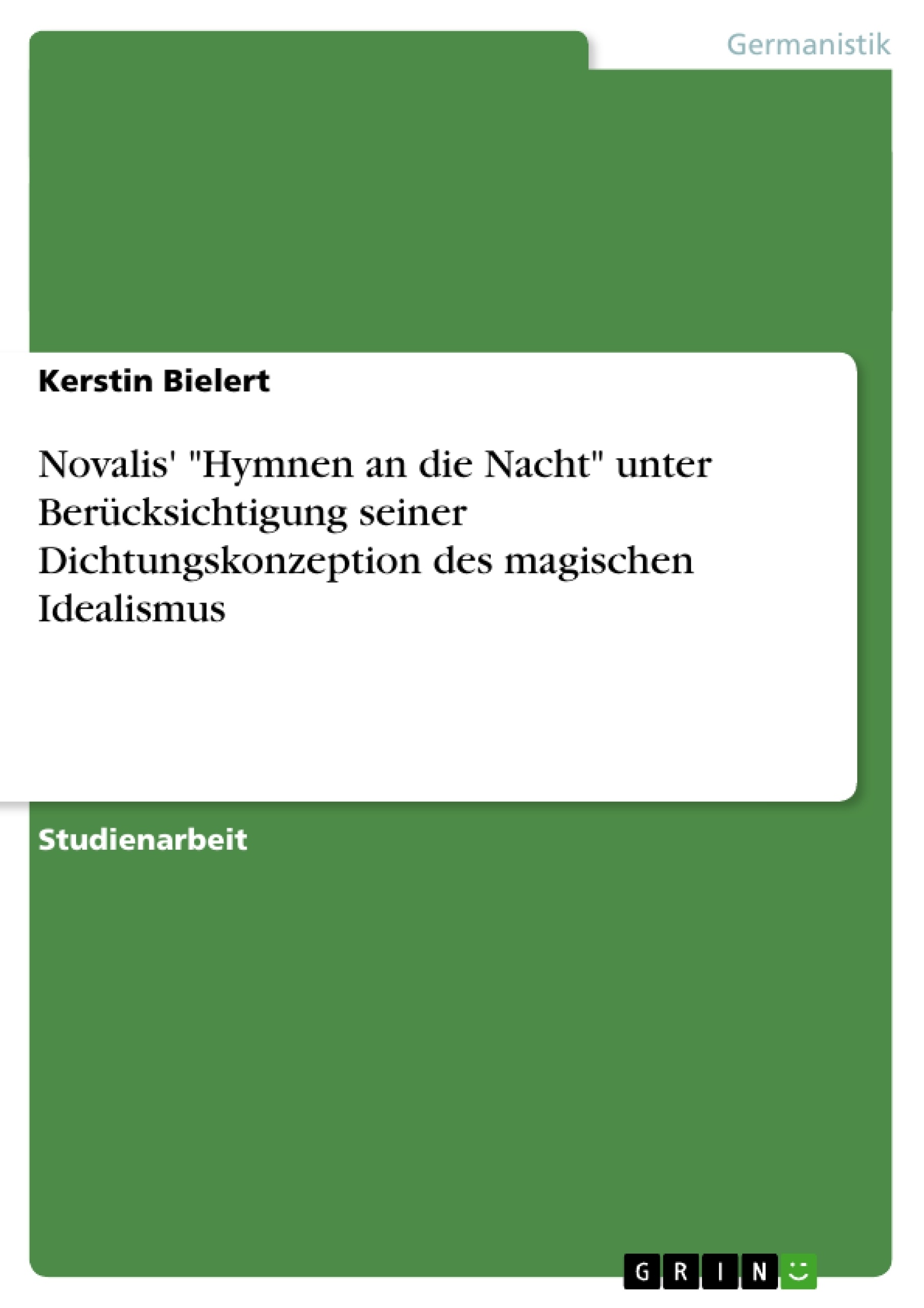Novalis, geboren als Freiherr Friedrich von Hardenberg am 2. Mai 1772 auf
Schloß Oberwiederstedt im damaligen Kursachsen, war neben Schelling, Tieck
und den Gebrüdern Schlegel der bedeutendste Schriftsteller der deutschen Romantik.
Hardenberg beschäftigte sich mit Kant und Fichte und erforschte ihre
Philosophien, welche er weiterentwickelte. Dies nahm deutlichen Einfluß auf
seine Schriften. Jedoch blieben die meisten seiner verfaßten Gedichte unvollendet.
In meiner Arbeit werde ich die „Hymnen an die Nacht“, die Ereignisse und
Entwicklungen zwischen 1797 und 1799/1800 veranschaulichen, von welchen
Novalis stark beeinflußt wurde, untersuchen. Diese waren der Tod seiner Braut
Sophie von Kühn und die Verlobung mit Julie von Charpentier, die Freiberger
Zeit mit ihren neuen Gedanken über die Zusammenhänge von Geist und Natur,
Immanenz und Transzendenz, die Selbstverständigung über die Religion und außerdem
Novalis‘ engagierte und erfolgreiche Berufstätigkeit1.
Wie bereits erwähnt, erweiterte Novalis – sein selbstgewähltes Pseudonym bedeutet
soviel wie „von Roden“ oder „der Neuland Bestellende“2 – Kants und
Fichtes philosophische Gedanken bezüglich des sogenannten „traszendentalen
Idealismus“. Dieses Neuland, das Novalis hierbei betrat, nannte er magischen
Idealismus, den ich, bevor ich auf sein Werk „Hymnen an die Nacht“ zu sprechen
komme, im ersten Teil meiner Arbeit in den wichtigsten Zügen erläutern werde.
1 vgl. Uerlings, Herbert. Novalis. Stuttgart: Reclam, 1998; S.128.
2 vgl. Uerlings: Novalis; S. 44.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Zur Dichtungskonzeption des magischen Idealismus
- 1.1 Die Theorie Kants als Basisgedanke
- 1.2 Fichtes Weiterentwicklung des Basisgedanken Kants
- 1.3 Novalis magischer Idealismus
- 2. Die „Hymnen an die Nacht“
- 2.1 Allgemeine Überlegungen
- 2.2 Die „Hymnen an die Nacht“ unter Berücksichtigung des magischen Idealismus
- 3. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Novalis’ „Hymnen an die Nacht“ und untersucht deren Entstehung im Kontext seines magischen Idealismus. Die Arbeit analysiert die Einflüsse von Kant und Fichte auf Novalis’ Dichtungskonzeption und beleuchtet die Verbindung zwischen den „Hymnen an die Nacht“ und dem Konzept des magischen Idealismus. Dabei wird insbesondere auf die Rolle des Todes, die Beziehung von Geist und Natur sowie die Bedeutung der Religion eingegangen.
- Novalis’ magischer Idealismus und seine philosophischen Wurzeln bei Kant und Fichte
- Die „Hymnen an die Nacht“ als Ausdruck des magischen Idealismus
- Die Bedeutung des Todes, der Liebe und der Religion in Novalis’ Werk
- Die Beziehung von Geist und Natur in den „Hymnen an die Nacht“
- Novalis’ Dichtungskonzeption und ihre Relevanz für die deutsche Romantik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Arbeit ein und stellt Novalis als bedeutenden Vertreter der deutschen Romantik vor. Sie beleuchtet die Entstehung der „Hymnen an die Nacht“ und skizziert die zentralen Einflüsse, die Novalis’ Schaffen prägten, wie den Tod seiner Verlobten Sophie von Kühn und die Verlobung mit Julie von Charpentier.
Kapitel 1 widmet sich Novalis’ magischem Idealismus, seiner Weiterentwicklung der transzendentalen Philosophie Kants und Fichtes. Es wird die Bedeutung der Poesie für den magischen Idealismus erläutert, die die gegenständliche Natur in eine Fülle von Selbstbegegnungen des Geistes verwandelt.
Kapitel 2 analysiert die „Hymnen an die Nacht“ im Kontext des magischen Idealismus. Es werden die zentralen Themen und Motive des Werkes im Lichte der Dichtungskonzeption des magischen Idealismus betrachtet.
Schlüsselwörter
Magischer Idealismus, Transzendentale Philosophie, Kant, Fichte, Novalis, „Hymnen an die Nacht“, deutsche Romantik, Geist, Natur, Tod, Liebe, Religion, Dichtungskonzeption.
- Quote paper
- Kerstin Bielert (Author), 2002, Novalis' "Hymnen an die Nacht" unter Berücksichtigung seiner Dichtungskonzeption des magischen Idealismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15123