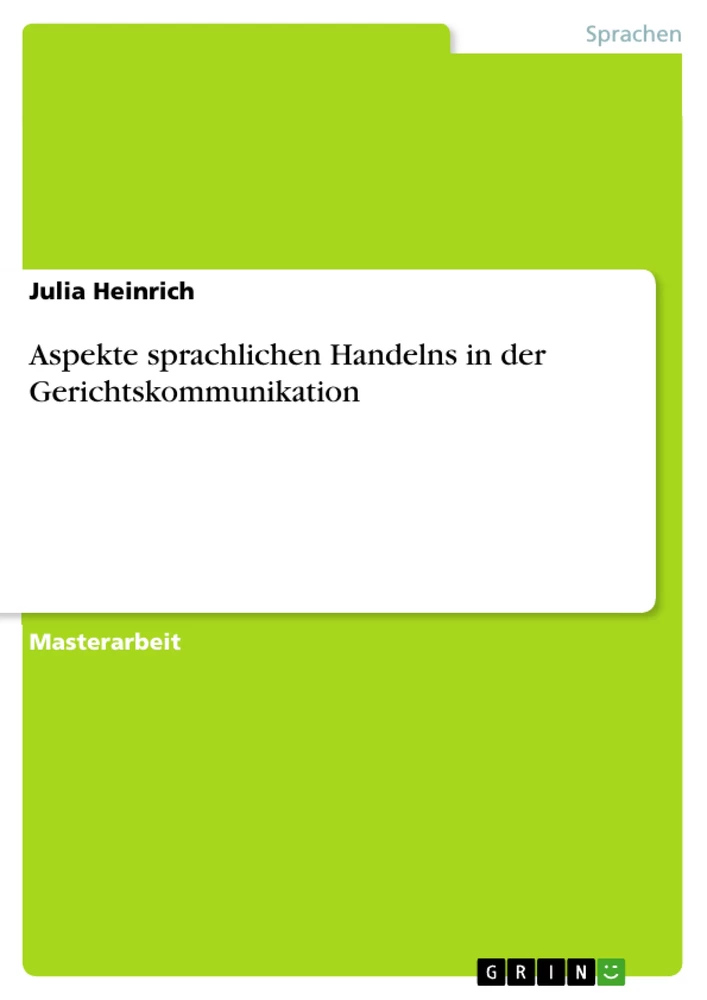Gegenstand der Arbeit ist die Analyse einer Strafverhandlung unter dem Aspekt der interkulturellen Kommunikation vor Gericht. Obwohl die Gerichtskommunikation wie auch die interkulturelle Kommunikation in der Sprachwissenschaft und insbesondere in der linguistischen Diskursanalyse bereits in zahlreichen Forschungsarbeiten untersucht worden sind, stellt die Beschäftigung mit dem Zusammenhang beider Bereiche noch immer ein Forschungsdefizit dar. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Deutschland seit langem ein Einwanderungsland ist und ein nicht unbeträchtlicher Teil der Straftaten von Personen ohne deutschen Pass bzw. mit Migrationshintergrund begangen werden, verdient die Problematik eine größere Beachtung.
Die Relevanz des Themas ergibt sich aus der Bedeutung der Sprache für das Gericht: Der Fall ist sprachlich konstituiert, Sprache ist „ein Mittel zur mentalen Bearbeitung verbalisierter Gedanken“ (Hoffmann 1997:201). Vor Gericht wird ein Ereignis vor dem Hintergrund von Normalitätserwartungen sprachlich zum Fall gemacht. Gerichtsverhandlungen werden mündlich ausgetragen; alles was in das Urteil eingehen soll, muss mündlich zur Sprache kommen. Haben wir es mit Beteiligten mit Migrationshintergrund zu tun, ist die Kommunikation nicht nur durch institutionelle, sondern auch durch interkulturelle Faktoren beeinflusst. Daher ist zu erwarten, dass interkulturelle Kommunikation vor Gericht aufgrund unterschiedlicher Kulturstandards oder sprachlicher Defizite der Beteiligten häufiger zu Missverständnissen führt bzw. leichter scheitert als Kommunikation zwischen Angehörigen derselben Kultur.
Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, diese Forschungslücke zu schließen. Dazu wird eine authentische Strafverhandlung unter Aspekten der Interkulturalität analysiert. Die übergreifende Fragestellung lautet, wie Interkulturalität einen konkreten Diskurs, d.h. eine Strafverhandlung beeinflussen kann bzw. in welchen Ausprägungen man Interkulturalität darin vorfindet.
Leitfragen:
– Kommt es zu -interkulturell bedingten- Brüchen oder Konflikten in der Kommunikation?
– Welche Rolle spielen die sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten der Beteiligten?
– Welche Probleme oder Missverständnisse entstehen aus dem Zusammenspiel von institutionellen und interkulturellen Faktoren?
– In welcher Weise ist Interkulturalität für die Aktanten relevant?
– Welche unterschiedlichen Wissenshintergründe, Wertorientierungen und Normvorstellungen spielen eine Rolle?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- Grundlagen der Diskursanalyse
- Diskursanalyse und Funktionale Pragmatik
- Institution
- Handlungsmuster und Zwecke
- Prozeduren
- Methodologie
- Institutionelle Bedingungen der Kommunikation vor Gericht
- Mündlichkeitsprinzip
- Vom Ereignis zum Fall
- Normalität und Glaubwürdigkeit
- Wissen und Wirklichkeit
- Darstellungsformen
- Erzählende Darstellung
- Berichtende Darstellung
- Frage-Antwort-Muster
- Argumentation
- Interkulturelle Kommunikation
- Begriffsbestimmung
- Interkulturelle Aspekte der Gerichtskommunikation
- Gerichtskommunikation und Kulturwertsysteme
- Dolmetschen
- ANALYSE EINER VERHANDLUNG
- Zusammenfassung der Verhandlung
- Sprachliche Verständigungsprobleme
- Beispiel 1: „Drei.“ – „Ja.“ – „Oder fünf?“
- Beispiel 2: „Ich glaub wir vertiefen das mal besser nich“
- Beispiel 3:,,So gegen/ so wie Fenster”
- Interkulturelle Verständigungsprobleme
- Über Scham, Beleidigung und Ehre
- Beispiel 4: „Nee, nich,natürlich'!\”
- Beispiel 5: „Die Leute, Leute un alles gucken uns an“
- Beispiel 6: „Die haben’'n anderes Ehrgefühl”
- Beispiel 7: „Sagen Sie nicht dieses, blablabla”“
- Beispiel 8: „Da liegt es doch nahe, da würde ich erwarten, dass man nochmal sein Missfallen darüber äußert!\”
- Beispiel 9: „Des war Letzte für mich”
- Beispiel 10: „aber das geht hier nich, dass Sie andre Leute schlagen, auch wenn Ihre Ehre noch so verletzt is”
- Beispiel 11: „Man muss nicht immer alles so empfindlich dann nehmen”
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit analysiert eine Strafverhandlung unter dem Aspekt der interkulturellen Kommunikation vor Gericht. Sie untersucht, wie Interkulturalität einen konkreten Diskurs, d.h. eine Strafverhandlung, beeinflussen kann und in welchen Formen und Ausprägungen sie darin vorzufinden ist.
- Sprachliche Verständigungsprobleme in interkulturellen Gerichtsverhandlungen
- Der Einfluss von Kulturwertsystemen auf die Gerichtskommunikation
- Die Rolle des Dolmetschens in der interkulturellen Gerichtskommunikation
- Die Bedeutung des Mündlichkeitsprinzips im Kontext von Interkulturalität
- Die Analyse von konkreten Beispielen aus einer Strafverhandlung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der interkulturellen Kommunikation vor Gericht ein und erläutert die Relevanz des Themas. Der theoretische Teil der Arbeit behandelt die Grundlagen der Diskursanalyse, die institutionellen Bedingungen der Kommunikation vor Gericht und die Besonderheiten der interkulturellen Kommunikation. Die Analyse einer Strafverhandlung umfasst die Zusammenfassung der Verhandlung, die Analyse sprachlicher Verständigungsprobleme und die Untersuchung von interkulturellen Verständigungsproblemen. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kommunikation, Gerichtskommunikation, Diskursanalyse, Sprachliche Verständigungsprobleme, Kulturwertsysteme, Dolmetschen, Strafverhandlung, Mündlichkeitsprinzip.
Häufig gestellte Fragen
Welche Probleme entstehen bei interkultureller Kommunikation vor Gericht?
Unterschiedliche Kulturstandards, sprachliche Defizite und abweichende Normvorstellungen (z. B. Ehrbegriffe) führen häufig zu Missverständnissen oder Fehlinterpretationen von Aussagen.
Welche Rolle spielen Dolmetscher in Strafverhandlungen?
Dolmetscher sind essenziell für die sprachliche Verständigung, stellen aber auch eine zusätzliche Ebene im Kommunikationsgefüge dar, die Einfluss auf die Dynamik der Befragung hat.
Was bedeutet das Mündlichkeitsprinzip im Gerichtskontext?
Alles, was in das Urteil einfließen soll, muss mündlich zur Sprache kommen. Für Beteiligte mit Migrationshintergrund kann dies aufgrund sprachlicher Hürden eine große Barriere darstellen.
Wie beeinflussen Kulturwertsysteme die Wahrnehmung von Glaubwürdigkeit?
Wenn Verhaltensweisen oder Erzählmuster nicht den deutschen „Normalitätserwartungen“ entsprechen, kann dies fälschlicherweise als mangelnde Glaubwürdigkeit ausgelegt werden.
Was untersucht die funktionale Pragmatik in dieser Arbeit?
Sie analysiert die sprachlichen Handlungsmuster und Zwecke innerhalb der Institution Gericht, um zu verstehen, wie aus einem realen Ereignis ein juristischer „Fall“ konstruiert wird.
- Citation du texte
- Julia Heinrich (Auteur), 2009, Aspekte sprachlichen Handelns in der Gerichtskommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151205