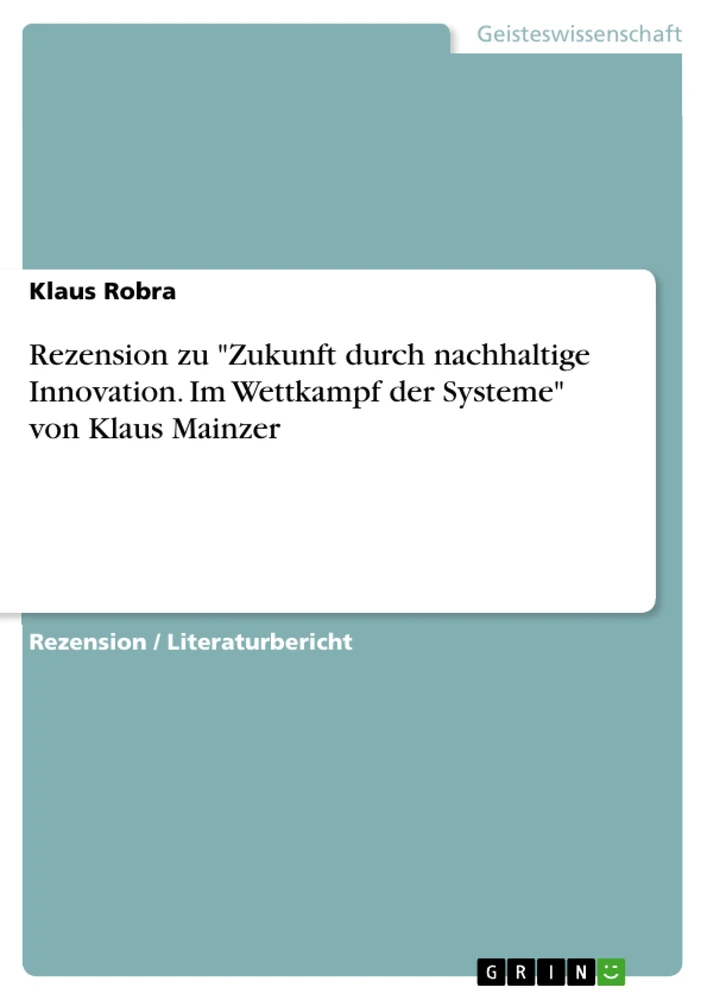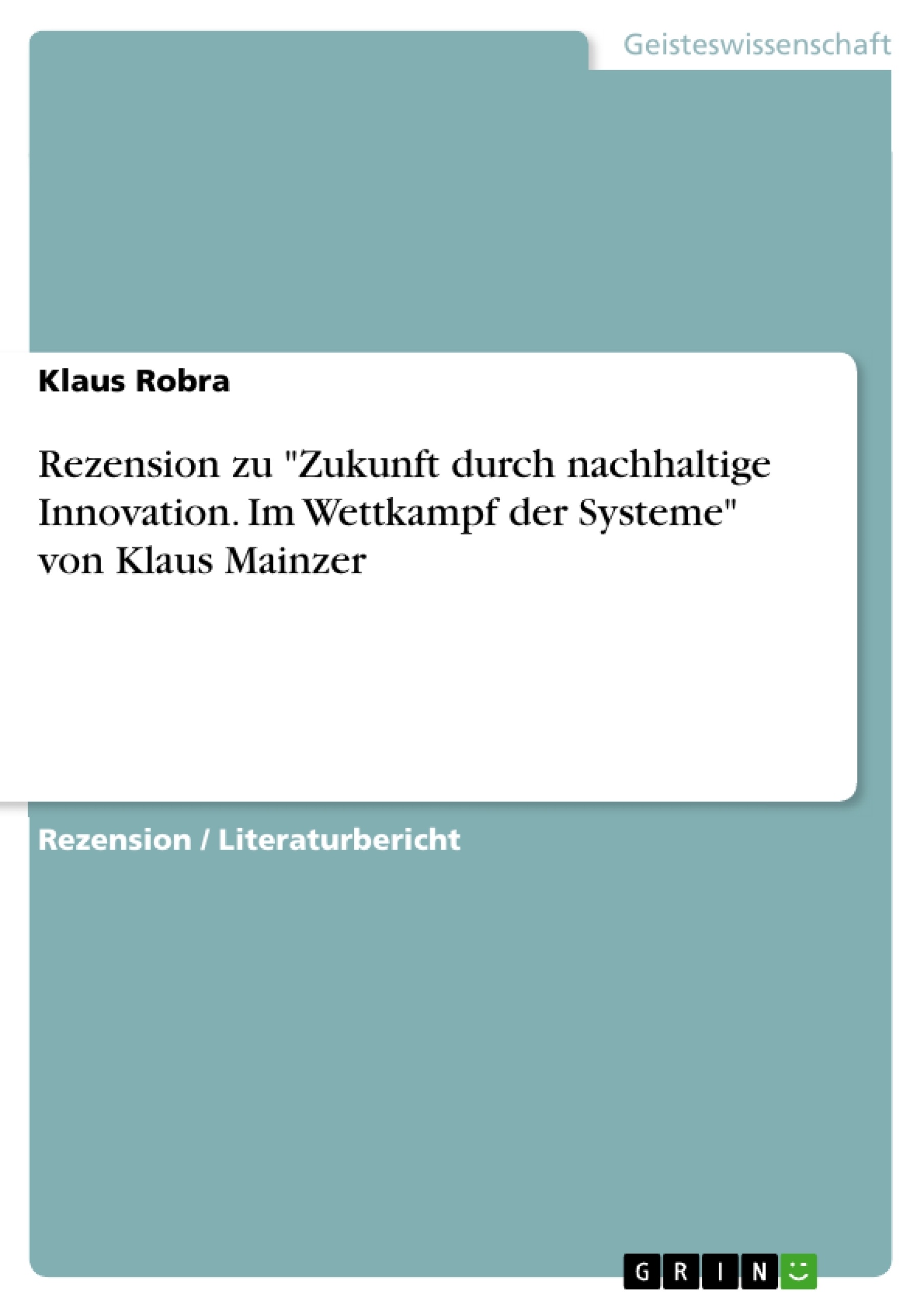Mainzers Kernthese besteht in der Behauptung, Innovation sei in jeder Hinsicht vonnöten, zumal die gegenwärtigen Krisen vor allem auf einen Mangel an strategischem Denken zurückzuführen seien. Der Schlüssel zu einer gelungenen Strategie für Europa heiße Innovation. Der Druck der gegenwärtigen Krisen sollte genutzt werden, um beschleunigt in nachhaltige Innovationen umzusteigen. So soll das eigentliche große Menschheitsproblem gelöst werden: die globale Umwelt- und Klimakrise. – Es folgt eine ausführliche kritische Würdigung.
Rezension zu: Klaus Mainzer: Zukunft durch nachhaltige Innovation. Im Wettkampf der Systeme, Berlin 2023
Nach einer 15 Seiten umfassenden Einführung behandelt der Autor, ein 1947 geborener emeritierter Professor für Wirtschafts- und Technik-Philosophie, auf insgesamt 290 Seiten folgende sechs Themenkomplexe:
1. „Dynamik komplexer Systeme“,
2. „Innovation, Evolution, Disruption“,
3. „Energietechnologie und Nachhaltigkeit“,
4. „Informationstechnologie und Nachhaltigkeit“,
5. „Wettkampf der Wertesysteme“,
6. „Zukunft zwischen Nachhaltigkeit und planetarischem Aufbruch“,
ergänzt durch eine Autorenbiografie (S. IX). Einen ersten Zugang zu den Inhalten des Buches vermittelt der Klappentext, in dem es heißt:
„Auf dem Hintergrund der aktuellen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Weltlage wird deutlich, woran es in der jüngsten Zeit gravierend mangelte – an strate-gischem Denken. Der Schlüssel zu einer gelungenen Strategie für Europa heißt Inno-vation. Der Druck der gegenwärtigen Krisen sollte genutzt werden, um beschleunigt in nachhaltige Innovationen umzusteigen. So soll das eigentliche große Menschheitspro-blem gelöst werden: die globale Umwelt- und Klimakrise.
Es darf dabei allerdings nicht auf eine einzige Lösung gesetzt werden, sondern es muss das gesamte technologische Potenzial in einem Innovationsportfolio gebündelt wer-den. Dazu müssen für Europa Vor- und Nachteile von z.B. Solar- und Windenergie, Wasserkraft, Wasserstoff, Kern- und Fusionsenergie gegeneinander abgewogen und in einem „hybriden“ Energiesystem miteinander verbunden werden, um das europäische Innovationsportfolio auf eine nachhaltige Zukunft auszurichten.
Wie in der Energiefrage darf auch bei der Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz nicht auf eine einzige Lösung gesetzt werden, sondern muss das gesamte technologische Potenzial in einem Innovationsportfolio gebündelt werden, um energieeffizient und nachhaltig zu sein. Im Wettkampf der Wertsysteme sollte sich Europa durch demokratische Rechtssicherheit auszeichnen.“
Mainzers Kernthese besteht also in der Behauptung, Innovation sei in jeder Hinsicht von-nöten, zumal die gegenwärtigen Krisen vor allem auf einen Mangel an strategischem Denken zurückzuführen seien. Bei den Ausführungen ist bemerkenswert, dass Mainzer (künftig: M.) sie immer wieder durch mit Symbolen versehene, graphisch illustrierte Exkurse, Merksätze, Definitionen, „Call-to-Actions“ und Zusatzmaterialien auflockert. In den „Call-to-Actions“ empfiehlt M., „sich eigene Gedanken zu einer bestimmten Fragestellung zu machen“ (S. X).
Die „Merksätze“ bieten dem Rezenten wertvolle Hinweise zur Erschließung der Inhalte. In der Einführung erläutert M. den Begriff „Phasenübergang“, den er vor allem in Naturwissen-schaft und Politik verortet. Als Beispiel aus der Physik nennt er die Aggregatszustands- veränderungen von H2O zwischen Eis und Wasserdampf. Auch in der Politik gebe es „kom-plexe dynamische Systeme“, in denen der Systemzustand an einem kritischen Punkt plötzlich in einen anderen umschlägt. So geschehen u.a. am 22. Februar 2022 durch Putins Angriffs-krieg auf die Ukraine. – Entwicklungstrends in dynamischen Systemen bezeichnet M. als „Pfade“; ständige Phasenübergänge konstatiert er in „Innovationsportfolios“, in denen „Ausgangs-, Brücken- und Zukunftstechnologien“ angeblich dynamisch zusammenwirken.
Zum Themenkomplex 1): „Dynamik komplexer Systeme“
Diese definiert M. als „Elemente, die sich in der Zeit verändern“ und durch zeitabhängige Gleichungen, z.B. Differentialgleichungen, beschrieben werden (S. 17). Dabei könne auch negative Rückkopplung beim Wachstum berücksichtigt werden (darstellbar z.B. durch den Faktor 1-x). Hier seien aber trotz der hohen Rechenkapazitäten heutiger PCs nur kurzfristige Voraussagen möglich. Für die entsprechende Berechenbarkeitsfrage hat der britische Compu-ter-Pionier Alan Turing (1912-1954) Grundlegendes geleistet. „Muster- und Strukturbildung wird durch lokale Aktivität ihrer Elemente ausgelöst. Das gilt nicht nur für Stammzellen beim Wachstum eines Embryos, sondern auch z.B. für Transistoren in elektronischen Netzen.“ (S. 28). Ohne diese Bildungen wären Radio, TV und Computer nicht funktionstüchtig. Ent-sprechendes gilt generell für die Musterbildung in komplexen Systemen.
Zum Themenkomplex 2): „Innovation, Evolution, Disruption“
In der Soziodynamik werden individuelle Mikroebenen von kollektiven Makroebenen unter-schieden. Die „Soziokonfigurationen“ werden mit sozialwissenschaftlichen Methoden model-liert. Als weiteres Beispiel für komplexe dynamische Systeme führt M. das Internet der Dinge [1] an. Einzelpersonen können die darin erforderlichen Organisationssysteme nicht mehr durchschauen. Trotzdem müssen systemische Risiken erkannt und vermieden werden; in der Evolution sei dies durch Selbstorganisation und Kontrolle erfolgt. Komplexitätsmanagement und Innovationsdynamik werden durch den Erfindungsgeist befördert. Mainzers Merksätze lauten dazu:
„Erfindungen sind nur neue Ideen und Umsetzungen von technischen Konzepten. Innovationen sind Erfindungen, die sich auf den Märkten durchsetzen oder von den Verbrauchern angenommen werden.“ (S. 39)
Innovationssysteme sind wissensabhängig und wissensintensiv.
Alsa „schillerndes Modewort“ gilt der Begriff Disruption. Dieser sei aber nur für Geschäfts-modelle originell. Alte Modelle oder Technologien werden darin durch neue ersetzt. Disruptiv sei „ein abrupt oder „schlagartig“ einsetzendes Ereignis“ (S. 42). Ausführlich beschreibt M. Innovationsprozesse in Unternehmen (S. 46 ff.), die vor allem auf „Spill-over“-Effekten [2] aus Industrie, Wissenschaft und je eigener Forschung beruhen. Wobei Computer-Simulationen eine besondere Rolle spielen, während Innovationspolitik auf dem Prinzip lokaler Aktivität basiert. Ein schwerwiegendes Problem sieht M. darin, dass der Mensch angesichts der Kom-plexität nicht-linearer Systeme, die zu verwalten sind, an die Grenzen seiner kognitiven Fähigkeiten gelangt. „Erdsystemingenieure“ sollen hier für Abhilfe sorgen und dabei auch die ethischen Implikationen von Lösungsvorschlägen beachten. Nachhaltigkeit sei „ein wichtiger Bestandteil bei der Entwicklung geeigneter Lösungen in der Erdsystemtechnik“ (S. 59). Mit Konsequenzen speziell für nachhaltiges Unternehmertum. Merksatz:
„Ein nachhaltiges Unternehmen muss die Kundenbedürfnisse erfüllen und gleichzeitig die Umwelt schonen.“ (S. 62)
Zum Themenkomplex 3): „Energietechnologie und Nachhaltigkeit“
Hier behandelt M. Solar- und Windenergie, Wasserkraft, Wasserstoff, Kernenergie, Fusions-energie und „Hybride Energiesysteme als nachhaltiges Innovationsportfolio“ (S. 67). Vor-gestellt werden die „Kosten erneuerbarer Stromversorgung“ (S. 71), der „Berufsmarkt für So-lar- und Windtechnologie“ (S. 73) sowie die hierfür gebotene „globale Technologieführung Europas“ (S. 75). M. fragt nach den Gründen dafür, dass die Kreislaufwirtschaft insgesamt nur langsam vorankomme (S. 77) und sieht Nachholbedarf im öffentlichen Beschäftigungs-wesen (auch auf EU-Ebene). Erforderlich seien gezielte Investitionen u.a. in Bildungs- und Umschulungsprogramme mit dem Ziel der sozialen Nachhaltigkeit, wobei kommunale Eigen-initiativen entscheidend seien, dies auch im Hinblick auf die angestrebte europäische Energiewende.
Auch Wasserkraft könne als erneuerbare Energie gewertet werden (S. 82 f.), wobei allerdings Energie- und Klimaziele gegeneinander abzuwägen seien (S. 83). Nicht weniger bedeutsam seien „gesetzliche Genehmigungsverfahren für Wasserkraftanlagen“ (S. 85), die „Innova-tionsgestaltung von Wasserkrafttechnologie“ (S. 86), deren Wirtschaftlichkeit unter öko-logischen Bedingungen sowie die „komplexe Systemdynamik der Wasserkrafttechnologie“ (S. 87 f.).
Zum Wasserstoff. Merksätze:
„Wasserstoff ist das häufigste chemische Element im Universum. Es ist sauber, sicher und steht nahezu unbegrenzt zur Verfügung. Wasserstoff ist ein unsichtbares, geruch-loses, ungiftiges Gas und leichter als Luft. Es tritt allerdings in dieser Form nicht in der Natur auf und muss als Gas erst hergestellt werden. Es gibt verschiedene Metho-den, um Wasserstoff zu gewinnen. Bei der Elektrolyse wird Strom durch Wasser gelei-tet, wodurch schließlich Wasserstoff als Gas freigesetzt wird. Wenn dabei Strom aus erneuerbaren Energiequellen eingesetzt, wird Wasserstoff noch umweltfreundlicher. Zudem lässt sich Wasserstoff leicht speichern und transportieren.“ (S. 89)
Daher richtet M. sein spezielles Augenmerk auf die „Wasserstofferzeugung durch erneuerbare Energien“ und die „Energiespeicherung mit Wasserstoff“ (S. 94 f.). – Merksätze zur Zukunft des Wasserstoffs:
„Mit vernetzten Strom-, Wärme-, Wasserstoff- und anderen Gasnetzen sind die komplementären Stärken der verschiedenen Energieträger entscheidend für die Systemintegration und die notwendige Kopplung der Sektoren von Wirtschaft und Gesellschaft. Zusammen mit der Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen eröffnet Wasserstoff die Möglichkeit, fossile Brennstoffe nachhaltig zu ersetzen.“ (S. 100)
Nichtsdestoweniger aber gelte die Kernfusion nicht nur als „langfristige Lösung des Energie-problems“, sondern auch als „einzige Alternative …, die alle Anforderungen in Bezug auf Emissionen und Produktion erfüllt“ (S. 126). Vorerst jedoch fordert M. „hybride Energie-systeme als nachhaltiges Innovationsportfolio“ (S. 127 ff.), sodann allerdings mit dem Call to Action: „Die Vielfalt hoch ausgereifter Energieinnovationen könnte sich als Standortvorteil erweisen. Bemerkenswert ist dabei, dass es eine vollständige Akzeptanz für Fusionsreaktoren in ganz Europa gibt. In der Tat wäre das die Ultima ratio, die „Sonnenenergie“ in un-begrenztem Ausmaß, weitgehend ohne Abfall und Risiko auf der Erde herstellen zu können.“ (S. 129).
Zum Themenkomplex 4): „Informationstechnologie und Nachhaltigkeit“
Hier geht es durchweg um bestimmte IT-Systeme, angefangen bei digitalen KI-Systemen, über digitale Quantensysteme schließlich zu neuromorphen hybriden IT-Systemen, letztere als „nachhaltiges Innovationsportfolio“ (S. 141 ff.). Zu den digitalen KI-Systemen schlägt M. zu-nächst eine neue Definition der KI vor. Diese soll „unabhängig vom Menschen“, aber abhän-gig von „messbaren Größen von Systemen“ sein. (Meine Frage: Wer, wenn nicht der Mensch, ist denn in der Lage, „Größen von Systemen“ zu messen?) Jedenfalls meint der Autor, Systeme heranziehen zu können, die „autonom“ Probleme lösen, und nennt dazu „z.B. Orga-nismen, Gehirne, Roboter, Automobile, Smartphones oder Accessoires …, die wir am Körper tragen (Wearables)“ (S. 143). (Wobei natürlich ins Auge fällt, dass diese Systeme entweder Teile des menschlichen Körpers oder von Menschen gemachte Dinge sind!) Mainzers Defini-tion von Intelligenz lautet:
„Ein System heißt intelligent, wenn es selbständig und effizient komplexe Probleme lösen kann. Der Grad der Intelligenz hängt vom Grad der Selbständigkeit (Auto-nomie), dem Grad der Komplexität des Problems und dem Grad der Effizienz des Pro-blemlösungsverfahrens ab.“ (S. 144)
(Es ist dies jedoch eine Definition, die nicht „unabhängig vom Menschen“ existiert, zumal ihre Faktoren ausnahmslos auch auf den Menschen anwendbar sind!)
Abgesehen davon gibt es zweifellos nach wie vor natürliche und künstliche Akteure, die dem Menschen in Teilbereichen intelligenzmäßig überlegen sind (z.B. in Schwarmintelligenz von Tieren, KI, Technik usw.). – Es gibt „subsymbolische“ KI-Systeme, in denen die „Statistik des Denkens“ an die Stelle der Logik tritt, und zwar in induktiven Verfahren. Demgemäß un-terscheidet M. zwischen statistischem Lernen und statistischem Schließen und definiert:
„ Statistisches Lernen versucht, ein probabilistisches Modell aus endlich vielen Daten von Ergebnissen (z.B. Zufallsexperimente) und Beobachtungen abzuleiten.
Statistisches Schließen versucht umgekehrt, Eigenschaften von beobachteten Daten aus einem angenommenen statistischen Modell abzuleiten.“ (S. 146)
Demgegenüber stellt das „Lernen mit neuronalen Netzen“ einen Sonderfall dar. Hier geht es um „Rechenmodelle nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns“, genauer: um Lernalgo-rithmen, Repräsentations- und Problemlösungskapazität und Mustererkennung, alles nicht ohne mögliche ethische Komplikationen:
„Niemand durchschaut oder kann im Einzelnen kontrollieren, was z.B. in den nichtli-nearen Wechselwirkungen der Neuronen und Synapsen eines neuronalen Netzes beim Machine Learning abläuft. Daher sind diese neuronalen Netze für Anwender und Ent-wickler „Schwarze Kästen“ (Black Boxes), die grundlegende Fragen der Sicherheit, des Vertrauens in Technik und der Verantwortung aufwerfen.“ (S. 148)
Zum Problemkreis „Neuronale Netze als komplexe dynamische Systeme“ untersucht M. eine Vielzahl von Aspekten, und zwar durchweg mittels mathematischer Verfahren, in denen sich die Komplexität der Netze in umfangreichen Funktionsgleichungen niederschlägt. Die Merksätze hierzu lauten:
„Für praktische und kommerzielle Anwendungen folgt daraus, dass große Netze von endlicher Breite den größten Erfolg effektiver Berechenbarkeit und Beherrschbarkeit versprechen. Es ist bemerkenswert, dass diese zentrale Einsicht für praktische Anwen-dung aus einer abstrakten, mathematischen Theorie folgt, in der die Analyse des Unendlichen eine zentrale Rolle spielt. Es bestätigt sich erneut: Um ein Problem ver-tieft zu verstehen und erklären zu können, ist eine gute mathematische Theorie unerlässlich.“ (S. 155)
Im Folgenden ergänzt M. seine Ausführungen zum statistischen Lernen und Schließen um die Dimension des „kausalen Domänenwissens“ (ebd.). Er definiert:
„Beim kausalen Schließen werden Eigenschaften von Daten und Beobachtungen aus Kausalmodellen, d.h. Gesetzesannahmen von Ursachen und Wirkungen, abgeleitet. Kausales Schließen ermöglicht damit, die Wirkungen von Interventionen oder Daten-veränderungen (z.B. durch Experimente) zu bestimmen.
Kausales Lernenversucht umgekehrt, ein Kausalmodell aus Beobachtungen, Mess-daten und Interventionen (z.B. Experimente) abzuleiten, die zusätzliche Gesetzes- und Strukturannahmen voraussetzen.“ (S. 156)
Im darauf folgenden Kapitel „Roboter als KI-Systeme“ fragt M. nach Sinn und Zweck huma-noider Roboter und unterschiedet zwischen konnektionistischen und handlungsorientierten Ansätzen, um sodann zu Roboterautos bzw. autonom fahrenden Kfz. überzugehen. Darüber hinaus wirbt er um Vertrauen in die KI, was z.B. durch das Zertifizieren aller technischen Werkzeuge erreicht werden könne. Urteilskraft und Wertorientierung der Menschen sollen ge-stärkt werden. Ein Computerprogramm müsse „im Idealfall … so sicher sein wie ein mathe-matischer Beweis“ (S. 165). Dies gelte erst recht für „KI-Systeme als Dienstleistungs-systeme“.
Danach geht M. in einem kurzen Exkurs auf die Probleme der „Autonomie in Philosophie, Recht und Gesellschaft“ ein (S. 168 f.). Da es freien, wenn auch nur relativ freien Willen gibt, vertritt M. zu Recht die Auffassung, dass „auch menschliche Handlungen und Entscheidungen nach Graden der Autonomie zu bemessen“ sind (ebd.).
Im Kapitel „Digitale Quantensysteme“ behandelt M. u.a. Grundlagen der Quantensysteme, darunter das Quantencomputing (einschließlich der damit verbundenen Gefahren und Sicher-heitsprobleme), die Entwicklung der Quantentechnologie sowie das Desiderat eines „univer-sellen Quantencomputers“ (S. 169 ff.). Im kommerziellen Einsatz befinden sich bereits „adia-batische [3] Quantenrechner“, d.h. nicht-universelle Quanten-PCs. Dem Quantencomputer bil-ligt M. ein hohes Innovationspotenzial zu, so „von der Navigation, Geologie und Erdbeobach-tung bis zur medizinischen Diagnostik, industrieller Präzisionstechnik und Militärtechnik“ (S. 177). Er schließt das Kapitel ab mit Überlegungen zu den Perspektiven von Wissenschafts- und Technik-Philosophie. Um nicht „betriebsblind“ zu werden, sei Philosophie gerade hier gefragt, nicht zuletzt um die Grundlagen, z.B. auch der Quantenmechanik, zu verstehen. Ver-antwortung bleibe nicht auf die akademische Ethik beschränkt, sondern sei ständig auch bei der Vermarktung von Quantentechnologie gefragt. Gesellschaftliche Akzeptanz sei hier nur erreichbar, wenn umfassende Bildungs- und Aufklärungsarbeit geleistet wird.
„Neuromorphe IT-Systeme“ (S. 185 f.). Hier geht es um hochkomplexe Wechselwirkungen auf den naturwissenschaftlich und ökologisch relevanten Gebieten. Gehirne können als „kom-plexe dynamische Systeme“ gelten (vgl. S. 186 f.). Allerdings gebe es noch Nachholbedarf in der Neurologie. Man habe nur erst Neuronen, Synapsen und Musterbildungen verstanden, nicht aber deren Verbindungen zum Denken bzw. zur Kognition. (Auf die Frage, ob dies an-gesichts der Unendlichkeit der neuronalen Kombinatorik der menschlichen Gehirne über-haupt möglich ist, geht M. nicht ein. Dafür aber u.a. auf einige Modelle komplexer Gehirn-dynamik, „photonische neuromorphe Schaltkreise“ und deren Energieverbrauch.)
„Hybride IT-Systeme als nachhaltiges Innovationsportfolio“ (S. 206 ff.). Laut M. stehen diese im Dienst von Nachhaltigkeit auch im Hinblick auf Energieverbrauch und Umweltbela-stung (S. 213)
Zum Themenkomplex 5): „Wettkampf der Wertsysteme“
Hier stellt M. diverse Systemvergleiche zwischen den Innovations-Entwicklungen vor allem in den USA, in Russland, China und der EU an. In den USA steht zunächst die „Big Science“ im Vordergrund. Dabei handelt es sich um Großforschungsprojekte, angefangen beim „Man-hattan“-Programm zum Bau der ersten Atombombe, auf die u.a. die Entwicklung erster Kern-reaktoren folgte. Daneben macht in den USA seit den 1980er Jahren ein völlig anderer For-schungstyp Furore: Kleinstgruppen von Forschern und Erfindern sowie aus universitären Forschungsgruppen entstandene „Start-ups“, die sich dann mittels privater Sponsorengelder auf den internationalen Märkten etablieren. Als Fallbeispiele nennt M. die Quantentechnolo-gie und Silicon Valley. Wobei das US-Wertesystem der individuellen Freiheit eine entschei-dende Rolle gespielt habe. Die Merksätze hierzu enthalten einige – wenige – kritische Anmer-kungen am US-System, zu denen M. sich bereit findet, indem er auf Mängel in den staatlichen Systemen sozialer Absicherung und das andauernde Vorherrschen der calvinistischen Tradition individueller, nicht kollektiver Moral hinweist, die zwar mit einem hochentwickel-ten, gesetzlich geförderten Stiftungswesen, aber auch mit kriminellen Auswüchsen verbunden sei: „Dass allerdings jeder per Verfassung eine Waffe tragen darf, gehört aus europäischer Sicht zu den eher skurrilen Konsequenzen einer Verabsolutierung individueller Freiheit.“ (S. 235)
(Leicht verdutzt fragt man sich: War das schon das ganze US-System der Innovation?) Wie dem auch sei: Nach ca. 9 (!) Seiten zu den USA wechselt M. zum Thema: „Fossile Energien, Imperium und Autokratie (Russland)“ (ebd.). Bemerkenswert ist, dass M. die Einschätzung Obamas aus dem Jahr 2014 teilt, wonach Russland lediglich noch eine „Regionalmacht“ sei; wobei M. hinzufügt, dass Russland nach wie vor eine hochgerüstete Atommacht sei, aber: „Wie die genannten historischen Beispiele zeigen, wird aber ohne innovative und wirtschaft-liche Basis auch die militärische Überlegenheit implodieren. Genau das war 1989 für die UdSSR eingetreten.“ (S. 238). Dies, nachdem der Autor zuvor eine Parallele zwischen dem am 22.2.2022 begonnenen russischen Angriffskrieg und dem NS-Regime gezogen hatte. Das dahinter steckende Denken (das z.B. Carl Schmitt 1934/35 gerechtfertigt hatte) richte sich un-mittelbar gegen das Völkerrecht und legitimiere den Angriffskrieg. (Stimmt diese Parallele, ist Russland zweifellos immer noch mehr als eine bloße „Regionalmacht“!)
Im Übrigen erinnert M. daran, dass Russland in seiner langen Geschichte fast nur autoritäre oder totalitäre politische Systeme gekannt habe. Der Begriff ‚Demokratie‘ enthalte dort nega-tive Konnotationen (z.B. aus der Zeit von Gorbatschow und Jelzin). Es herrsche „eine kafka-eske Bürokratie“, durch die Investoren abgeschreckt und Innovationen im Keim erstickt wür-den (S. 240). Dies im Gegensatz zu der Tatsache, dass Russland eigentlich reich an natürli-chen, wirtschaftlichen, kulturellen und technischen Ressourcen ist.
„Innovation, Imperium und Autokratie (China)“ (S. 242 ff.). Das Beispiel China erörtert M. u.a. an Hand der Entwicklung der Quantentechnologie. In der Quantenkommunikation ist China 2020 ein erster Durchbruch gelungen. Schätzungsweise 10 Milliarden Euro will China in den nächsten Jahren in die Quantentechnologie investieren. Schwerpunkte sind Quanten-computing und PC-Governance-Struktur.
Am Beispiel des „Social Score“ (auch: ‚Social Credit System’), eines umfassenden Punkte-systems von Überwachung und Kontrolle, will M. die gegenseitige Abhängigkeit von Inno-vation und Wertesystem illustrieren. Ein in der Entwicklung befindlicher Supercomputer soll auch außenpolitisch wertvolle Dienste leisten, z.B. bei der Voraussage künftiger Krisen. Ziel sei nicht Big Brother, sondern ein „hochentwickelter autoritärer Wohlfahrtsstaat“ (S. 244). Diesem Ziel diene auch die neue Synthese von „sozialistischem“ Wertesystem und Konfuzianismus. In Letzterem stehe seit jeher das Gemeinwohl hoch über den Privat-interessen. Wobei am Staatskapitalismus nicht gerüttelt werde und der entsprechende politische Wettstreit mit dem Westen erst noch bevorstehe. Auch die ‚Neue Seidenstraße‘ sieht M. eher positiv. China leiste Investitionen, zu denen die Anliegerstaaten niemals in der Lage seien.
„Datong“ (= ‚große Gemeinschaft‘) lautet das Zauberwort, mit dem der chinesische Philosoph Zhao Tingyang schon 1961 ein Modell einer neuen Weltordnung jenseits von Nationalstaaten und UNO entworfen hat. Mit demokratischen Mehrheitsentscheidungen seien die Probleme nicht immer zu lösen. – Wie M. erklärt, sei Zhaos Beschreibung einer neuen „Weltinnenpoli-tik“ aber leider zu vage; unbefriedigend sei seine Berufung auf spezielle chinesische Traditionen wie „Datong“ und „Tianxia“ (‚alles unter einem Himmel‘). Mainzers Merksätze:
„Ohne das Wissen und Können von Schlüssel- und Zukunftstechnologien blieb die Weltinnenpolitik ein Traum vergangener Jahrhunderte. Aber Technik bleibt auch in diesem Stadium der Entwicklung nur die notwendige Bedingung. Wie diese Techno-logie für eine lebenswerte Welt zu entwickeln ist, bleibt die Aufgabe einer verantwor-tungsvollen Technikgestaltung.“ (S. 250)
Aber: Technikgestaltung allein genügt nicht. Was über sie hinausgehend zu tun ist, erläutert M. hier nicht.
„Innovation, Nachhaltigkeit und Menschenrechte (Europa) (ebd.)
Nur interdiziplinär scheint der entsprechende wissenschaftliche und philosophische Fortschritt möglich zu sein. Neue Forschungscluster seien zu erarbeiten. Wissenschaft und Privatwirt-schaft müssen kooperieren, wobei auch „soziale und ökologische Gesichtspunkte“ zu berück-sichtigen seien.
Als Beispiel für Innovation zieht M. erneut die Quantentechnologie heran. Quantitativ sei die Zahl der Publikationen höher als in den USA und in China; qualitativ aber bleibe Europa in puncto Innovationskraft hinter den USA zurück. Merksätze:
„Kritisch ist im Unterschied zu den USA die schwächer ausgebildete Start-up Kultur in Europa. Damit ist nicht nur der geringere Umfang von Wagniskapital gemeint, son-dern auch weniger Beratungsmöglichkeiten durch industrieerfahrene Kapitalgeber. Besser steht es demgegenüber um die Förderung exzellenter Grundlagenforschung in der Quantentechnologie.“ (S. 252)
Über das rein Technische hinaus rundet M. seine Überlegungen zu Europa dadurch ab, dass er Grundrechte, Rechtslehren und Verfassungen sowie Staatsrecht, Völkerrecht und Demokratie thematisiert. Stichwortartig:
1. Als Ursprungsort von Demokratie und Menschenrechten muss Europa diese Errungen-schaften mit der „Dynamik des Innovationsraums Europa“ verbinden (S. 253).
2. Europa muss Bildungs- und Ausbildungssysteme schaffen, die im Zeitalter der Digita-lisierung vonnöten sind.
3. Im Sinne von Hans Kelsen (1934) soll eine „Reine Rechtslehre“ objektiv, d.h. wertur-teilsfrei sein. (Frage: Geht es denn im Recht nie um Werturteile?)
4. Das Recht kann als formales Normensystem und als formale Logik aufgefasst werden.
(Frage: Gibt es Normen ohne Werte?)
5. Aufgabe der Politik ist es, das Rechtssystem zu legitimieren. Für den Rechtsstaat gibt es klare Kriterien (S. 260).
6. Das Völkerrecht ist dem nationalen Recht vor- und übergeordnet.
7. Zukunftstechnologien müssen staatlich bzw. politisch abgesichert werden. Dann erst können Innovationen zu politischer, wirtschaftlicher und militärischer Stärke beitragen (S. 263).
Zum Themenkomplex 6: „Zukunft zwischen Nachhaltigkeit und planetarischem Aufbruch“ (S. 269 ff.)
In diesem Schlusskapitel erweitert der Autor seine Fragestellungen um die Dimension des Weltraums, den er u.a. als „Innovationsraum“ thematisiert. Was bedeutet die (mögliche) Sym-biose des Menschen mit der KI für den planetarischen Aufbruch? Zu beachten ist, dass Super-computer inzwischen teilweise schon die Lernfähigkeit des Menschen übertreffen. Wobei intelligente Software u.a. mit Sensortechnologie verbunden wird. Es gibt „embodied robotics“ neben dem menschlichen ‚embodied mind‘. Und dies sei auch für den Einsatz auf fernen Pla-neten entscheidend (S. 273). Um auch in lebensfeindlichem Weltraum bestehen zu können, wird es vielleicht neuromorphe Computer geben, die den Menschen ersetzen können. Dazu wird es womöglich erforderlich sein, KI zur Superintelligenz zu erweitern. Das kollektive KI-System wäre angeblich dem Menschen überlegen, und zwar auch ohne dessen Bewusstsein (!). M. fragt zudem, wie die Innovationen sich in kosmischen Zivilisationen entwickeln wer-den, z.B. auf Grund des Innovationspotenzials der Information, so auch der Big Data. Jede kosmische Zivilastion werde auf enormen Energieverbrauch angewiesen sein, ein Problem, das durch den künftigen Fusionsreaktor lösbar zu sein scheint.
Durch die (möglichen) Innovationen erscheinen auch die „Grundrechte im Weltraum“ in neuem Licht. Der Kampf zwischen Gut und Böse werde sich im Weltraum fortsetzen und daher auch die Notwendigkeit, bestehende Rechts- und Normensysteme auf den Weltraum zu übertragen, wobei die KI „bemerkenswerte Perspektiven“ eröffne. Die allen Normen-Systemen zu Grunde liegenden Wertvorstellungen der Menschen sollen aber als „Ordnungs-parameter“ in Kraft bleiben. Nur so könne der Crash, der Zusammenbruch der Zivilisation, verhindert werden. Was im globalen Gesamtrahmen immer noch ein Desiderat, eine kollek-tive Aufgabe, bedeutet.
Kritische Würdigung
Klaus Mainzers Buch ist in vielfacher Hinsicht bemerkenswert. Das Thema „Zukunft durch nachhaltige Innovation“ wird darin anscheinend erschöpfend behandelt, nicht zuletzt auch im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen in der KI, der Quantentechnologie, der Robotik, der „In-novationsportfolios“ u.a.m. Das Buch ist hervorragend gestaltet, so auch durch die zahl-reichen Illustrationen und Auflockerungen in Merksätzen, „Call-for-Actions“, Exkursen, Zu-satzmaterialien usw. Eingängig ist seine Kernthese: Um das (angebliche) Grundproblem unserer Zeit, die Umwelt- und Klimakrise, zu bewältigen, mangele es an strategischem Denken.
Schon hier müssen jedoch Bedenken und Widerspruch angemeldet werden: Ist denn die Öko-Krise durch Denkfehler entstanden? Nur durch einen Mangel an strategischem Denken? In Wirklichkeit liegen die Gründe doch anderswo, nämlich in Systemfehlern. Sowohl die kapita-listische als auch die planwirtschaftliche Ökonomie haben völlig auf „ständiges Wachstum“ gesetzt und dadurch permanenten Raubbau an den Ressourcen verübt, und zwar ohne Rück-sicht auf elementare Lebens- und Umwelt-Bedürfnisse und mit üblen Folgen für das Welt-klima. – Gegen diesen Vorwurf könnte K. Mainzer einwenden, er habe doch sehr wohl auch die Systemfrage berücksichtigt und dies bereits in dem Untertitel „Im Wettkampf der Systeme“ angekündigt. Leider hält dieser Untertitel aber nicht, was er verspricht. Er bezieht sich nämlich nicht auf die Gesamtheit des Textes, sondern nur auf das 6. Kapitel „Wettkampf der Systeme“ (S. 221-268), also auf nur 47 von insgesamt 290 Seiten.
Nicht deutlich wird in diesem Kapitel, worin die „Denkfehler“ der internationalen Akteure USA, Russland, China und EU bestehen. Einer der Gründe hierfür liegt darin, dass Mainzer diesen Akteuren jeweils nur relativ wenige Ausführungen widmet, ohne zum Kern der Probleme vorzudringen. Dieser Kern beruht nämlich nicht auf Denkfehlern, sondern auf zwei Problemkreisen, die Mainzer kaum oder gar nicht berührt: 1. die Soziale Frage, 2. die Systemfrage im weitesten Sinne. Beide Fragen hängen eng zusammen, zumal im globalisier-ten neoliberalen Kapitalismus die sozialen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten ständig zu-nehmen, insbesondere zu Lasten der wenig entwickelten Länder (der „Dritten Welt“), in denen die heimischen Ressourcen ausgeplündert und eigene ökonomisch-soziale Fortschritte verhindert werden – mit den bekannten Folgen der Verelendung, der Unterdrückung und mas-siven Fluchtbewegungen, die inzwischen in den Zielländern, den nördlichen Metropolen, zu kaum noch lösbaren logistischen Problemen und zur Ausbreitung von Populismus und Nationalismus führen.
Mainzer übersieht zudem die Tatsache, dass die neoliberal-kapitalistische Entwicklung in allen vier von ihm dargestellten Regionen zu ähnlichen negativen Folgen führt, die man mit Shoshana Zuboff, etwas pauschal, auf den „Überwachungskapitalismus“ [4] zurückführen kann. Aus Zuboffs Buch zitiere ich exemplarisch Folgendes:
„Der Überwachungskapitalismus ist eine grenzenlose Marktform, die ältere Unter-scheidungen zwischen Markt und Gesellschaft, Markt und Welt oder Markt und Person ignoriert. Er ist eine profitorientierte Form, in der die Produktion der Extrak-tion untergeordnet ist; Überwachungskapitalisten beanspruchen einseitig die Kontrolle über menschliche, gesellschaftliche und politische Territorien, die weit hinausgehen über das konventionelle institutionelle Territorium der privaten Unternehmung oder des Markts.“ (a.a.O. S. 587) Und:
»Falls wir eine Kategorie hätten, dann wäre das die persönliche Information … Wo man überall gewesen ist. Mitteilungen … Sensoren sind billig und werden noch billiger. Speicherplatz ist billig. Kameras sind billig. Die Menschen werden enorme Datenmengen generieren. Alles, was du je gesehen, erfahren oder wovon du je gehört hast, wird durchsuchbar werden. Dein ganzes Leben wird durchsuchbar.« (L. Page) (a.a.O. S. 123)
Um die tatsächlichen Gegebenheiten in den von Mainzer beschriebenen vier Regionen besser zu verstehen, dürften jedenfalls die folgenden Ergänzungen unentbehrlich sein:
1. zu den USA
Hierzu schreibt Felix Georg 2002:
„Die Politik der USA beruhte seit jeher auf dem Prinzip des Freihandels. Durch die genauere Betrachtung ihrer Politik ist klar zu erkennen, dass der Imperialismus und die von den USA gewählte Vorgehensweise die, wirtschaftlich gesehen, mit Sicherheit erfolgreichste Wahl war. Weiterhin waren die USA durch ihre geographische Lage im Vorteil, da man weit ab von anderen Großmächten lag.
Man kann davon ausgehen, dass die USA ihre auf dem Imperialismus basierende Weltpolitik noch auf langen Zeitraum weiterführen wird. Besonders ihre übermächtige Stellung im Wirtschaftsbereich, welche im Laufe des letzten Jahrhunderts erarbeitet wurde, wird auf kurze Sicht nur schwer von anderen Ländern einzuholen sein.“ [5]
Dies galt im Jahr 2002, nicht mehr jedoch im Jahr 2024, da China inzwischen auf zahlreichen Gebieten zum direkten Konkurrenten der USA geworden ist. Brisant ist dies insbesondere im Hinblick auf die KI, mit der beide Großmächte sich eine weltweite Vormachtsstellung sichern wollen – mit der möglichen Folge, dass keine von beiden bereit sein wird, der u.a. von Mainzer vorgeschlagenen Pflicht zur Zertifizierung sämtlicher Technik-Produkte und KI-Pro-gramme zuzustimmen. [6]
Wie sehr sich die Situation der USA seit 2002 geändert hat, wird aus dem folgenden Beitrag von Willy Hämmerle (2023) ersichtlich, wo es heißt:
„Die USA sind tatsächlich, wie der russische Revolutionär Leo Trotzki einmal fest-
hielt, ein „Gigant auf tönernen Füßen”. Die mächtige amerikanische Arbeiterklasse ist
angesichts der tiefen Krise in eine stetig wachsende Welle an Organisierung, Klassen-
kämpfen und Streiks eingetreten. Zuletzt legten die Autoren und Schauspieler die
Traumfabrik Hollywood monatelang lahm … und die Arbeiter in der Automobilindus-
trie streikten 6 Wochen lang. Biden, der letztes Jahr noch den Streik der Eisenbahner
sabotierte, sah sich (als erster Präsident in der Geschichte der USA!) dazu gezwungen, den streikenden Automobil-Arbeitern seine Unterstützung auszusprechen, doch auch Trump sprach in einer Autofabrik und warb um Unterstützung. Das zeigt, welche Gefahr die Bürgerlichen in der Arbeiterbewegung sehen – wenn sich die Arbeiter aus den Klauen der bürgerlichen Parteien befreien. …“ [7]
Allerdings berücksichtigt W. Hämmerle hier nicht die Tatsache, dass die USA – bedingt durch die Globalisierung – keineswegs allein für die weltweiten Wirtschafts- und Umwelt-krisen verantwortlich sind. Es sind Zusammenhänge, in denen zahlreiche ökonomische Groß- und Mittelmächte zusammenwirken, darunter auch die EU, Japan, China und Russland.
2. zu Russland
Putins „bürokratischer Autoritarismus“
Auch Gorbatschow, Jelzin und Putin konnten offensichtlich nicht auf die Bürokratie verzich-ten, und zwar anscheinend in wechselseitigem Interesse. Dies unbeschadet der Tatsache, dass keiner der drei Staatschefs sich ausdrücklich zur Diktatur des Proletariats bekannt hat. Sowohl Gorbatschow als auch Jelzin bekundeten immerhin ihren Willen, die Macht der Bürokraten zu beschneiden, ließen dem aber keine oder nur unzureichende Taten folgen.
Auch Putin kritisiert gelegentlich die Bürokratie, macht sie für Missstände und Misserfolge verantwortlich. Putin will kein Bürokrat und kein Diktator sein, fördert aber das, was Lilia Shevtsova (2006) als „bürokratischen Autoritarismus“ bezeichnet. „Staatsbürokratischer Kapitalismus“ sei die Grundlage dieser neuen Spielart russischer Bürokratie, die Putin durch eine Reihe machtpolitischer Maßnahmen etabliert habe. Dazu gehören „die Einsetzung von Präsidentenvertretern in den Regionen, die Ruhigstellung der Oligarchen und regionalen Barone, die Liquidierung unabhängiger Massenmedien, der Übergang zu einer Ernennung der Gouverneure, die Gründung einer dem Kreml ergebenen „Partei der Macht“ („Einiges Russland“), die verschärfte Kontrolle der gesellschaftlichen Nichtregierungsorganisationen – all dies wurde zum Fundament des neuen Machtregimes.“ [8] Wobei Putin anscheinend nicht vor Verfassungsbruch zurückschreckt, so bei der Inanspruchnahme des Rechts auf Billigung des Verfassungsgerichts. Aber nicht das Recht, sondern „ein Handeln „nach Gutdünken“ und nicht nach dem Gesetz hat seine formelle Legitimation erhalten“. (a.a.o., was sich in Tschetschenien und Georgien und erst recht im Februar 2022 in der Ukraine grauenvoll bestätigt hat!)
All dies führt zur Stärkung der bürokratisch-autoritären Gesellschaftsschicht, während die Wirtschaft durchaus expandiert, wenn auch teilweise in einseitiger Manier, nämlich hin zu einem „Petro-Staat“, wozu L. Shevtsova schreibt: „Während Putins Regierungszeit hat sich eine Schicht von oligarchischen Apparatschiks gebildet, die das Eigentum kontrolliert, ohne es zu besitzen und ohne dafür die Verantwortung zu tragen. Sie hat sich zu einer parasitären Klasse von „Rentiers“ entwickelt. Unter der Losung von der „energiepolitischen Supermacht“ hat die herrschende Klasse versucht, globale Ambitionen zu produzieren und sie mit der Selbstreproduktion durch die Ausbeutung der Rohstoffreserven in Einklang zu bringen. Die Evolution des russischen Staates in Richtung eines „Petro-Staates“ könnte damit enden, dass Russland zu einem Rohstoffanhängsel der Weltgemeinschaft wird.“ Mit nicht geringen Risiken, denn es wird ja versucht, „Petro-Staat“ und Atommacht unter einen Hut zu bringen. Um solchen durchaus auch bewusstseinsmäßigen Risiken zu entgehen, versucht die Macht-elite erneut, die Karte des Nationalismus auszuspielen. Wohl nicht zufällig nennt sich Putins Partei „Einiges Russland“; sie stimuliert „die Russische Idee“ u.a. in Verbindung mit anti-westlicher Stimmungsmache.
Wenig überrascht hingegen die Tatsache der Strukturkontinuität der Bürokratie . In immer neuen Ausformungen überlebt die (Staats-)Bürokratie anscheinend jede Krise. Ein weltweites Phänomen, dessen Auswirkungen kaum absehbar sind und jedenfalls nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollten. Aussicht auf durchgreifende Demokratisierung – in Russland und anderswo – gibt es wohl nicht, solange die „Riesenbürokratien“ jede nennenswerte Strukturveränderung verhindern, und zwar nicht zuletzt dadurch, dass sie „unter sich eine Art innere Solidarität“ üben. [9]
3. zu China
Auch „Volksrepublik“ genannt, obwohl in ihr alle Macht nicht vom Volke, sondern von der allgegenwärtigen KP Chinas ausgeht, und zwar bis zum heutigen Tag. Dies im Unterschied zu den ab 1989 ausnahmslos entmachteten KP-Staats-Parteien des Ostblocks. Wie überhaupt die „VR“ China seit ihrer Gründung durch Mao Zedong im Jahre 1949 immer wieder eigene Wege gesucht und gefunden hat. Was nicht zuletzt mit der jahrzehntelangen Alleinherrschaft Maos zusammenhängt, der sich dabei – zunächst nach „bewährtem“ leninistisch-stalini-stischem Muster – auf die Partei- und Staatsbürokratie stützte.
Dass Mao und die ihm ergebene KPCh sich trotz einiger selbst verschuldeter Katastrophen („Großer Sprung nach vorn“, Kulturrevolution) stets an der Macht hielten, verdanken sie anscheinend vor allem dem, was Josef Mondl (2014) als Chinas Duale Bürokratie bezeich-net[10], ein Phänomen, das in krassem Widerspruch zu der Tatsache steht, dass Mao selbst anfänglich – ähnlich wie Lenin und Stalin – die Bürokratie, speziell die bürgerliche, heftig kritisierte, diese aber dennoch wohl oder übel übernehmen musste, da sonst die Verwaltung mangels Personal zusammengebrochen wäre.
„Duale Bürokratie“ bedeutet, dass die Behörden und die Unternehmen auf allen Ebenen ihre Mitarbeiter der vollständigen Kontrolle durch Partei-Komitees zu unterstellen haben. So dass die über „alles“ wachenden Parteifunktionäre alle wichtigen Entscheidungen treffen, deren Ausführung sie dann der Staatsbürokratie überlassen. Bis hin zu häufig in breiter Öffentlich-keit durchgeführten Tribunalen, zumal die Bürokratie in gerichtlichen Angelegenheiten über mehr Informationen als die Partei verfügt, die sie dieser jedoch stets bereitwillig zur Verfügung stellt. „Rechtsstaat“ bedeutet in China nach wie vor, dass „die Verwaltung Chinas gemäß Richtlinien und Normen funktioniert, welche durch die Partei festgelegt und umgesetzt werden“ (a.a.O. S. 3).
Das „Sozialkreditsystem“: totale Überwachung?
In China bedeutet „sozialistische Marktwirtschaft“ ein hybrides Gebilde aus Markt und totaler Kontrolle durch die KPCh unter ihrem jetzigen Alleinherrscher Xi Jinping, der sich offiziell auf die Tradition „von Marx bis Mao“ beruft und zugleich angibt, die herkömmliche Familie stärken und endlich die Sicherheit im Lande garantieren zu wollen. Wozu man sich ein Überwachungssystem der besonderen Art ausgedacht hat, in dem mit hochmodernen Medien, Big Data und Künstlicher Intelligenz gearbeitet wird. Letztere, die KI, ermöglicht es angeblich inzwischen schon, jede Einzelperson binnen 1 Sekunde per Gesichtserkennung zu identifizieren, und dies bei einer Einwohnerzahl von ca. 1,4 Milliarden! Darüber hinaus wird gegenwärtig ein sogenanntes „Sozialkredit-System“ eingeführt, wobei ‚Kredit‘ nicht nur finanzielles, sondern auch allgemeines „Vertrauen“ bedeutet. Demnach erscheint jede Person entweder auf einer roten oder einer schwarzen Liste, wozu es in einem Interview in ‚Cicero online‘ heißt: „Auf den roten Listen sind Bürger oder Unternehmen zu finden, die sich nach den Maßstäben der chinesischen Regierung durch besonders soziales Verhalten hervorgetan haben, beispielsweise Freiwilligen-Dienste geleistet oder Geld gespendet haben. Auf den schwarzen Listen befinden sich Bürger oder Unternehmen, die nach Regierungsmaßstäben durch besonders unsoziales oder illegales Verhalten aufgefallen sind.“ [11]
In Wirklichkeit handelt es sich um ein System der totalen Kontrolle und Überwachung, eine Art modernes 1984, das allerdings – erstaunlicherweise – anscheinend von den meisten Chinesen nicht als solches empfunden wird. Laut Umfragen beurteilen ca. 80% der befragten Chinesen das neue System sogar als positiv. Grund hierfür: Viele Leute versprechen sich von dem System Vergünstigungen, die ihnen bislang verweigert wurden, z.B. Zug- und Flugtickets, Geldkredite u.a.m. Der Haken bei der Sache: Man erfährt zwar in regelmäßigen Abständen den eigenen Punktestand, nicht jedoch die Gründe, warum einem mehr oder weniger Punkte zugeteilt wurden. Umso erstaunlicher ist die hohe Akzeptanz für dieses hocheffiziente System des Gläsernen Menschen.
Den einzigen Vorteil dieses Systems sehe ich darin, dass in ihm die Künstliche Intelligenz anscheinend unter Kontrolle gehalten wird; dies im Gegensatz zu den wilden Phantastereien von Super-Intelligenz, „Singularität“ und Unsterblichkeit, die man z.B. im Silicon Valley mit der KI verbindet. [12]
Zum Neo-Konfuzianismus der Gegenwart
Wie Marxzu Recht feststellte, blamieren sich zumeist die Erkenntnisse, wenn sie mit Interessen in Konflikt geraten. Außerdem ist zu beachten, dass auch die Ethik sich in 2000 Jahren weiterentwickelt hat. Natürlich kann man es Konfuzius nicht ankreiden, dass in seinem System Kantische Begriffe wie Rechtsperson, Allgemeine Gesetzgebung, Sittengesetz usw. nicht vorkommen. Gerade in industriell und informationell hoch entwickelten Gesellschaften sind diese Begriffe aber unverzichtbar, auch wenn sie neu zu begründen sind. [13]
Dagegen wird sich mit Konfuzianismus allein die Moral wohl nirgendwo verbessern lassen.
Faszinierend, aber nicht „wasserdicht“ sind auch Konfuzius‘ berühmte Ableitungen der Ethik aus der Begriffsklärung und der Goldenen Regel. Moral und Kunst nur auf die „Richtigkeit der Begriffe“ zu gründen, kann aber nicht gelingen. Die Erfahrungen, auf denen Moral und Kunst beruhen, sind reichhaltiger und vielfältiger als jeder Begriff, jede sprachliche Bezeichnung und Bedeutung. Maßgeblich für diese grundlegenden Erfahrungen sind nicht nur die Normen des Über-Ichs, sondern auch sämtliche Erfahrungen von Ich und Es einschließlich mancher (Un-)Tiefen des Unbewussten, der Phantasie und alles Nicht-Sprachlichen, abgewandelt auch im Traum. – Die Goldene Regel ist von Kant relativ ausführlich kritisiert worden. Er hat sie als einseitig und egozentrisch zurückgewiesen. Wer nur aus Eigeninteresse moralisch handelt, kann nicht sicher sein, überhaupt moralisch zu handeln.
Und wie steht es mit den übrigen Komponenten des Konfuzianismus? In dessen Mittelpunkt steht die Lehre von der inneren und äußeren Harmonie, die angeblich nicht nur die Einzelper-sonen und die Gesellschaft, sondern auch den gesamten Kosmos umfasst. Überschaubar ist jedoch keine dieser Komponenten. Die Einzelpersonen und die von ihnen gebildeten Gesell-schaften sind es nicht, weil die neuronale Kombinatorik der Gehirne – auch mathematisch – nicht erfasst werden kann und die Einzelpersonen über relative Willensfreiheit verfügen; der Kosmos ist im Ganzen nicht überschaubar, weil er nach wie vor zu mehr als 90 % unerforscht ist. Harmonie lässt sich zwar trotzdem einfordern, aber nicht als Grundprinzip nachweisen. – Ähnlich steht es mit der angeblich einzigartigen „Seinskultur“ des Konfuzianismus. Sogar ein Heidegger ist bei dem Versuch gescheitert, das Sein zu ergründen. Da Sein und Kosmos quasi identisch sind, gilt für das Sein Ähnliches wie das für den Kosmos Festgestellte. Auch hier hält der konfuzianische Anspruch der Überprüfung nicht Stand.
Zur konfuzianischen Staatslehre. Mao Zedong witterte in ihr – wohl zu Recht – undemokrati-sche, konservativ-autoritäre Motive. Nicht Recht hatte er aber zweifellos damit, gegen die Konfuzianer mit mörderischem Staatsterror vorzugehen. Darin folgte er offenbar nicht Marx und Engels, sondern Lenin und Stalin. Wenn aber Yao Yang im Jahr 2020 einen voll-ständigen Verzicht auf den Marxismus zu Gunsten des Konfuzianismus fordert, sind kritische Einwände ebenfalls unbedingt geboten. Zu Konfuzius‘ Zeiten mag es möglich gewesen sein, die hierarchische Familien-Ordnung auf die Gesellschaft als Ganze zu übertragen. In hoch entwickelten modernen Gesellschaften ist dies aber nicht mehr möglich. Gegenwärtig unter-scheiden sich Abhängigkeitsstrukturen in Familien grundsätzlich von denjenigen zwischen Unternehmern (bzw. Kapitalbesitzern) und Lohnabhängigen. Mit ökonomischen Kategorien wie Kapital, Mehrwert, Ausbeutung, Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse usw. lassen sich Familien-Strukturen und -Zusammenhänge nicht erklären – was auch für das Umgekehrte gilt. – In der heutigen chinesischen Bevölkerung wird der KP eine ähnliche Führungsrolle zugebilligt, wie sie Konfuzius innerhalb der Familien den Eltern einräumt. Insofern erweist sich der Konfuzianismus als Ideologie im Marxschen Sinne, d.h. als Faktor der Stabilisierung eines autoritär-diktatorischen Regimes.
Insgesamt ergibt sich folgendes Resümee:
1. Was Sozialismus und Demokratie ihrem Wesen und ihren spezifisch chinesischen Formen gemäß sind, bestimmt allein die KPCh. Sozialismus – ursprünglich konzipiert als Gemeinsamkeit – wird auf die Herrschaft einer einzigen Partei, der KPCh, reduziert und verkommt zu einem Herrschafts-Instrument. Das Marxsche Ziel des Sozialismus, die Herr-schaft von Menschen über Menschen zu beenden und allenfalls eine „Verwaltung von Sachen“ zuzulassen, rückt in anscheinend unerreichbare Ferne.
2. Tatsächlich herrscht die KPCh, nicht zuletzt mit neuesten Technologien wie die der Künstlichen Intelligenz, sowohl über die Personen als auch über die Sachen. „Die Sache selbst“ – bei Hegel die ins Subjekthafte strebende Substanz der Geschichte – wird zu einer parteipolitischen Angelegenheit, identisch mit der Hegemonie der KPCh.
3. Die KPCh definiert Demokratie als „demokratische Diktatur des Volkes“ = DdP = Herrrschaft nicht des ganzen Volkes, sondern nur eines seiner Teile, der KP. Eine offensichtliche Verkehrung des ursprünglichen Sinns von Demokratie, nämlich Herrschaft des Volkes zu sein! Herrschaft der KPCh bedeutet zugleich deren ausschließliche Verfügungs-gewalt über die Staatsziele und deren Legitimation. Worin das Wohlergehen und die Modernisierung des Landes und damit aller Einzelnen besteht, wird nicht demokratisch bzw. individuell-demokratisch ermittelt, sondern von der herrschenden Partei festgelegt. [14]
4. zur EU
Hierzu hat Emil Popov (2002) eine Dissertation vorgelegt mit dem Titel: ‚Vom Absterben des Nationalstaates als Determinante europäischer Einigung oder das Ende nationalstaatlicher Souveränität‘ . [15] Darin geht der Autor von Marx aus und schließlich über ihn hinaus, indem er das Absterben des Staates als zwingende Notwendigkeit bezeichnet. Der Staat müsse absterben, denn er sei, wie Marx es ausdrückt, eine „übernatürliche Fehlgeburt der Gesellschaft“, was auch und gerade für den Nationalstaat gelte. Dazu schreibt Popov:
„Die abnehmende Effizienz des Nationalstaates als adäquate politische Organisationsform der Industriegesellschaft wurde schon lange vor dem Übergang zur Informationsgesellschaft evident. Der Versuch, Wachstum und Vollbeschäftigung in den engen nationalstaatlichen Grenzen zu realisieren, ist gescheitert. Der Nationalstaat, der von der kapitalistischen Ent-wicklung seit der industriellen Revolution ins Leben gerufen wurde, wurde selbst zum Hindernis dieser Entwicklung.“ (a.a.O.)
(Was im Rahmen der neoliberalen Globalisierung in mehrfacher Hinsicht zutrifft!)
Schon dies wäre natürlich ein Grund, immer mehr Kompetenzen von den Nationalstaaten zur EU zu verlagern. Was aber nur in relativ geringem Umfang geschieht, und zwar hauptsächlich wohl wegen des in der EU gültigen Subsidiaritätsprinzips, das E. Popov nur eher beiläufig erwähnt. Gemäß diesem Prinzip sollen die Mitgliedsstaaten der EU Aufgaben übertragen, a) wenn sie selbst diese nicht hinreichend bewältigen können, b) wenn diese Aufgaben von der EU besser erfüllt werden können. Der springende Punkt dabei: die Mitgliedsstaaten entschei-den selbst darüber, ob die Kriterien a) oder b) vorliegen .
Die Crux: Die EU ist selbst kein Staat, übernimmt aber staatliche Aufgaben und besteht aus 27 Einzel-Staaten. Diese werden voraussichtlich nicht „absterben“, solange das – zweifellos sinnvolle – Subsidiaritätsprinzip in der EU gültig ist. – Auch Popov hat dieses Problem er-kannt, fordert aber nichtsdestoweniger:
„Eine neue föderal organisierte supranationale Einheit steht nicht entfremdet der Vielfalt der Regionen gegenüber. Während die Homogenität eines Nationalstaates die freie Entfaltung der Eigenartigkeit der Regionen verhindert, toleriert eine Föderation neuer Art diese Vielfalt und mittels einer neuen subsidiären Struktur übernimmt sie nur solche Funktionen, die die unteren Ebenen nicht selbst übernehmen können.“ (a.a.O., Hervorhebungen KR)
Wie diese „neue subsidiäre Struktur“ im Einzelnen beschaffen sein und durchgesetzt werden soll, erklärt Popov leider nicht. Er verkennt anscheinend auch die Tatsache, dass die Subsidiarität in ihrer gegenwärtigen Form die Staatlichkeit der einzelnen EU-Staaten nicht schwächt, sondern stärkt, während die EU absehbar nicht zum Staat avancieren wird. Die bestehenden Machtstrukturen verfestigen sich wechselseitig: Die EU gewinnt neue Kompe-tenzen; diese müssen aber jeweils in nationales Recht umgesetzt werden, so dass jeder einzelne Mitglieds- Staat der EU umso mehr an Bedeutung gewinnt, zumal jede Kompetenz-erweiterung der EU gemäß dem Subsidiaritätsprinzip zuvor von allen Mitgliedsstaaten genehmigt werden muss. Ein Absterben der Staaten ist folglich durch die EU-Integration nicht zu erwarten, im Gegenteil. – Popov geht zwar von Marx aus, ignoriert aber die Tatsache, dass Marx die proletarische Revolution für eine unabdingbare Voraussetzung eines Absterbens des Staates hielt; was sicherlich beides von der neoliberalen EU nicht zu erwarten ist.
Fazit
Auch angesichts der tatsächlichen komplizierten Verhältnisse erscheint es ausgeschlossen, die schwerwiegenden akuten Menschheitsprobleme auf die Öko-Krise und deren Ursachen auf angebliche Denkmängel zu reduzieren. Gleiches gilt für die daraus von K. Mainzer gefolgerte Notwendigkeit nachhaltiger Innovationen, die allein ohnehin nicht gelingen können. Als Be- sorgnis erregend gelten vor allem die Unwägbarkeiten von KI, Digitalisierung und atomarer Bedrohung.
Als ungelöst gilt die Soziale Frage, die Mainzer überhaupt nicht thematisiert. Klassenkampf ist aber ebenso wie die Öko-Krise eine Folge kapitalistischen Wirtschaftens; so dass im Zusammenhang mit beiden Problemen unbedingt die Systemfrage zu stellen ist. Kann es darauf in dieser Situation eine befriedigende Antwort geben, nachdem sich sowohl die kapitalistischen als auch die anderen totalitären Systeme als unzulänglich oder sogar lebensbedrohlich herausgestellt haben? Weder Bolschewismus noch Kapitalismus waren fähig, die Öko-Krise und die Soziale Frage im Verbund, d.h. in toto und im Rahmen einer Gesamtstrategie, zu meistern, erst recht nicht im Zusammenhang mit der Systemfrage.
Mein Lösungsvorschlag lautet nach wie vor: Demokratischer Öko-Sozialismus , ein Modell, das ich mehrfach, z.B. auch 2020 und 2021, vorgestellt habe (s. Literaturhinweise). – In der 2020 erschienenen Ethik der Verhaltenssteuerung habe ich übrigens die ethischen Grundlagen beschrieben, deren hohe Bedeutsamkeit – auch für die neuen Herausforderungen durch die Raumfahrt – K. Mainzer immer wieder betont, ohne diese Grundlagen zu diskutieren.
Literaturhinweise
Popov, Emil (2002): Vom Absterben des Nationalstaates als Determinante europäischer Einigung oder das Ende nationalstaatlicher Souveränität , Diss., in: https://publications.rwth-aachen.de/record/ 56904/files/Popov_Emil.pdf
Robra, Klaus o.J. (2020):Ethik der Verhaltenssteuerung. Eine Neubegründung, München, https://www.grin.com/document/923015
Robra, Klaus o.J. (2021):Sind die Diktatur des Proletariats und die Bürokratie das Ende des Sozialismus? Die Frage nach Auswegen aus den Sackgassen, München, https://www.grin.com/document/1032082
Zuboff, Shoshana 2018:Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, Frankfurt a.M./New York
[1] Laut Wikipedia erlaubt das Internet der Dinge (oder auch „Allnetz“) „die Interaktion zwischen Menschen und hierüber vernetzten beliebigen elektronischen Systemen sowie zwischen den Systemen an sich“.
[2] Engl. ‚to spill over‘ bedeutet wörtlich so viel wie ‚überlaufen‘ oder ‚überschwappen‘.„Ein Spill Over Effekt tritt dann ein, wenn ein Produkt oder eine Produktgruppe Auswirkungen auf ein anderes Produkt oder Produktgruppen hat. Positive Spill Over Effekte werden auch als Umbrella-Effekte bezeichnet, bei denen das Image eines bestehenden Produktes auf das neue Produkt abfärbt. Negative Spill Over Effekte werden auch als Kannibalismus-Effekte bezeichnet, bei denen das neue Produkt die anderen Produkte vom Markt verdrängt.“ (in: https://www.rechnungswesen-verstehen.de/lexikon/spill-over-effekt.php)
[3] Laut Wikipedia bedeutet ‚adiabatisch‘ u.a. ‚wärmedicht‘. Als ‚Adiabase‘ werde die Zustandsänderung eines Systems bezeichnet, bei der keine Wärme mit der Umgebung ausgetauscht wird.
[4] Zuboff 2018 (s. Literaturhinweise)
[5] Felix Georg: Der Imperialismus der USA, https://www.grin.com/document/106714
6 s. auch: Y. N. Harari: Nexus. Eine kurze Geschichte der Informationsnetzwerke von der Steinzeit bis zur künstlichen Intelligenz (2024), sowie K. Robra, in: https://www.grin.com/document/454629 (2019) und
[7] W. Hämmerle, in: https://derfunke.at/20386-usa-imperialismus-in-der-krise
[8] Lilia Shevtsova: Bürokratischer Autoritarismus – Fallen und Herausforderungen , in: www.bpb.de/apuz/29870/buerokratischer-autoritarismus-fallen-und-herausforderungen , S. 1
[9] Vgl. Henrik Bischof: Das Ende der Perestrojka?: Systemkrise in der Sowjetunion , in: www.library/fest.de/fulltext/aussenpolitik/01045002.htm , S. 2, sowie Robra o.J. 2021, S. 67 f.
[10] In: www.magazin.hsgfocus.ch>chinas-duale-buerokratie-5557
[11] „Viele empfinden die Daten-Überwachung als praktisch“. Interview mit Genia Kostka vom 24.7.2018, https://www.cicero.de/.../Sozialkreditsysteme-china-ueberwachung-staat-vertrauen-markt-unternehmen-kredite
[12] Vgl. Robra o.J. (2021), S. 75 ff.
[13] s. Robra o.J. (2020)
[14] Vgl. Robra o.J. (2021), S. 87
[15] In: https://publications.rwth-aachen.de/record/ 56904/files/Popov_Emil.pdf
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Rezension zu Klaus Mainzers "Zukunft durch nachhaltige Innovation"?
Die Rezension behandelt Klaus Mainzers Buch "Zukunft durch nachhaltige Innovation. Im Wettkampf der Systeme" (Berlin, 2023) und fasst dessen zentrale Thesen und Argumente zusammen. Das Buch analysiert die Bedeutung von Innovation für eine nachhaltige Zukunft im Kontext aktueller politischer, wirtschaftlicher und militärischer Herausforderungen.
Welche Themen behandelt Klaus Mainzer in seinem Buch?
Mainzer behandelt sechs Hauptthemenkomplexe:
- Dynamik komplexer Systeme
- Innovation, Evolution, Disruption
- Energietechnologie und Nachhaltigkeit
- Informationstechnologie und Nachhaltigkeit
- Wettkampf der Wertesysteme
- Zukunft zwischen Nachhaltigkeit und planetarischem Aufbruch
Was ist Mainzers Kernthese laut der Rezension?
Die Kernthese besteht darin, dass Innovation in jeder Hinsicht notwendig ist, insbesondere angesichts gegenwärtiger Krisen, die vor allem auf einen Mangel an strategischem Denken zurückzuführen seien.
Wie definiert Mainzer "komplexe Systeme"?
Mainzer definiert komplexe Systeme als "Elemente, die sich in der Zeit verändern" und durch zeitabhängige Gleichungen beschrieben werden.
Was versteht Mainzer unter "Disruption"?
Mainzer betrachtet Disruption als ein "schillerndes Modewort", das aber nur für Geschäftsmodelle originell sei. Er definiert es als ein abrupt oder "schlagartig" einsetzendes Ereignis, bei dem alte Modelle oder Technologien durch neue ersetzt werden.
Welche Energietechnologien behandelt Mainzer im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit?
Er behandelt Solar- und Windenergie, Wasserkraft, Wasserstoff, Kernenergie, Fusionsenergie und "Hybride Energiesysteme" als nachhaltiges Innovationsportfolio.
Wie definiert Mainzer "Intelligenz" im Kontext der Informationstechnologie?
Mainzer definiert ein System als intelligent, wenn es selbstständig und effizient komplexe Probleme lösen kann. Der Grad der Intelligenz hängt vom Grad der Selbstständigkeit (Autonomie), dem Grad der Komplexität des Problems und dem Grad der Effizienz des Problemlösungsverfahrens ab.
Was kritisiert der Rezensent an Mainzers Analyse der "Wettbewerb der Wertesysteme"?
Der Rezensent kritisiert, dass Mainzer den Akteuren (USA, Russland, China, EU) jeweils nur relativ wenige Ausführungen widmet, ohne zum Kern der Probleme vorzudringen. Dieser Kern beruhe nicht auf Denkfehlern, sondern auf der Sozialen Frage und der Systemfrage im weitesten Sinne.
Welche Kritik wird an Mainzers Fokussierung auf "Denkmängel" geübt?
Der Rezensent argumentiert, dass die Öko-Krise nicht nur durch Denkfehler, sondern durch Systemfehler entstanden ist, insbesondere durch das Streben nach "ständigem Wachstum" in kapitalistischen und planwirtschaftlichen Systemen.
Welche alternativen Lösungsansätze werden im Fazit vorgeschlagen?
Als Lösungsansatz wird "Demokratischer Öko-Sozialismus" vorgeschlagen, um die soziale Frage, die Öko-Krise und die Systemfrage im Verbund zu meistern.
- Quote paper
- Klaus Robra (Author), 2024, Rezension zu "Zukunft durch nachhaltige Innovation. Im Wettkampf der Systeme" von Klaus Mainzer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1511788