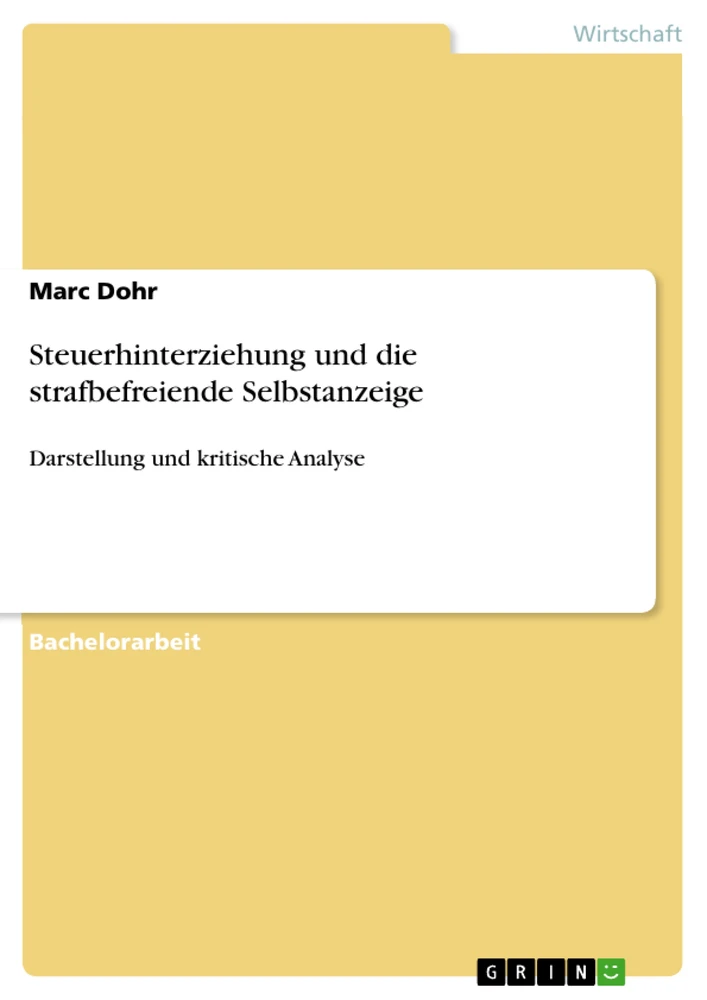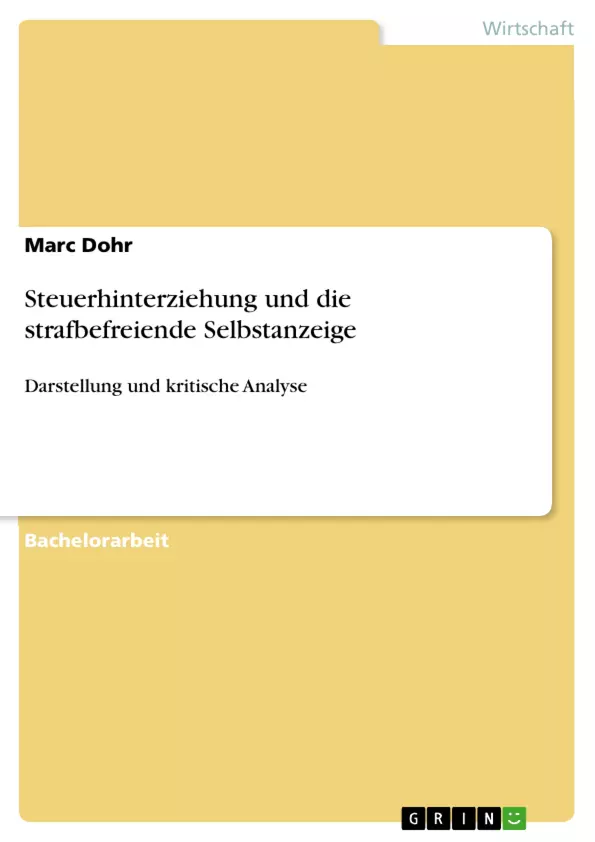Der Inhalt dieser Bachelorarbeit befasst sich zunächst mit der grundlegenden Definition der einzelnen Begriffe der Steuerhinterziehung und Verkürzung und gibt im Anschluss die daraus resultierenden Strafen, Rechte und Pflichten des Steuerhinterziehers, aber auch des Mitwirkenden wie dem Steuerberater wieder.
Als Hauptteil der Arbeit wird kritisch betrachtet, bis wann, nach der eingetretenen Gesetzesverletzung, eine strafbefreiende Selbstanzeige noch möglich ist und welche Konsequenzen aus einer fehlerhaften Selbstanzeige resultieren können.
Dies wird u. a. auch an einem praktischen Fall von Uli Hoeneß verdeutlicht.
Im Fazit werden die erarbeiteten Erkenntnisse und Risiken für Steuerpflichtige und Beteiligte zusammengefasst und mit der aktuellen Rechtslage abschließend kritisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Forschungsfrage
- Gang der Thesis
- Allgemeines
- Wer kann strafbar sein und welche Steuern werden hinterzogen?
- Aufbau in der Abgabenordnung (AO)
- Steuerwiderstand und Unterschied Steuerordnungswidrigkeit zur Steuerhinterziehung
- Das materielle Steuerstrafrecht in Bezug zur Steuerhinterziehung
- Objektiver Tatbestand
- Subjektiver Tatbestand
- Eintritt der Steuerhinterziehung
- Steuerverkürzung als Erfolg
- Erhalten eines nicht gerechtfertigten Steuervorteils als Erfolg
- Folgen der Steuerhinterziehung
- Ausmaß der Strafe bei Steuerhinterziehung
- Der Praxisfall Uli Hoeneß
- Die Rolle des Finanzamts
- Die strafrechtliche Verjährung
- Die strafbefreiende Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung nach § 371 AO
- Geschichtlicher Hintergrund und Zweck
- Positive und negative Wirksamkeitsvoraussetzungen nach § 371 AO
- Positive Wirksamkeitsvoraussetzungen der Absätze § 371 (1) und (3) AO
- Negative Wirksamkeitsvoraussetzungen nach § 371(2) AO
- Anwendungsbeispiel: Negativbeispiel zur Selbstanzeige im Fall Uli Hoeneß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema Steuerhinterziehung und der strafbefreienden Selbstanzeige. Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen darzustellen und kritisch zu analysieren. Die Arbeit untersucht die Voraussetzungen für eine strafbare Steuerhinterziehung und die Möglichkeiten der Straffreiheit durch eine Selbstanzeige.
- Rechtliche Grundlagen der Steuerhinterziehung
- Voraussetzungen für eine strafbefreiende Selbstanzeige
- Analyse der Erfolgsaussichten einer Selbstanzeige
- Fallstudie Uli Hoeneß als Beispiel
- Auswirkungen auf die Steuerverwaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und definiert die Problemstellung sowie die Forschungsfrage. Das Kapitel "Allgemeines" klärt grundlegende Begriffe und den Aufbau der Abgabenordnung. Das Kapitel zum materiellen Steuerstrafrecht behandelt den objektiven und subjektiven Tatbestand der Steuerhinterziehung. Anschließend wird der Eintritt der Steuerhinterziehung anhand von Steuerverkürzung und ungerechtfertigtem Steuervorteil erläutert. Die Folgen der Steuerhinterziehung, inklusive der Strafhöhe und des Falles Uli Hoeneß, werden im darauffolgenden Kapitel behandelt. Schließlich wird die strafbefreiende Selbstanzeige nach § 371 AO detailliert dargestellt, inklusive der positiven und negativen Voraussetzungen.
Schlüsselwörter
Steuerhinterziehung, Selbstanzeige, § 371 AO, Steuerstrafrecht, Abgabenordnung, Steuerverkürzung, Steuervorteil, Strafbefreiung, Uli Hoeneß, Finanzamt, strafrechtliche Verjährung.
- Quote paper
- Marc Dohr (Author), 2023, Steuerhinterziehung und die strafbefreiende Selbstanzeige, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1511666