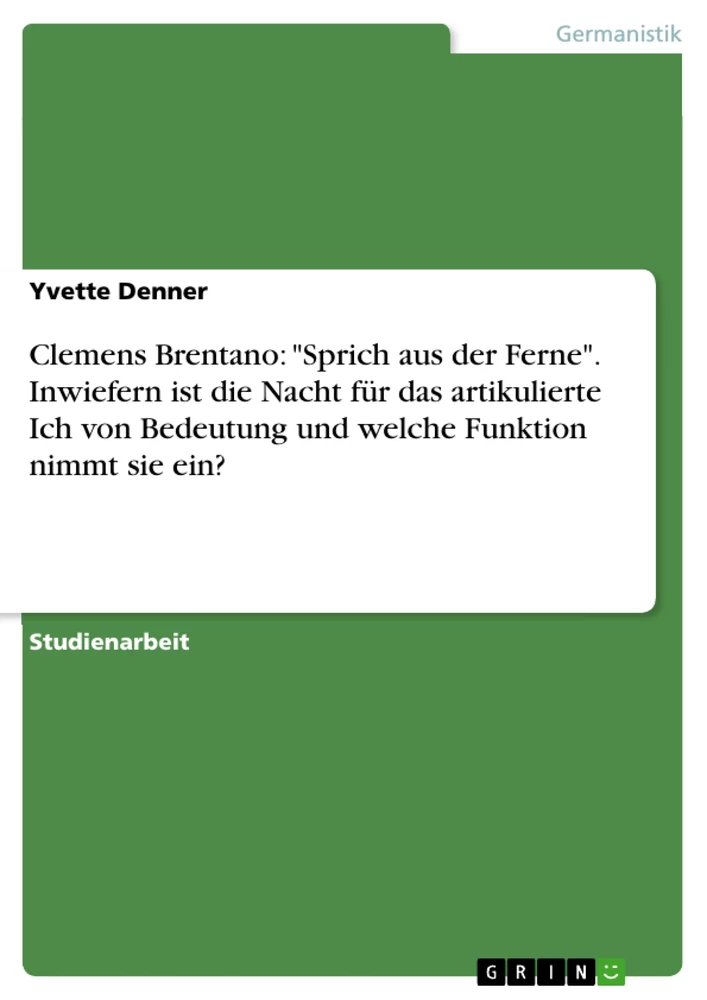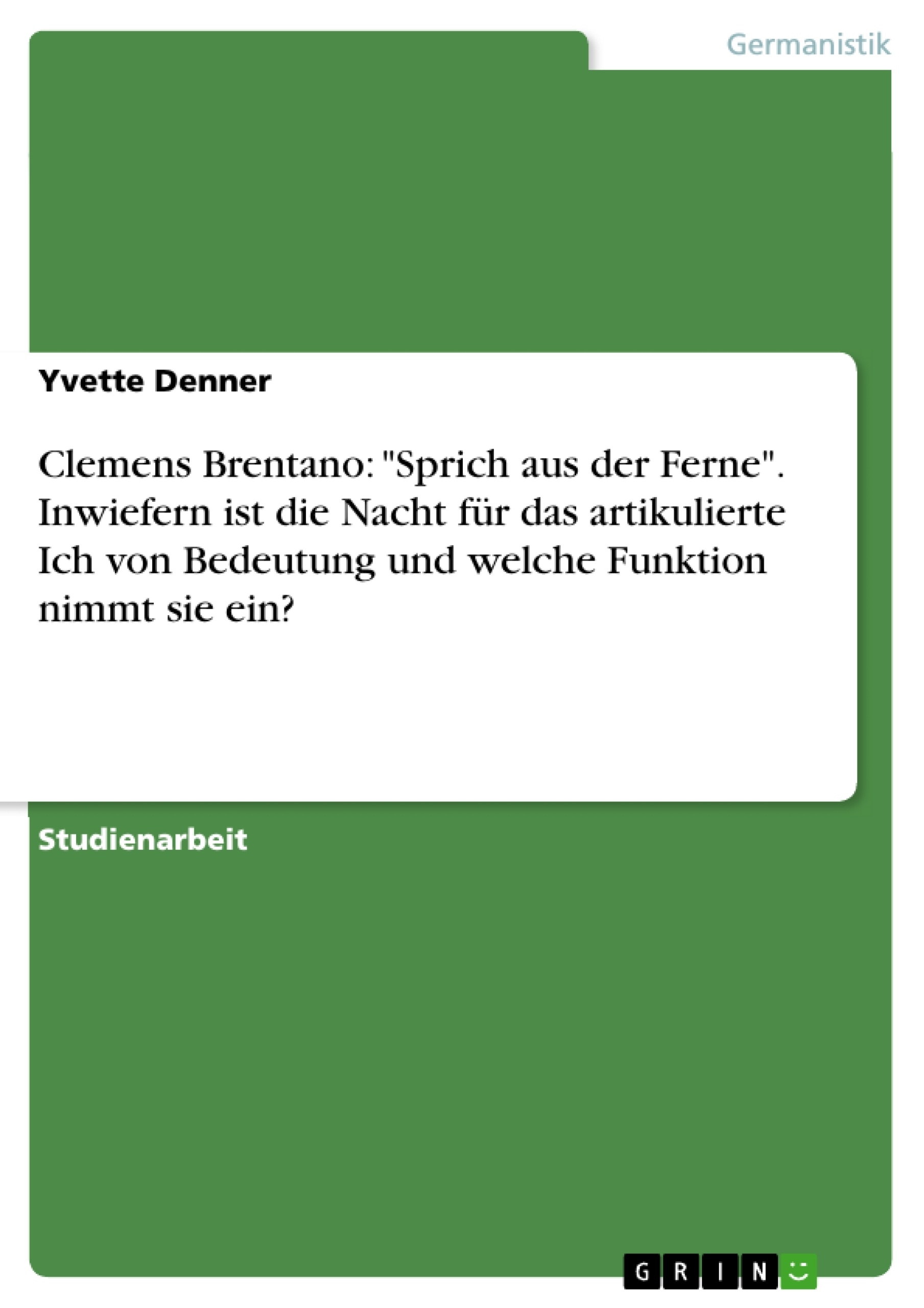Betrachtet man die Lyrik aus der Epoche der Romantik etwas genauer, so fallen die immer wiederkehrenden Motive wie Nacht, Sehnsucht, Traum, Natur und Wald besonders auf. Neben einigen Gedichten, wie beispielsweise „Mondnacht“ und „Gute Nacht“ von Joseph von Eichendorff, sowie „Nacht und Trauer“ von Ludwig Tieck hat auch Clemens Brentano mit „Der Spinnerin Nachtlied und „Hör’, es klagt die Flöte wieder“ Gedichte zum Thema Nacht verfasst. Ein weiteres Werk Brentanos, das sich in die Reihe der Nachtgedichte einordnen lässt, ist das dem Godwi-Roman entstammende Lied „Sprich aus der Ferne“ , das vermutlich im Jahre 1800 verfasst wurde. Sehr eingehend wird hier der Bezug des artikulierten Ichs zur Nacht geschildert. Dabei stellt sich die Frage: Inwiefern ist die Nacht für das artikulierte Ich von Bedeutung und welche Funktion nimmt sie ein?
Um diese Frage zu beantworten, wird zunächst eine Analyse des Inhalts einen ersten Eindruck darüber vermitteln, in welcher Beziehung das artikulierte Ich zu der Nacht steht. Zur Einstimmung auf das Gedicht folgt eine kurze biographische Einführung zu Clemens Brentano. Im weiteren Verlauf wird anhand der Bestimmung zahlreicher rhetorischer Stilmittel eine tiefergehende Interpretation der Situation des artikulierten Ichs erarbeitet. Abschließend wird die Metrik und Form des Gedichtes fokussiert und deren überaus relevante Bedeutung auf den Inhalt untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biographisches zu Clemens Brentano
- Inhalt
- Herkunft des Liedes „Sprich aus der Ferne“
- Inhaltliche Analyse des Gedichtes
- Rhetorische Stilmittel
- Tropen
- Figuren
- Metrik und Form
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Gedicht „Sprich aus der Ferne“ von Clemens Brentano und untersucht die Bedeutung der Nacht für das lyrische Ich. Dabei wird die Funktion der Nacht im Kontext des Gedichtes analysiert, um die Beziehung des Ichs zur Nacht und ihren Einfluss auf die Gestaltung des Gedichtes zu erforschen.
- Die Bedeutung der Nacht als Raum der Sehnsucht und des Verlangens
- Die Rolle der Nacht als Ort der Begegnung mit dem Geheimnisvollen und Irrealen
- Die Funktion der Nacht als Katalysator für die Suche nach dem Selbst und der Harmonie
- Die Verbindung der Nacht mit der Natur und ihren Symbolen
- Die Verwendung rhetorischer Stilmittel zur Verdeutlichung der emotionalen Landschaft des Ichs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die zentrale Fragestellung: Inwiefern ist die Nacht für das artikulierte Ich von Bedeutung und welche Funktion nimmt sie ein? Die Arbeit wird in sechs Kapiteln gegliedert, die sich mit verschiedenen Aspekten des Gedichtes beschäftigen.
Das zweite Kapitel bietet eine kurze biographische Einführung zu Clemens Brentano und skizziert seine literarische Entwicklung. Das dritte Kapitel analysiert den Inhalt des Gedichtes „Sprich aus der Ferne“ und beleuchtet die Beziehung des Ichs zur Nacht. Dabei werden die Sehnsucht nach einer unnahbaren Welt, die Suche nach dem Selbst und die Bedeutung der Natur als Ort der Begegnung mit dem Geheimnisvollen hervorgehoben.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den rhetorischen Stilmitteln, die Brentano im Gedicht verwendet. Hierbei wird die Funktion von Tropen und Figuren für die Verdeutlichung der emotionalen Landschaft des Ichs untersucht. Das fünfte Kapitel konzentriert sich auf Metrik und Form des Gedichtes und deren Einfluss auf den Inhalt.
Der Schluss fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zeigt die Bedeutung der Nacht für das lyrische Ich im Kontext des Gedichtes „Sprich aus der Ferne“ auf.
Schlüsselwörter
Clemens Brentano, „Sprich aus der Ferne“, Nacht, Sehnsucht, Natur, Verlangen, Selbstfindung, Harmonie, rhetorische Stilmittel, Tropen, Figuren, Metrik, Form, Romantik.
- Quote paper
- Yvette Denner (Author), 2009, Clemens Brentano: "Sprich aus der Ferne". Inwiefern ist die Nacht für das artikulierte Ich von Bedeutung und welche Funktion nimmt sie ein?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151151