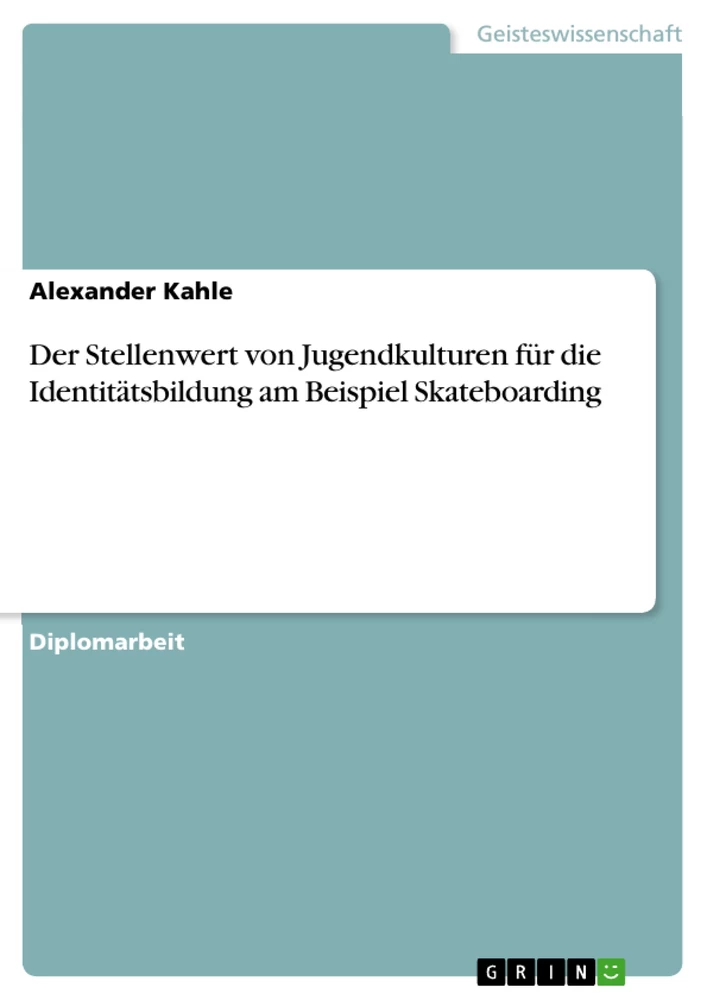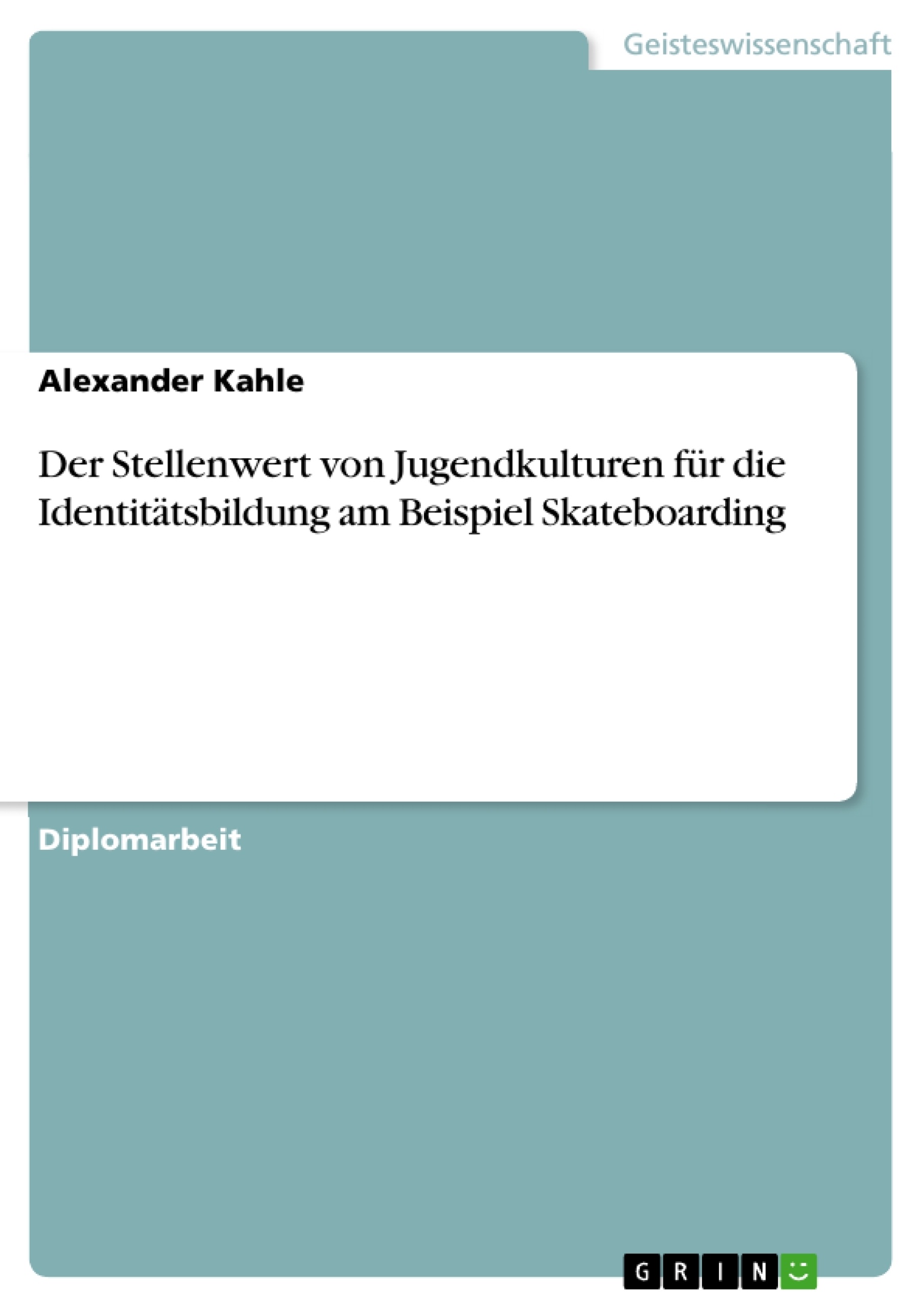Ich muss ungefähr zwölf Jahre alt gewesen sein als ich mit dem
Skateboardfahren begonnen habe. Die vorherigen Fahrversuche mit dem
Hartplastikboard meines älteren Bruders würde ich noch nicht als den
Beginn einer noch immer anhaltenden Leidenschaft bezeichnen. Jedoch war
es damals bei weitem nicht so einfach wie heute an Material zu gelangen, da einschlägige Skateboardgeschäfte gegen Anfang der 90er Jahre noch keinen wirklich großen Absatzmarkt hatten. Dementsprechend klein war auch die Auswahl an Geschäften in Deutschland. Mein erstes professionelles „Board“ bezog ich über eines der noch heute größten Versandhäuser im Bereich Skateboarding. Damals noch ein Exot, ist „Titus“ heute eines der mit Abstand angesagtesten Adressen für Jugendliche und Junggebliebene im Bereich des „Boardsports“.
An dem Tag, an dem der UPS-Wagen vor unserem Haus hielt und mir mein
heiß ersehntes Skateboard brachte, veränderte sich schlagartig mein
bisheriges Leben, das bis dahin eher normaltypisch für einen "Teenager“
diesen Alters verlaufen ist. Auf einmal war ich Skater und identifizierte mich fortan mit dem Image, welches damit unweigerlich in Verbindung steht. Von da an verbrachte ich durchschnittlich etwa acht Stunden pro Tag auf dem Brett und machte mit Freunden, die das gleiche Hobby teilten, die Straßen unsicher. Es dauerte etwa ein bis zwei Jahre bis wir eine beträchtliche Anzahl an Skatern waren - eine eingeschworene Gemeinschaft mit einem für die Szene typischen Bekleidungsstil, speziellen Begrüßungsritualen und einem Fachjargon, der für Nichtskater schlichtweg unverständlich war und irritiertes Kopfschütteln hervorrief.
Von der Skaterszene, die schon lange existierte, wurden wir Jüngeren erst viele Jahre später respektiert, obwohl einige von uns wesentlich bessere Skater waren und sich das Skater-Dasein eines Großteils dieser Jungs auch fast nur auf deren Äußeres beschränkte. Uns war dies jedoch egal. Wir hatten eine Beschäftigung gefunden die uns erfüllte, die schnell von einem Sport zu einer Lebenseinstellung wurde und die die meisten von uns auch heute noch inne haben. Im Laufe der Jahre habe ich mich oft gefragt was gewesen wäre wenn ich mich für ein anderes Hobby entschieden hätte. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Identität
- 2.1 Was steckt hinter dem Begriff Identität?
- 2.2 Vorstellung drei unterschiedlicher Identitätstheorien
- 2.2.1 Identitätstheorie von Erik H. Erikson
- 2.2.2 Identitätstheorie von George H. Mead
- 2.2.3 Identitätstheorie von Lothar Krappmann
- 2.3 Identitätsbildung als zentrale Entwicklungsaufgabe in der Jugendphase
- 3 Jugend und Jugendkultur
- 3.1 Was sind Jugendkulturen?
- 3.2 Jugendkultur und Identität
- 3.3 Szenenzugehörigkeiten als spezifische Lebensstile von Jugendkulturen
- 4 Skateboarding
- 4.1 Geschichte des Skateboardings
- 4.2 Techniken des Skateboardings und die Bedeutung für die Identitätsbildung
- 4.3 Was sind die Motivationsmerkmale des Skateboardings?
- 4.4 Was sind die mit der Dimension Skateboarding einhergehenden Identitätsimpulse?
- 5 Skateboarding und Identität im Jugendalter: Interview mit vier jugendlichen Skatern
- 5.1 Methodik
- 5.1.1 Vorgehensweise
- 5.1.2 Auswertungsverfahren
- 5.2 Interviews
- 5.2.1 Soziodemographische Daten der Interviewpartner
- 5.2.2 Aufzeigen der Kategorien
- 5.2.3 Kategorisierung der Interviewergebnisse
- 5.2.4 Zusammenfassung der Kategorisierungen
- 5.2.5 Ergebnispräsentation
- 5.1 Methodik
- 6 Sozialpädagogische Relevanz
- 6.1 Mögliche Konsequenzen für die Sozialarbeit / Sozialpädagogik
- 6.2 Experteninterview
- 6.2.1 Methodik
- 6.3 Zusammenfassung des Interviewergebnisses
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Stellenwert von Jugendkulturen für die Identitätsbildung am Beispiel des Skateboardings. Sie analysiert, wie Skateboarding als Jugendkultur die Identitätsentwicklung junger Menschen beeinflusst und welche Rolle es in der Jugendphase spielt.
- Identitätstheorien und deren Bedeutung für die Jugendphase
- Jugendkulturen als Ausdruck von Identität und Lebensentwürfen
- Das Skateboarding als Jugendkultur: Geschichte, Techniken, Motivationsmerkmale und Identitätsimpulse
- Empirische Untersuchung: Interviews mit jugendlichen Skatern über ihre Erfahrungen mit Skateboarding und Identität
- Sozialpädagogische Relevanz: Konsequenzen für die Sozialarbeit und Sozialpädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Identitätsbildung im Jugendalter ein und stellt den Bezug zum Skateboarding her. Im zweiten Kapitel werden verschiedene Identitätstheorien vorgestellt und deren Bedeutung für die Jugendphase beleuchtet. Kapitel drei widmet sich dem Konzept der Jugendkultur und deren Einfluss auf die Identitätsentwicklung. Kapitel vier behandelt das Skateboarding als Jugendkultur, analysiert seine Geschichte, Techniken, Motivationsmerkmale und Identitätsimpulse. In Kapitel fünf werden Interviews mit jugendlichen Skatern vorgestellt und deren Erfahrungen mit Skateboarding und Identität analysiert. Kapitel sechs beleuchtet die sozialpädagogische Relevanz der Thematik und zieht Schlussfolgerungen für die Sozialarbeit und Sozialpädagogik.
Schlüsselwörter
Jugendkultur, Skateboarding, Identität, Identitätsbildung, Jugendphase, Sozialpädagogik, Sozialarbeit, empirische Forschung, Interviews, Motivationsmerkmale, Identitätsimpulse.
- Quote paper
- Alexander Kahle (Author), 2010, Der Stellenwert von Jugendkulturen für die Identitätsbildung am Beispiel Skateboarding, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151066