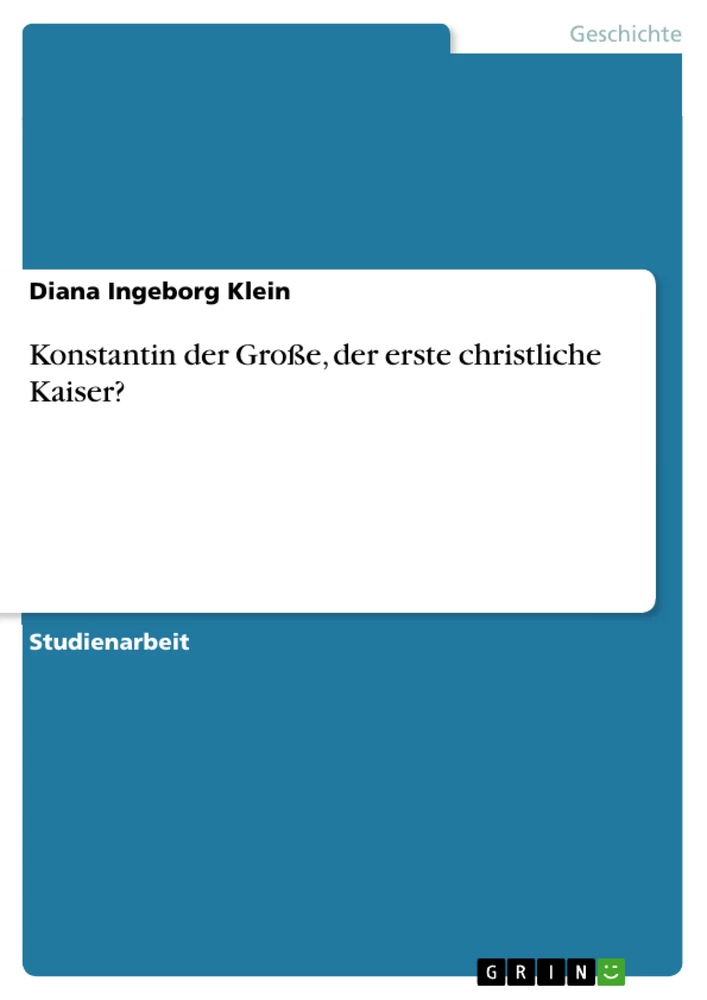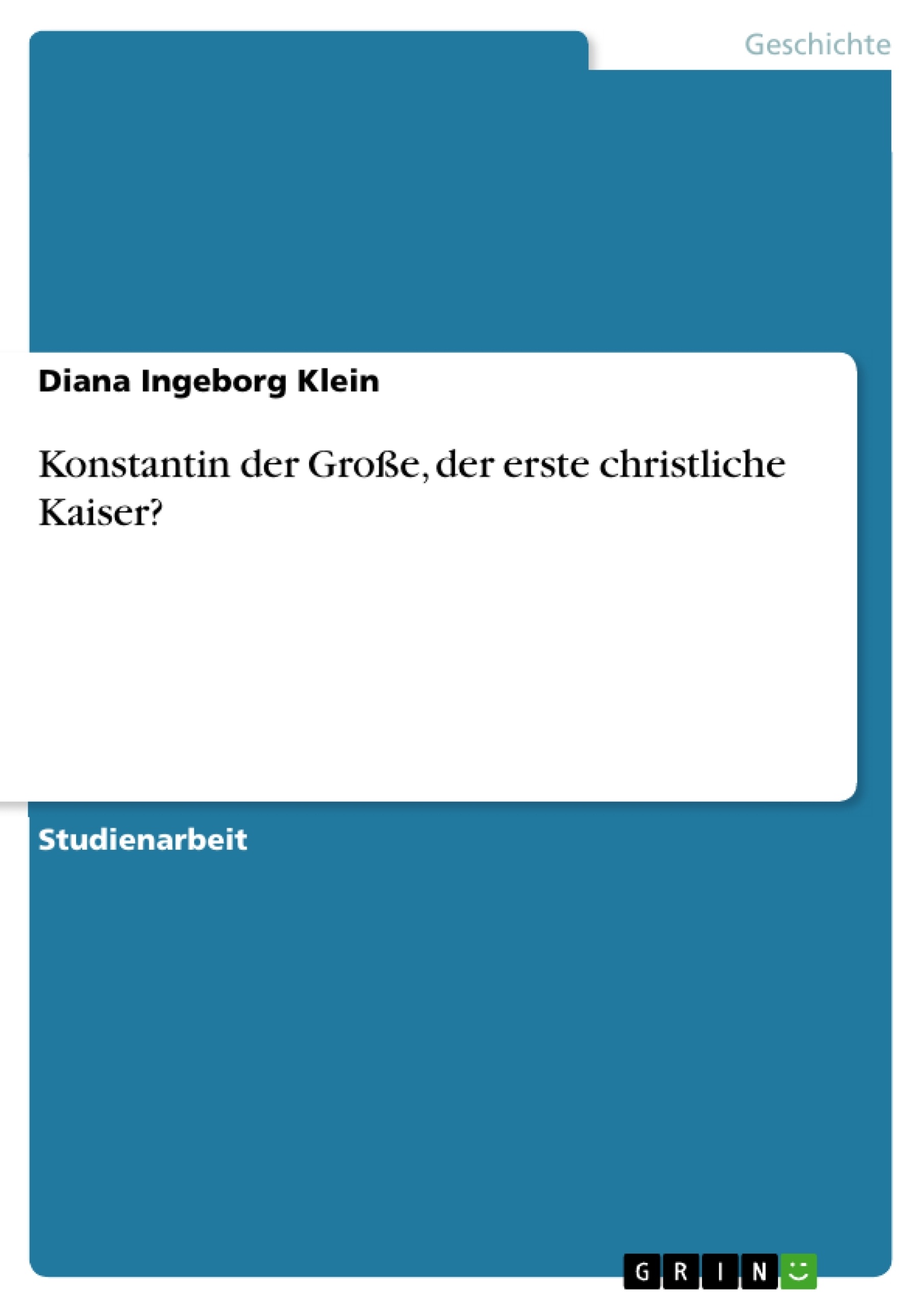Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Konstantin dem Großen unter der Fragestellung, ob es sich überhaupt um einen christlichen Kaiser handelte und woran sich dies untersuchen lässt. Zu den uns bekannten Quellen zählen hierzu vor allem die Werke „Vita Constantini“ des Konstantin – Biographen und Bischof Eusebius von Cäsarea, sowie „de mortibus persecutorum“ von Laktanz. Da es sich bei beiden Darstellungen jedoch um christliche Zeitgenossen Konstantins handelte, steht die Vermutung nahe, dass die Berichte ganz im Sinne einer Bekehrungslegende verfasst oder zumindest christlich eingefärbt wurden.
Diese Ausgangslage erfordert höchstes Maß an Quellenkritik und erschwert die Untersuchungen erheblich. Außerdem gingen durch den im Jahr 438 publizierten Codex Theodosianus, in welchem die konstantinischen Rechtsanordnungen enthalten sind, die allerdings aufgrund kaiserlicher Anordnungen auf die Kerninhalte beschränkt wurden, wichtige Fakten verloren. Was veranlasste Konstantin zu einer Gesetzgebung, welche die Christen begünstigte und wie ist überhaupt seine persönliche Religiosität einzuordnen?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Konstantin und die Religion vor 312
- 1. Christliche Einflüsse in der Jugend
- 2. Sein Bezug zum Christentum zu Zeiten dynastischer Streitigkeiten
- III. Konstantin und die Religion ab 312
- 1. Die „christliche Vision“
- 2. Christliche Zeugnisse
- a) Bautätigkeit
- b) Pro-christliche Gesetze
- 3. Konstantins Taufe und Bestattung
- IV. Konstantin der Große, als ersten christlichen Kaiser?
- V. Quellen- und Literaturverzeichnis
- VI. Anhänge
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, inwieweit Konstantin der Große als christlicher Kaiser bezeichnet werden kann. Sie analysiert Konstantins religiöse Entwicklung vor und nach dem Jahr 312, berücksichtigt dabei die verfügbaren Quellen kritisch und beleuchtet seine politischen Entscheidungen im Kontext der religiösen Landschaft des Römischen Reiches.
- Konstantins religiöse Entwicklung im Kontext seiner Jugend und dynastischen Kämpfe.
- Analyse der Quellenlage und deren mögliche christliche Voreingenommenheit.
- Konstantins politische Maßnahmen im Bezug auf das Christentum nach 312.
- Die Rolle von Konstantins persönlicher Religiosität bei seinen Entscheidungen.
- Bewertung der Bezeichnung „erster christlicher Kaiser“ im Lichte der vorliegenden Evidenz.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung: Die Arbeit untersucht die Frage nach dem christlichen Charakter Konstantins I., vor dem Hintergrund der Konstantin-Ausstellung in Trier und des 1700. Jahrestages seiner Erhebung zum Augustus. Sie betont die Bedeutung Konstantins als Wendepunkt in der heidnischen Antike und die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit den vorhandenen Quellen, insbesondere den Werken von Eusebius und Laktanz, um deren potenziell christlich geprägte Perspektive zu berücksichtigen. Der Verlust wichtiger Informationen durch den Codex Theodosianus wird ebenfalls thematisiert. Die zentrale Fragestellung ist, ob Konstantin ein christlicher Kaiser war und anhand welcher Kriterien dies untersucht werden kann.
II. Konstantin und die Religion vor 312: Dieses Kapitel beleuchtet Konstantins Jugend und seine frühen Beziehungen zum Christentum. Die umstrittene Herkunft Konstantins als möglicher unehelicher Sohn wird diskutiert, ebenso wie der Einfluss seiner heidnischen Mutter und seines „christenfreundlichen“, aber nicht christlichen Vaters, Constantius Chlorus, auf seine Entwicklung. Die Kapitel beschreibt die religiöse Landschaft des Diokletianischen Mehrkaisersystems mit Betonung der traditionellen Götter und ihrer Rolle in der Sicherung des Reichswohls. Trotz der Tradition wird die "christenfreundliche" Haltung Constantius Chlorus hervorgehoben, der sich nicht an die Verfolgungsedikte Diokletians hielt. Die Kapitel endet mit der Beschreibung Konstantins frühen militärischen Karriere und seines Aufenthaltes im Osten, der möglicherweise seine religiöse Entwicklung beeinflusste.
III. Konstantin und die Religion ab 312: Dieses Kapitel behandelt Konstantins religiöse Ausrichtung nach 312, insbesondere seine „christliche Vision“. Es analysiert die christlichen Zeugnisse seiner Herrschaft, darunter seine Bautätigkeit und pro-christliche Gesetze. Die Kapitel analysiert die Veränderung in Konstantins Münzprägungen und Titulatur und wie sie auf eine Abkehr vom Polytheismus hinweisen. Die Darstellung des Sol Invictus auf Konstantins Münzen wird hervorgehoben und im Zusammenhang mit anderen schriftlichen Zeugnissen analysiert. Die Untersuchung von Konstantins Taufe und Bestattung wird als Schlüsselfrage zur Bestimmung seines christlichen Bekenntnisses erwähnt.
Schlüsselwörter
Konstantin der Große, Christentum, Römisches Reich, Tetrarchie, Heidentum, Eusebius von Cäsarea, Laktanz, Quellenkritik, Religionspolitik, Konstantinische Wende, Sol Invictus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über Konstantin den Großen
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Frage, inwieweit Konstantin der Große als christlicher Kaiser bezeichnet werden kann. Sie analysiert seine religiöse Entwicklung vor und nach 312 n. Chr. und beleuchtet seine politischen Entscheidungen im Kontext der religiösen Landschaft des Römischen Reiches. Die Arbeit basiert auf einer kritischen Auseinandersetzung mit den verfügbaren Quellen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Konstantins religiöse Entwicklung im Kontext seiner Jugend und dynastischer Kämpfe; Analyse der Quellenlage und deren möglicher christlicher Voreingenommenheit; Konstantins politische Maßnahmen im Bezug auf das Christentum nach 312; Die Rolle von Konstantins persönlicher Religiosität bei seinen Entscheidungen; Bewertung der Bezeichnung „erster christlicher Kaiser“ im Lichte der vorliegenden Evidenz.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: I. Einführung; II. Konstantin und die Religion vor 312; III. Konstantin und die Religion ab 312; IV. Konstantin der Große, als ersten christlichen Kaiser?; V. Quellen- und Literaturverzeichnis; VI. Anhänge. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt von Konstantins Leben und Wirken im Bezug auf seine religiöse Haltung.
Wie wird die Quellenlage in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit betont die Bedeutung einer kritischen Auseinandersetzung mit den vorhandenen Quellen, insbesondere den Werken von Eusebius und Laktanz, um deren potenziell christlich geprägte Perspektive zu berücksichtigen. Der Verlust wichtiger Informationen durch den Codex Theodosianus wird ebenfalls thematisiert. Die Arbeit analysiert die Quellenlage kritisch, um eine objektive Bewertung von Konstantins religiöser Entwicklung zu ermöglichen.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit bezüglich der Bezeichnung Konstantins als "erster christlicher Kaiser"?
Die Arbeit untersucht diese Frage anhand der vorliegenden Evidenz, indem sie Konstantins religiöse Entwicklung, seine politischen Maßnahmen und seine persönliche Religiosität analysiert. Die endgültige Bewertung, ob Konstantin als erster christlicher Kaiser bezeichnet werden kann, wird im letzten Kapitel anhand der gewonnenen Erkenntnisse präsentiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Konstantin der Große, Christentum, Römisches Reich, Tetrarchie, Heidentum, Eusebius von Cäsarea, Laktanz, Quellenkritik, Religionspolitik, Konstantinische Wende, Sol Invictus.
Welche Bedeutung hat das Jahr 312 n. Chr. in der Arbeit?
Das Jahr 312 n. Chr. markiert einen Wendepunkt in Konstantins Leben und Wirken. Die Arbeit analysiert seine religiöse Entwicklung sowohl vor als auch nach diesem Jahr, um die Veränderungen in seiner Haltung und seinen Entscheidungen zu beleuchten.
Welche Rolle spielt die Analyse von Konstantins Münzprägungen und Titulatur?
Die Analyse von Konstantins Münzprägungen und Titulatur dient als wichtige Quelle zur Rekonstruktion seiner religiösen Entwicklung und seiner politischen Strategien. Änderungen in dieser Hinsicht deuten auf eine Abkehr vom Polytheismus hin. Die Darstellung des Sol Invictus wird beispielsweise im Zusammenhang mit anderen schriftlichen Zeugnissen analysiert.
- Quote paper
- Diana Ingeborg Klein (Author), 2006, Konstantin der Große, der erste christliche Kaiser?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151028