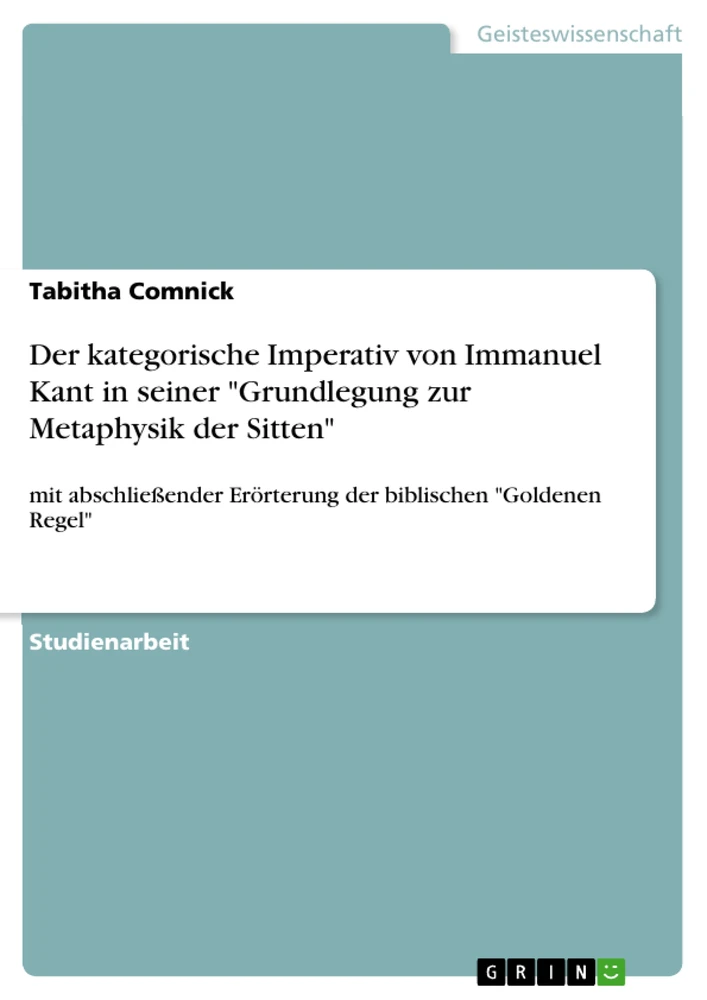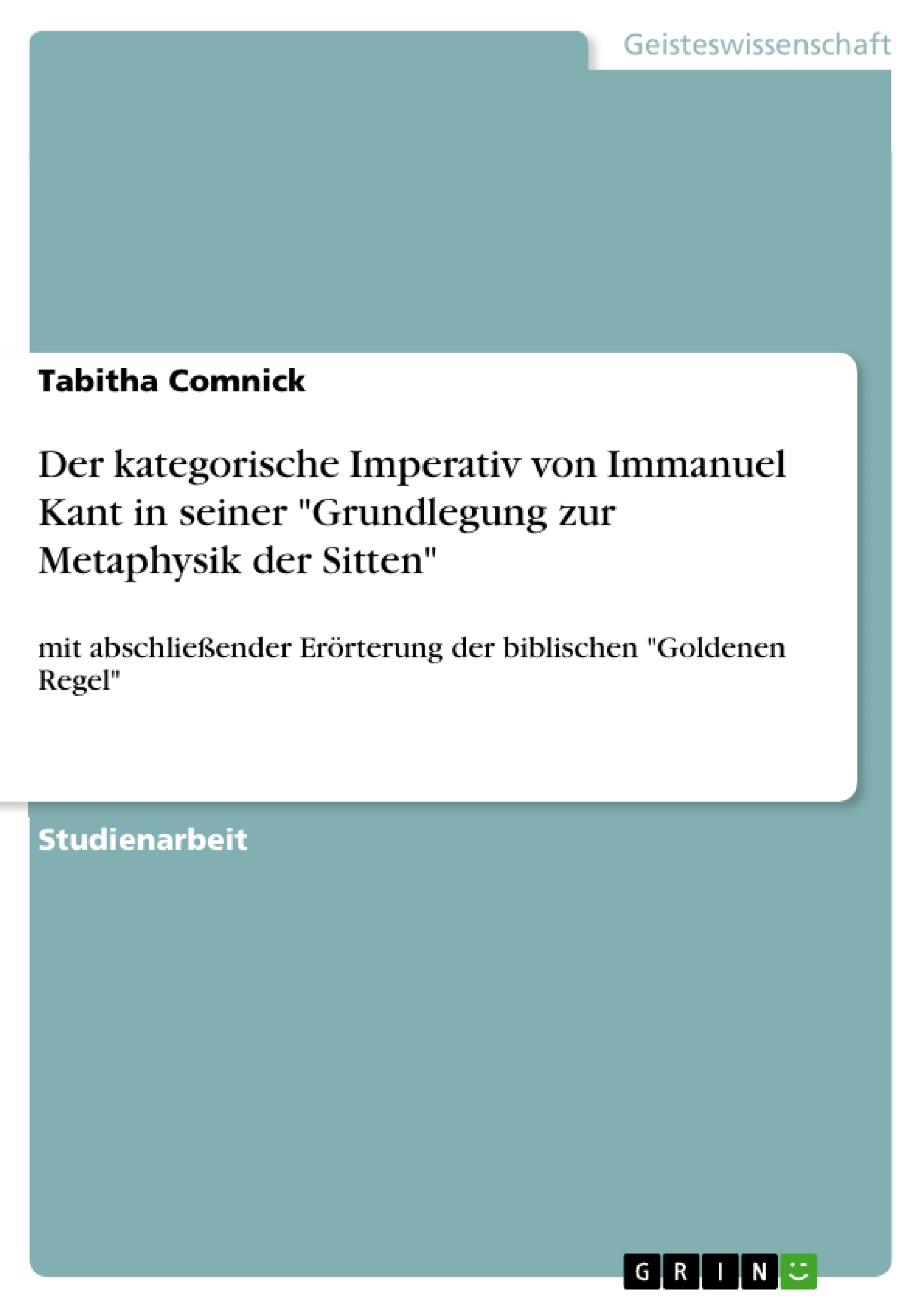In der folgenden Abhandlung wird die Kantsche „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ untersucht werden. Im Besonderen wird es unter dem letzten Punkt der Arbeit Aufgabe sein, zu schauen, in wieweit der schließlich herausgearbeitete „kategorischen Imperativ“ Kants mit der gemeinen „Goldenen Regel“ vergleichbar ist.
Für die Herausarbeitung des kategorischen Imperativs wird Kants „Grundlegung“ Primärliteratur sein.
Zunächst liegt das Augenmerk auf der Vorrede, es folgt die Untersuchung des ersten Abschnitts über den „Übergang von der gemeinen sittlichen Vernunfterkenntnis zur philosophischen“. Der zweite Abschnitt „Übergang von der populären sittlichen Weltweisheit zur Metaphysik der Sitten“ wird größeren Umfang annehmen, nicht zuletzt aus dem Grund, weil das Kapitel gut die Hälfte des Originaltextes ausmacht. Des Weiteren finden sich zum Ende hin Unterpunkte: Da wäre der erste: „Die Autonomie des Willens als oberstes Prinzip der Sittlichkeit“, der zweite: „Die Heteronomie des Willens als der Quell aller unechten Prinzipien der Sittlichkeit“ und der letzte Unterpunkt: „Einteilung aller möglichen Prinzipien der Sittlichkeit aus dem angenommenen Grundbegriffe der Heteronomie“. Im dritten Abschnitt wird es um den „Übergang von der Metaphysik der Sitten zur Kritik der reinen praktischen Vernunft“ gehen. Auch hier untergliedert Kant in: „Der Begriff der Freiheit ist der Schlüssel zur Erklärung der Autonomie des Willens“, „Freiheit muss als Eigenschaft des Willens aller vernünftigen Wesen vorausgesetzt werden“, „Wie ist ein kategorischer Imperativ möglich?“, „Von der äußersten Grenze aller praktischen Philosophie“ und zu guter letzt die „Schlussanmerkung“.
Ist ein kategorischer Imperativ überhaupt möglich? Und wenn ja, kann er so angewandt werden, wie der vermeintliche Imperativ einer „Goldenen Regel“?
Ist es also möglich und sinnvoll, den kategorischen Imperativ mit einer Volksweisheit wie der „Goldenen Regel“ zu vergleichen? Woher stammt die „Goldene Regel“ überhaupt und, seit wann gibt es sie?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Vorrede
- Zum ersten Abschnitt
- Übergang von der gemeinen sittlichen Vernunfterkenntnis zur philosophischen
- Nichts in der Welt ist gut, außer dem guten Willen an sich
- Die Pflicht
- Die Grundformel des kategorischen Imperativs
- Zum zweiten Abschnitt
- Übergang von der populären sittlichen Weltweisheit zur Metaphysik der Sitten
- Wie kann moralisches Handeln bewiesen werden?
- Der „Heilige des Evangeliums“
- Popularphilosophie und reine praktische Philosophie
- Warum überhaupt einen Imperativ?
- Die zwei Arten des Imperativs: Hypothetischer vs. Kategorischer Imperativ
- Imperativ der Glückseligkeit?!
- Drei Imperative zur Beleuchtung, was Glückseligkeit ist, und ob es sie überhaupt geben kann
- Beweisführung des moralischen Imperativs muss a priori erfolgen
- Die Maxime als Schwerpunkt im kategorischen Imperativ
- Das Naturgesetz als Schwerpunkt im kategorischen Imperativ
- Das Wollen als Schwerpunkt im kategorischen Imperativ
- Versuch der Beweisführung (a priori) der Existenz eines praktischen Gesetzes, das ohne Triebfedern gebietet und dessen Befolgung Pflicht sei
- Wie und womit muss der Begriff des Willens untersucht werden, wenn das vernünftige Wesen a priori mit dem Begriff des Willens verbunden ist?
- Wie wird der Wille gedacht? In welchem Zusammenhang steht der Zweck mit dem Willen und dadurch mit dem vernünftigen Wesen?
- Die Legitimation des praktischen Imperativs
- Das Prinzip der Autonomie des Willens und seine Freiheit
- Die Würde als innerer Wert
- Die Formel eines schlechterdings guten Willens in Analogie mit dem Naturgesetz
- Warum muss das vernünftige Wesen gleichzeitig Mittel und Zweck sein?
- Das Reich der Zwecke (und die Version des praktischen Prinzips)
- Wann ist der Wille schlechterdings gut?
- Die Autonomie des Willens als oberstes Prinzip der Sittlichkeit
- Die Heteronomie des Willens als der Quell aller unechten Prinzipien der Sittlichkeit
- Einteilung aller möglichen Prinzipien der Sittlichkeit aus dem angenommenen Grundbegriffe der Heteronomie
- Das empirische Prinzip und der Beweis, dass es ein unechtes Prinzip der Sittlichkeit ist.
- Das rationale Prinzip als unechtes Prinzip der Sittlichkeit
- Wendepunkt: von der Analyse zum Beweis der Sittlichkeit
- Zum dritten Abschnitt
- Übergang von der Metaphysik der Sitten zur Kritik der reinen praktischen Vernunft
- Der Begriff der Freiheit ist der Schlüssel zur Erklärung der Autonomie des Willens
- Freiheit muss als Eigenschaft des Willens aller vernünftigen Wesen vorausgesetzt werden
- Von dem Interesse, welches den Ideen der Sittlichkeit anhängt
- Die Vernunft (das „Ich“ a priori)
- Der eigene Wille muss unter der „Idee der Freiheit“ gedacht werden
- Wie ist ein kategorischer Imperativ möglich?
- Von der äussersten[sic!] Grenze aller praktischen Philosophie
- Die Freiheit des Willens liegt im Verborgenen
- Das Interesse zum moralischen Gesetz
- Die Möglichkeit des kategorischen Imperativs
- Schlussanmerkung
- Die sogenannte „Goldene Regel“ der Bibel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abhandlung analysiert Immanuel Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“, mit besonderem Fokus auf den kategorischen Imperativ und dessen Vergleichbarkeit mit der Goldenen Regel. Die Arbeit untersucht Kants Argumentationslinien und die philosophischen Grundlagen seiner Ethik.
- Der kategorische Imperativ als zentrales Element der Kantschen Ethik
- Der Vergleich des kategorischen Imperativs mit der Goldenen Regel
- Die Unterscheidung zwischen hypothetischem und kategorischem Imperativ
- Die Rolle der Vernunft und des guten Willens in der Kantschen Moralphilosophie
- Autonomie und Heteronomie des Willens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Untersuchungsgegenstand und die Methodik. Die Vorrede wird analysiert, wobei Kants Einteilung der Philosophie in Logik, Physik und Ethik im Mittelpunkt steht. Der erste Abschnitt behandelt den Übergang von der alltäglichen Moral zur philosophischen Ethik und legt die Grundlagen für den kategorischen Imperativ. Der zweite Abschnitt, der den größten Teil des Werkes einnimmt, befasst sich ausführlich mit der Begründung und den verschiedenen Formulierungen des kategorischen Imperativs, einschließlich der Diskussion um Autonomie und Heteronomie des Willens. Der dritte Abschnitt behandelt den Zusammenhang zwischen dem kategorischen Imperativ und dem Begriff der Freiheit.
Schlüsselwörter
Kategorischer Imperativ, Immanuel Kant, Goldene Regel, Metaphysik der Sitten, praktische Philosophie, Autonomie, Heteronomie, Vernunft, guter Wille, Pflicht, Moral.
- Arbeit zitieren
- Tabitha Comnick (Autor:in), 2008, Der kategorische Imperativ von Immanuel Kant in seiner "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1509800