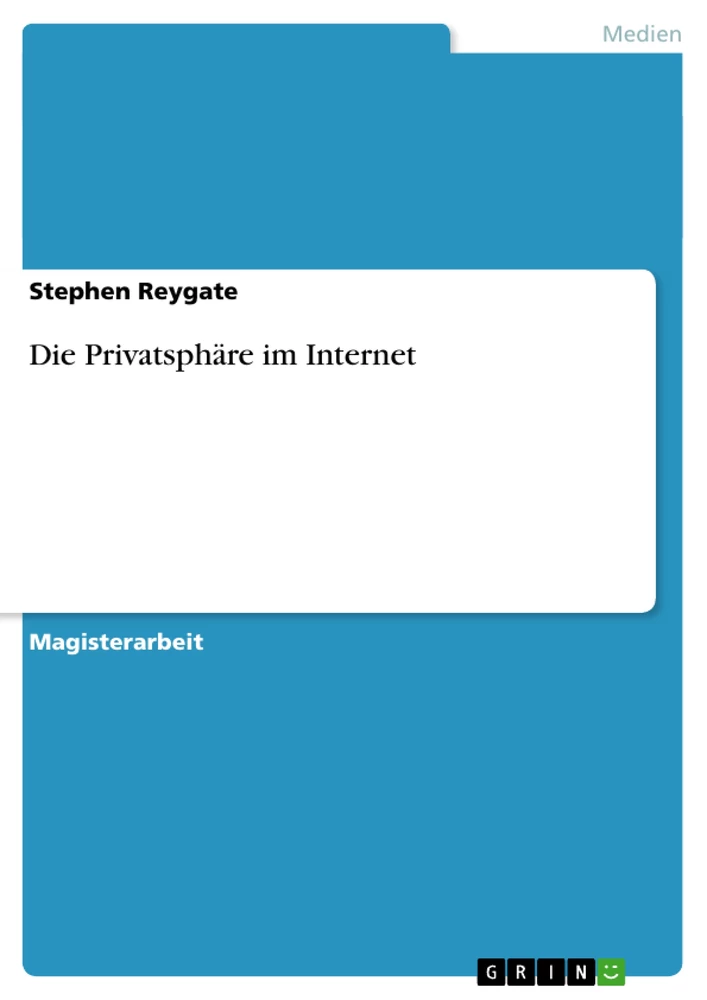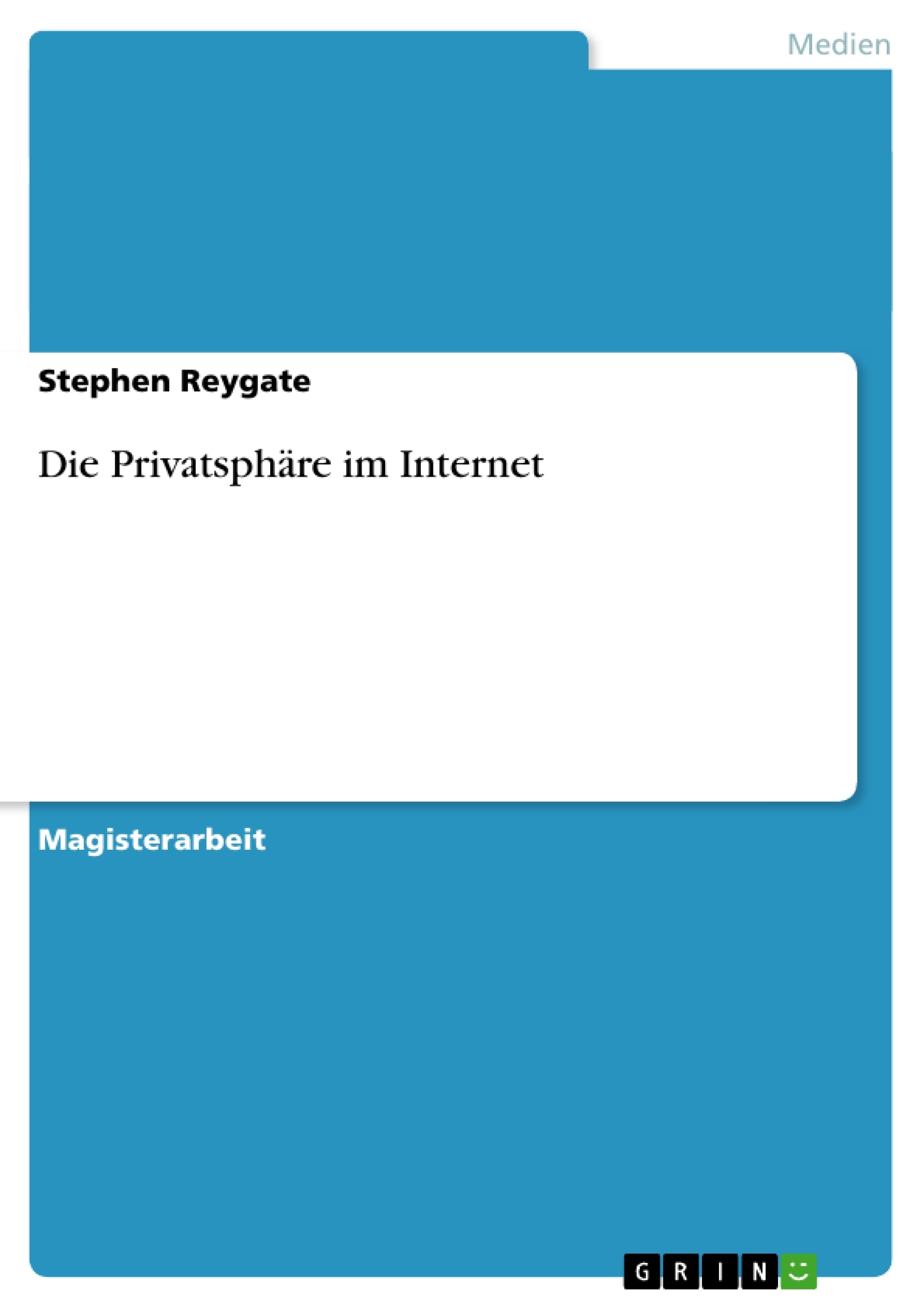Die Privatsphäre im Internet ist immer wieder Gegenstand verschiedenster Diskussionen. In der Regel entzünden sich diese Diskussionen an bestimmten Entwicklungen, wie bspw. das Aufkommen der so genannten „Social Networks“ wie studiVZ oder Facebook und den damit verbundenen Fragen, ob hier die Nutzer nicht zu viel von sich preisgeben und ob solche Plattformen zu sehr in die Privatsphäre eingreifen. Eine Reaktion besteht darin, neue Gesetze
zum Schutze der Privatsphäre zu fordern, um damit auf neue Entwicklungen wie das Internet zu reagieren. Peter Schaar ruft angesichts der Überwachungsmöglichkeiten, die neue Technologien wie das Internet bieten, gar „Das Ende der Privatsphäre“ aus.
Mit dieser Schlussfolgerung, dass die Privatsphäre am Ende sei, ist Schaar nicht alleine. Diese vielzitierte Krise der Privatsphäre ist der Anknüpfungspunkt für die vorliegende
Arbeit. Zunächst geht es in dieser Arbeit darum, den Zustand der Privatsphäre im Internet zu untersuchen. Grundlage ist dabei die Theorie der Privatsphäre von Beate Rössler, auf die die Verfechter einer kritischen Sicht der Privatsphäre häufig zurückgreifen. Ferner ist es Ziel der Arbeit, nach neuen Wegen im Umgang mit der Privatsphäre im Internet zu suchen. Hierbei
geht es darum, die Diskussion um einen weiteren Standpunkt zu erweitern und neue Perspektiven aufzuzeigen, wie Privatsphäre angesichts neuer Technologien wie Social Networks und Cloud Computing gedacht werden kann.
Zu Beginn der Arbeit wird Beate Rösslers Theorie der Privatsphäre erläutert, die vor allem den Aspekt der Kontrolle über die personenbezogenen Daten als Basis der Privatsphäre betont. Ergänzend werden kritische Anmerkungen zu Rösslers Theorie erwähnt. Im anschließenden dritten Kapitel geht es um die Bedrohungen der Privatsphäre im Internet. Dabei wird vor allem dem Bereich der Technik viel Platz eingeräumt, um darzulegen ob und inwiefern technische Entwicklungen wie Datenbanken oder das Cloud Computing dazu beitragen, die Privatsphäre einzuschränken. Neben der Technik wird auch auf die Bereiche Gesellschaft, Politik und Wirtschaft eingegangen und untersucht, ob diese auf die Privatsphäre einwirken.
Besondere Aufmerksamkeit wird in allen angesprochenen Bereichen der Frage gewidmet, ob die Privatsphäre nach Rösslers Definition und unter besonderer Berücksichtigung des Aspekts der Kontrolle eingeschränkt ist oder nicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition des Begriffs der Privatheit
- 2.1 Vorbemerkungen
- 2.2 Rösslers Definition von Privatheit
- 2.2.1 Dezisionale Privatheit
- 2.2.2 Informationelle Privatheit
- 2.2.3 Lokale Privatheit
- 2.3 Kritische Anmerkungen zu Rösslers Theorie des Privaten
- 3. Einflussfaktoren auf die Privatsphäre
- 3.1 Technik
- 3.1.1 Datenbanken
- 3.1.2 Internet
- 3.1.3 Social Software
- 3.1.4 Cloud Computing
- 3.2 Gesellschaft
- 3.3 Wirtschaft
- 3.4 Politik
- 3.1 Technik
- 4. Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre
- 4.1 Technik
- 4.2 Gesellschaft, Wirtschaft und Politik
- 5. Konzepte
- 5.1 Ist Rösslers Konzept der Privatsphäre im Internet noch haltbar?
- 5.2 Alternative Konzepte der Privatsphäre
- 5.2.1 David Brins „Transparent Society“
- 5.2.2 Privatsphäre als Eigentum
- 5.2.3 Helen Nissenbaums „kontextuelle Integrität“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den Zustand der Privatsphäre im Internet, ausgehend von Beate Rösslers Theorie der Privatsphäre. Ziel ist es, die Herausforderungen für die Privatsphäre im digitalen Zeitalter zu beleuchten und alternative Konzepte zu diskutieren. Die Arbeit sucht nach neuen Wegen im Umgang mit der Privatsphäre im Kontext neuer Technologien wie Social Networks und Cloud Computing.
- Analyse von Beate Rösslers Theorie der Privatsphäre und deren Kritikpunkte.
- Untersuchung der Einflussfaktoren auf die Privatsphäre (Technik, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik).
- Bewertung von Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre.
- Diskussion alternativer Konzepte zur Privatsphäre.
- Bewertung der Haltbarkeit von Rösslers Konzept im Kontext des Internets.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die aktuelle Debatte um die Privatsphäre im Internet vor, insbesondere im Kontext von Social Networks. Sie benennt die These vom "Ende der Privatsphäre" und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit: die Untersuchung des Zustands der Privatsphäre und die Suche nach neuen Konzepten für den Umgang damit im digitalen Raum. Die Arbeit basiert auf Rösslers Theorie der Privatsphäre und erweitert die Diskussion um alternative Perspektiven.
2. Definition des Begriffs der Privatheit: Dieses Kapitel erläutert detailliert Beate Rösslers Theorie der Privatsphäre, die die Kontrolle über personenbezogene Daten als Kern definiert. Es werden die drei Aspekte der dezisionalen, informationellen und lokalen Privatheit differenziert und im Detail beschrieben. Kritische Anmerkungen zu Rösslers Theorie werden ebenfalls einbezogen, um mögliche Schwächen und Limitationen des Modells zu beleuchten und den Rahmen für spätere Analysen zu setzen. Die Kapitelstruktur ermöglicht eine systematische Auseinandersetzung mit dem zentralen Begriff der Arbeit und legt den Grundstein für die nachfolgende Untersuchung der Einflussfaktoren.
3. Einflussfaktoren auf die Privatsphäre: Dieses Kapitel analysiert die Einflussfaktoren auf die Privatsphäre, fokussiert auf Technik (Datenbanken, Internet, Social Software, Cloud Computing), Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Es wird untersucht, wie technische Entwicklungen, gesellschaftliche Veränderungen, wirtschaftliche Interessen und politische Maßnahmen die Privatsphäre beeinflussen und inwiefern diese Einflüsse die Kontrolle über personenbezogene Daten gemäß Rösslers Definition einschränken. Die detaillierte Analyse der verschiedenen Bereiche bietet ein umfassendes Verständnis der komplexen Herausforderungen für den Schutz der Privatsphäre im Internet.
4. Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre: Das Kapitel befasst sich mit Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre, sowohl aus technischer Perspektive (z.B. Anonymisierung im Internet) als auch in Bezug auf gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Strategien. Es werden verschiedene Ansätze und Möglichkeiten diskutiert, die den Schutz der Privatsphäre verbessern könnten. Die Auseinandersetzung mit technischen und nicht-technischen Lösungen ermöglicht eine ganzheitliche Betrachtung der Problematik und bietet Handlungsempfehlungen für einen effektiven Datenschutz.
5. Konzepte: Dieses Kapitel stellt die Ergebnisse der vorhergehenden Kapitel in Relation zu Rösslers Theorie und prüft deren Haltbarkeit im Kontext des Internets. Es werden drei alternative Konzepte vorgestellt: David Brins „Transparent Society“, die Vorstellung von Privatsphäre als Eigentum und Helen Nissenbaums „kontextuelle Integrität“. Diese verschiedenen Ansätze werden miteinander verglichen und bieten alternative Perspektiven auf den Umgang mit Privatsphäre im digitalen Zeitalter. Die Präsentation verschiedener Konzepte bereichert die Diskussion und zeigt die Vielschichtigkeit des Themas.
Schlüsselwörter
Privatsphäre, Internet, Datenschutz, Beate Rössler, Social Networks, Cloud Computing, Datenkontrolle, Informationelle Privatheit, Dezisionale Privatheit, Lokale Privatheit, Alternative Konzepte, Transparenz, Kontextuelle Integrität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Privatsphäre im Internet
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den Zustand der Privatsphäre im Internet, insbesondere im Kontext neuer Technologien wie Social Networks und Cloud Computing. Sie analysiert die Herausforderungen für die Privatsphäre im digitalen Zeitalter und diskutiert alternative Konzepte zum Umgang mit ihr.
Welche Theorie bildet die Grundlage der Arbeit?
Die Arbeit basiert auf Beate Rösslers Theorie der Privatsphäre, welche die Kontrolle über personenbezogene Daten als zentralen Aspekt definiert. Die Arbeit erweitert jedoch die Diskussion um alternative Perspektiven und prüft die Haltbarkeit von Rösslers Konzept im Kontext des Internets.
Welche Aspekte von Rösslers Theorie werden behandelt?
Die Arbeit erläutert detailliert Rösslers drei Aspekte der Privatsphäre: dezisionale, informationelle und lokale Privatheit. Sie beinhaltet auch eine kritische Auseinandersetzung mit Rösslers Theorie und ihren möglichen Schwächen.
Welche Einflussfaktoren auf die Privatsphäre werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Einflussfaktoren auf die Privatsphäre, die sich in Technik (Datenbanken, Internet, Social Software, Cloud Computing), Gesellschaft, Wirtschaft und Politik gliedern. Es wird untersucht, wie diese Faktoren die Kontrolle über personenbezogene Daten beeinflussen.
Welche Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre werden diskutiert?
Die Arbeit behandelt Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre aus technischer (z.B. Anonymisierung) und nicht-technischer (gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Strategien) Perspektive. Verschiedene Ansätze und Möglichkeiten zur Verbesserung des Datenschutzes werden diskutiert.
Welche alternativen Konzepte zur Privatsphäre werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert und vergleicht drei alternative Konzepte: David Brins „Transparent Society“, die Vorstellung von Privatsphäre als Eigentum und Helen Nissenbaums „kontextuelle Integrität“. Diese bieten alternative Perspektiven auf den Umgang mit Privatsphäre im digitalen Zeitalter.
Wie wird Rösslers Konzept im Kontext des Internets bewertet?
Die Arbeit prüft die Haltbarkeit von Rösslers Konzept im Kontext des Internets und stellt die Ergebnisse der vorherigen Kapitel in Relation zu ihrer Theorie. Die Diskussion der alternativen Konzepte dient als Grundlage für diese Bewertung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Privatsphäre, Internet, Datenschutz, Beate Rössler, Social Networks, Cloud Computing, Datenkontrolle, Informationelle Privatheit, Dezisionale Privatheit, Lokale Privatheit, Alternative Konzepte, Transparenz, Kontextuelle Integrität.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Definition des Begriffs der Privatheit, Einflussfaktoren auf die Privatsphäre, Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre und Konzepte (inkl. einer Bewertung von Rösslers Konzept im Kontext des Internets und alternativer Konzepte).
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Herausforderungen für die Privatsphäre im digitalen Zeitalter zu beleuchten und alternative Konzepte zu diskutieren. Sie sucht nach neuen Wegen im Umgang mit der Privatsphäre im Kontext neuer Technologien.
- Quote paper
- Stephen Reygate (Author), 2009, Die Privatsphäre im Internet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150954