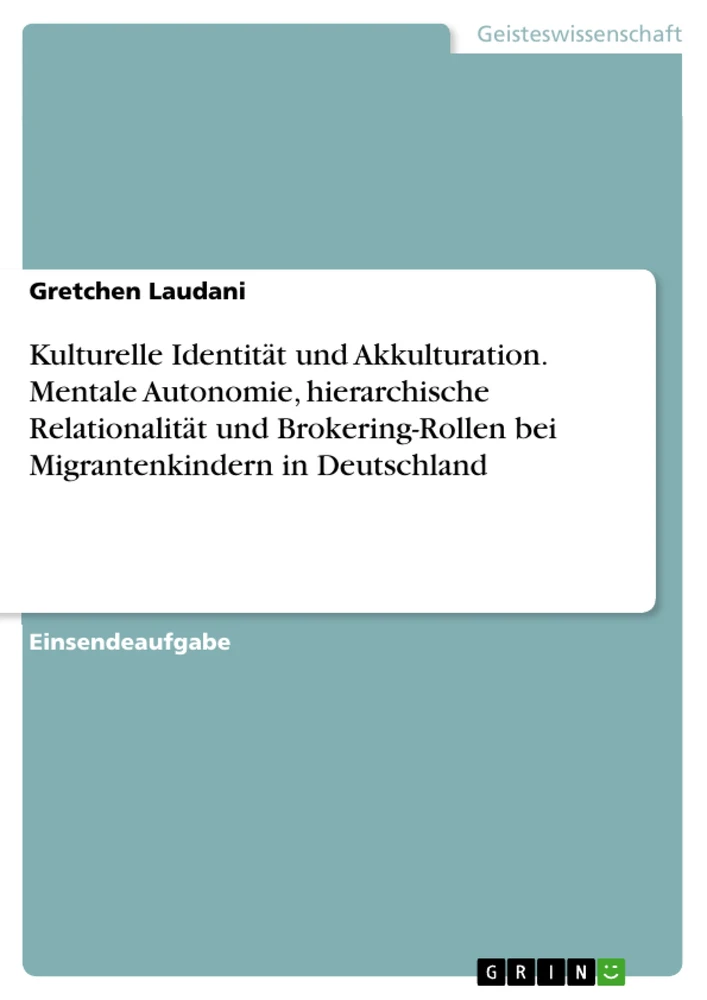Die vorliegende Arbeit analysiert die Konzepte der mentalen Autonomie und hierarchischen Relationalität anhand von Fallbeispiel Esmas Erfahrungen im Spannungsfeld zwischen westlichen Vorstellungen individueller Freiheit und den traditionellen Werten ihrer syrischen Herkunftsfamilie. Zudem wird Esmas Rolle als language und culture broker untersucht, durch die sie als Vermittlerin zwischen der deutschen Gesellschaft und ihrer Familie fungiert. Mithilfe von Berrys Akkulturationsmodell wird Esmas Integrationsstrategie im Vergleich zur Separationsstrategie ihrer Eltern analysiert. Zusätzlich wird der Einfluss kultureller Unterschiede in Bezug auf Zeitverständnisse (polychrone vs. monochrone Kulturen) und Kommunikationsstile (kontextstarke vs. kontextschwache Kulturen) auf Esmas soziale Interaktionen thematisiert. Abschließend wird der Zusammenhang von familiären Konflikten, language brokering und psychischen Belastungen bei Migrantenkindern untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Aufgabe 1
- Aufgabe 1.1
- Aufgabe 1.2
- Aufgabe 1.3
- Aufgabe 1.4
- Aufgabe 2
- Aufgabe 2.1
- Aufgabe 2.2
- Aufgabe 2.3
- Aufgabe 3
- Aufgabe 3.1
- Aufgabe 3.2
- Aufgabe 3.3
- Aufgabe 3.4
- Aufgabe 3.5
- Aufgabe 4
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert anhand einer Fallaufgabe verschiedene Aspekte der interkulturellen Psychologie. Im Fokus steht die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Konflikten, die durch unterschiedliche kulturelle Hintergründe und Akkulturationsprozesse entstehen können.
- Mentale Autonomie vs. hierarchische Relationalität
- Rollen von Language und Culture Brokern in Familien
- Akkulturationsstrategien nach Berry
- Polychrone und monochrone Zeitverständnisse
- Kontextstarke und kontextschwache Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Aufgabe 1 untersucht die Konzepte der mentalen Autonomie und hierarchischen Relationalität im Kontext der Fallstudie um Esma und ihre Familie. Aufgabe 1.1 beschreibt diese Konzepte, während Aufgabe 1.2 die Rollen von Language und Culture Brokering beleuchtet. Aufgabe 1.3 und 1.4 ordnen Esma und ihre Eltern verschiedenen Akkulturationsstrategien zu.
Aufgabe 2 befasst sich mit depressiven Symptomen bei Migrantenkindern. Aufgabe 2.1 präsentiert Ergebnisse einer Studie zu diesem Thema. Aufgabe 2.2 diskutiert mögliche Faktoren für Esmas depressive Symptomatik, während Aufgabe 2.3 familiäre Faktoren beleuchtet.
Aufgabe 3 erörtert polychrone und monochrone Kulturen und deren Einfluss auf die Kommunikation. Aufgabe 3.1 beschreibt diese Konzepte, 3.2 vergleicht sie und 3.3, 3.4 und 3.5 analysieren deren Relevanz im Fall Esma sowie Kontextstarke und kontextschwache Kommunikation.
Aufgabe 4 präsentiert ein Wahrnehmungstagebuch, in dem die Autorin ihre Erfahrungen mit mentaler Autonomie und hierarchischer Relationalität in verschiedenen Kontexten beschreibt (Arbeitsplatz, Familie, Freunde, Sportverein).
Schlüsselwörter
Interkulturelle Psychologie, Akkulturation, mentale Autonomie, hierarchische Relationalität, Language Brokering, Culture Brokering, Akkulturationsmodell von Berry, polychrone und monochrone Kulturen, kontextstarke und kontextschwache Kommunikation, depressive Symptomatik, Migration, Familienkonflikte.
- Quote paper
- Gretchen Laudani (Author), 2024, Kulturelle Identität und Akkulturation. Mentale Autonomie, hierarchische Relationalität und Brokering-Rollen bei Migrantenkindern in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1507726