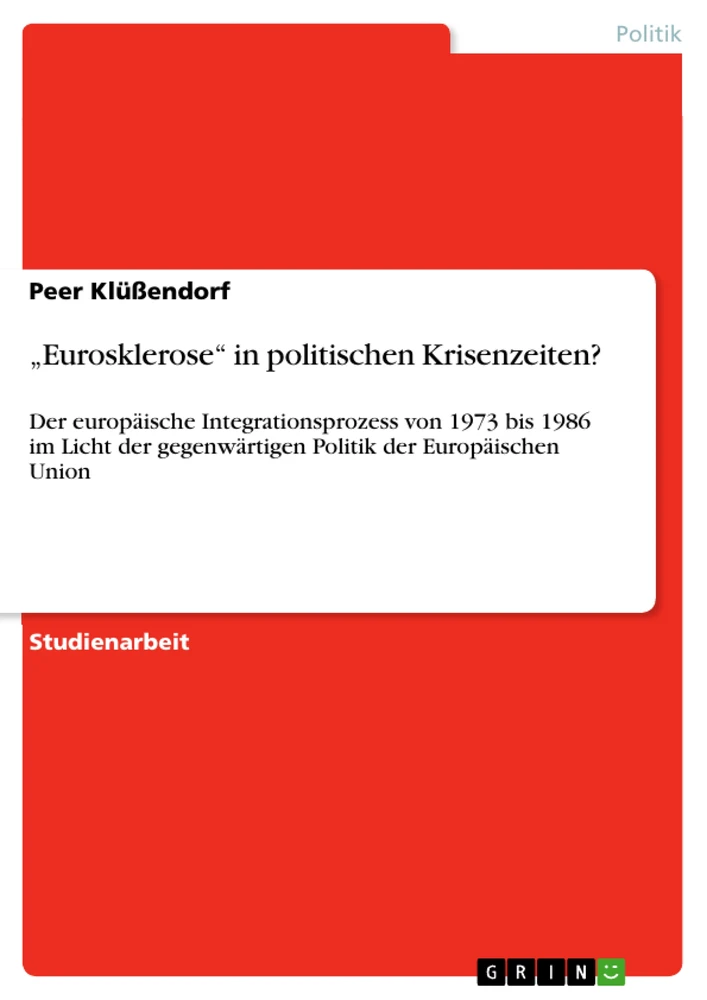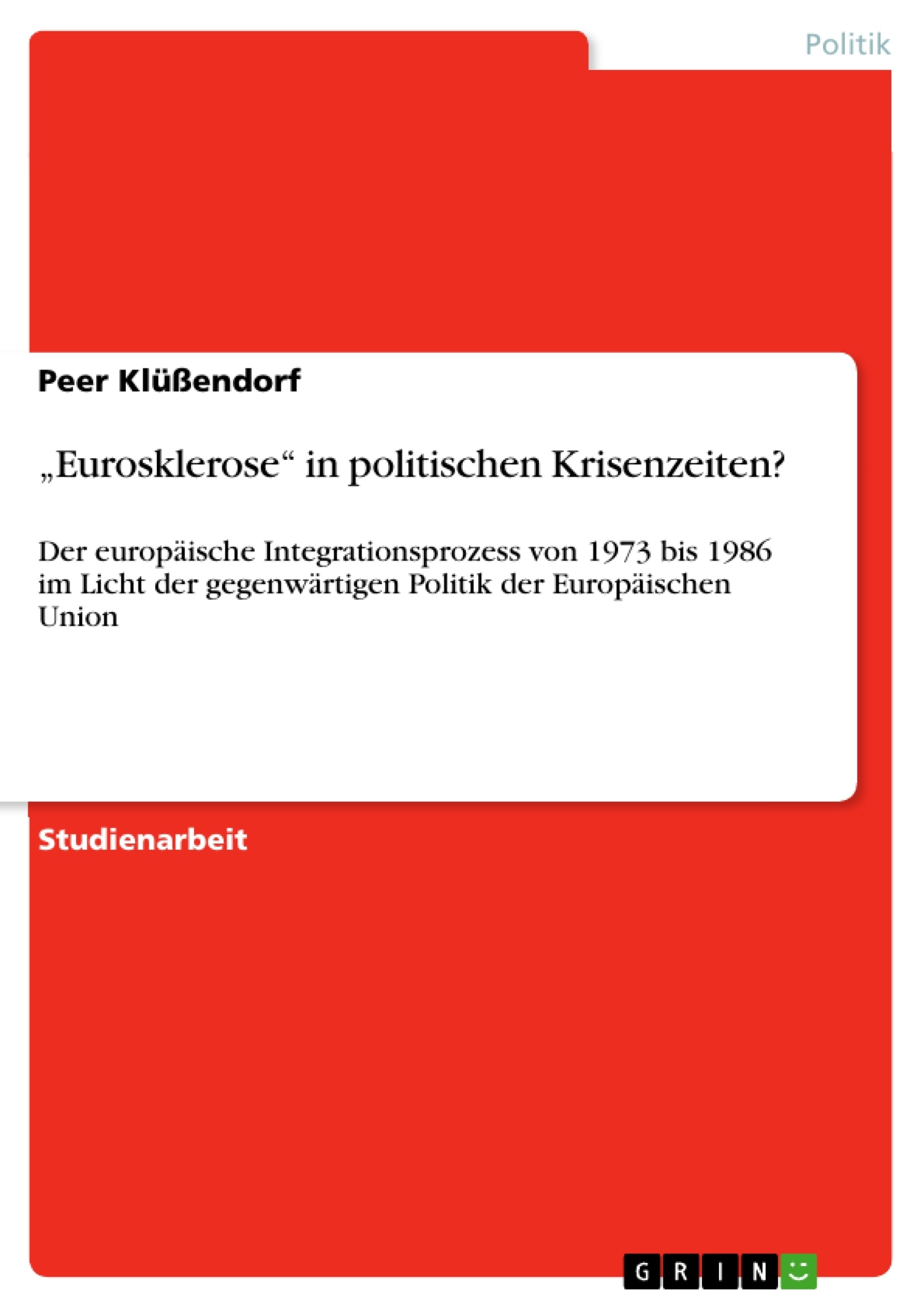Die Finanzkrise, die im Jahr 2007 mit einer Immobilienkrise in den Vereinigten Staaten von Amerika begann, erreicht die Europäische Union in immer stärkerem Ausmaß. Am 9. April 2010 stufte die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit Griechenlands auf BBB- herab und stellte Kredite an das Mitglied der Eurozone damit nahezu auf eine Stufe mit spekulativen Anlagen. Einem kurz darauf präsentierten gemeinsamen Rettungsplan gingen zweimonatige Verhandlungen voraus, in denen sich viele Stimmen insbesondere aus der deutschen Politik kritisch gegenüber zusätzlichen finanziellen Hilfen äußerten. Deutschland, so der ehemalige Bundesaußenminister Joschka Fischer, ziehe sich immer mehr als der Motor der europäischen Integration zurück und verfolge zunehmend seine engeren nationalen Interessen. Ohne diesen „Integrationsmotor“ seien jedoch eine fortschreitende Renationalisierung der Europäischen Union und damit ein „schwacher Staatenbund“ unvermeidlich. Der institutionell geschaffene Rahmen des Lissabonner Vertrages werde ohne Kooperationsbereitschaft „so unnötig wie ein Kropf.“ Besteht Anlass, diese Befürchtungen eines Scheiterns des europäischen Integrationsprozesses zu teilen? In der Tat scheinen seit Beginn der Finanzkrise zahlreiche Beispiele nationaler Alleingänge diese These zu bekräftigen. Andererseits hat sich den immer wiederkehrenden Renationalisierungsphänomenen zum trotz der Integrationsprozess der Europäischen Union in den beiden vergangenen Jahrzehnten stetig fortgesetzt. Folglich ist es interessant zu untersuchen, inwiefern einzelstaatliche Bestrebungen innerhalb der Europäischen Union wiederkehrende Reaktionen auf wirtschaftliche Krisensituationen darstellen und welche Auswirkungen diese Handlungsweisen auf Dauer und Ausmaß der bestehenden Probleme haben. Exemplarisch dafür kann die Krisenphase der EU von 1973 bis 1986 angesehen werden, die „Eurosklerose.“ Dieser Begriff steht sinnbildlich für eine Verhärtung der Strukturen und politischen Entscheidungsfähigkeit der Europäischen Union zur damaligen Zeit und wurde vom deutschen Volkswirt Herbert Giersch geprägt. Aufgrund der mit diesem Begriff verbundenen negativen Assoziationen, findet er jedoch bis in die Gegenwart Verwendung als Ausdruck festgefahrener EU-Strukturen, die der Situation bis zum Beschluss der Einheitlichen Europäischen Akte 1986 in mehr oder minder großem Maße ähneln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Eurosklerose“ von 1973 bis 1986
- Ursachen und Folgen der Eurosklerose
- Erste Lösungsstrategien
- Die Einheitliche Europäische Akte als Ausweg aus der Eurosklerose
- Die gegenwärtiger EU-Politik im Licht der Eurosklerose
- Die EU seit der Finanzkrise - droht eine „,Eurosklerose 2.0\"?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die „Eurosklerose“ als Phase stagnierender europäischer Integration von 1973 bis 1986. Dabei werden die Ursachen und Folgen dieses Prozesses beleuchtet, gefolgt von einer Analyse der Lösungsstrategien. Die Arbeit befasst sich auch mit der Frage, ob aktuelle Entwicklungen in der Europäischen Union Parallelen zur „Eurosklerose“ aufweisen und ob eine „Eurosklerose 2.0“ droht.
- Die Ursachen und Folgen der „Eurosklerose“ in der Zeit von 1973 bis 1986.
- Die politischen und wirtschaftlichen Reaktionen auf die „Eurosklerose“ und die Entwicklung der Europäischen Union in dieser Zeit.
- Der Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen Krisen und dem europäischen Integrationsprozess.
- Die aktuelle Lage der EU im Licht der Finanzkrise und die Frage, ob Parallelen zur „Eurosklerose“ bestehen.
- Die potenziellen Auswirkungen auf die Zukunft der europäischen Integration.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den aktuellen Kontext der europäischen Integration dar, der durch die Finanzkrise geprägt ist. Sie führt den Begriff der „Eurosklerose“ ein, der die Stagnation des Integrationsprozesses von 1973 bis 1986 beschreibt. Die Arbeit untersucht die Ursachen und Folgen dieser Phase, darunter der Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems und die damit verbundenen Herausforderungen für die europäische Wirtschaft. Weiterhin beleuchtet sie die Lösungsstrategien, die zur Bewältigung der „Eurosklerose“ entwickelt wurden, einschließlich der Einheitlichen Europäischen Akte. Die Arbeit analysiert zudem die gegenwärtige Situation der EU im Licht der „Eurosklerose“ und untersucht, ob sich die aktuelle Finanzkrise als „Eurosklerose 2.0“ erweisen könnte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit folgenden Schlüsselbegriffen: „Eurosklerose“, europäische Integration, Finanzkrise, Bretton Woods-System, Einheitliche Europäische Akte, Renationalisierung, Wirtschaftspolitik, Fiskalpolitik, Wechselkurse. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen Krisen und dem Integrationsprozess der Europäischen Union, sowie die Entwicklung der EU-Institutionen in der Vergangenheit und Gegenwart.
- Quote paper
- Peer Klüßendorf (Author), 2010, „Eurosklerose“ in politischen Krisenzeiten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150723