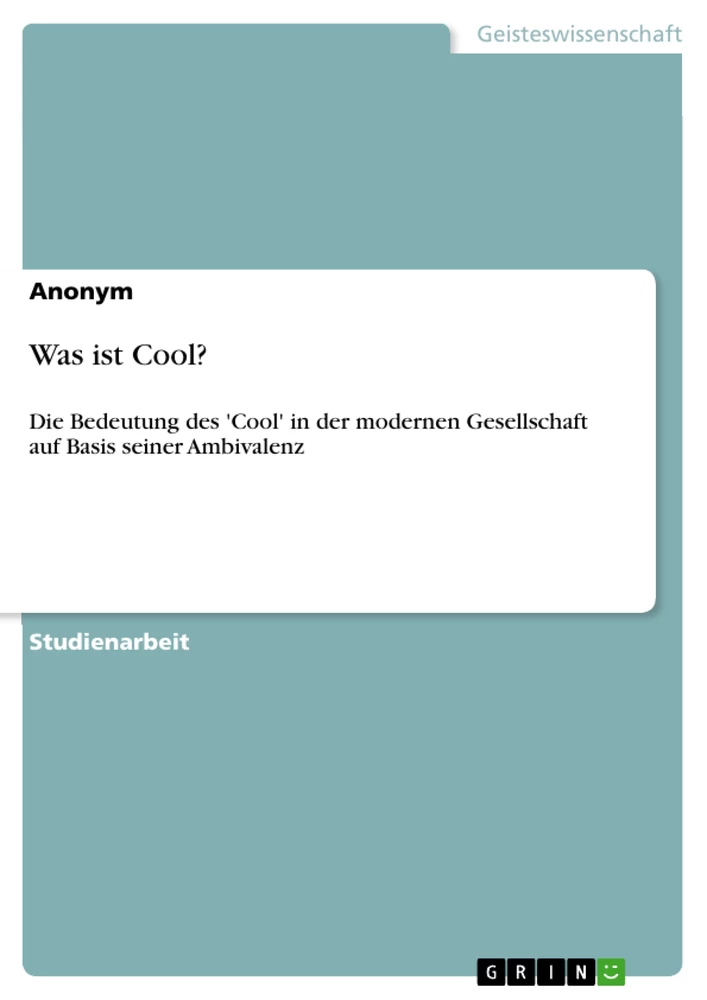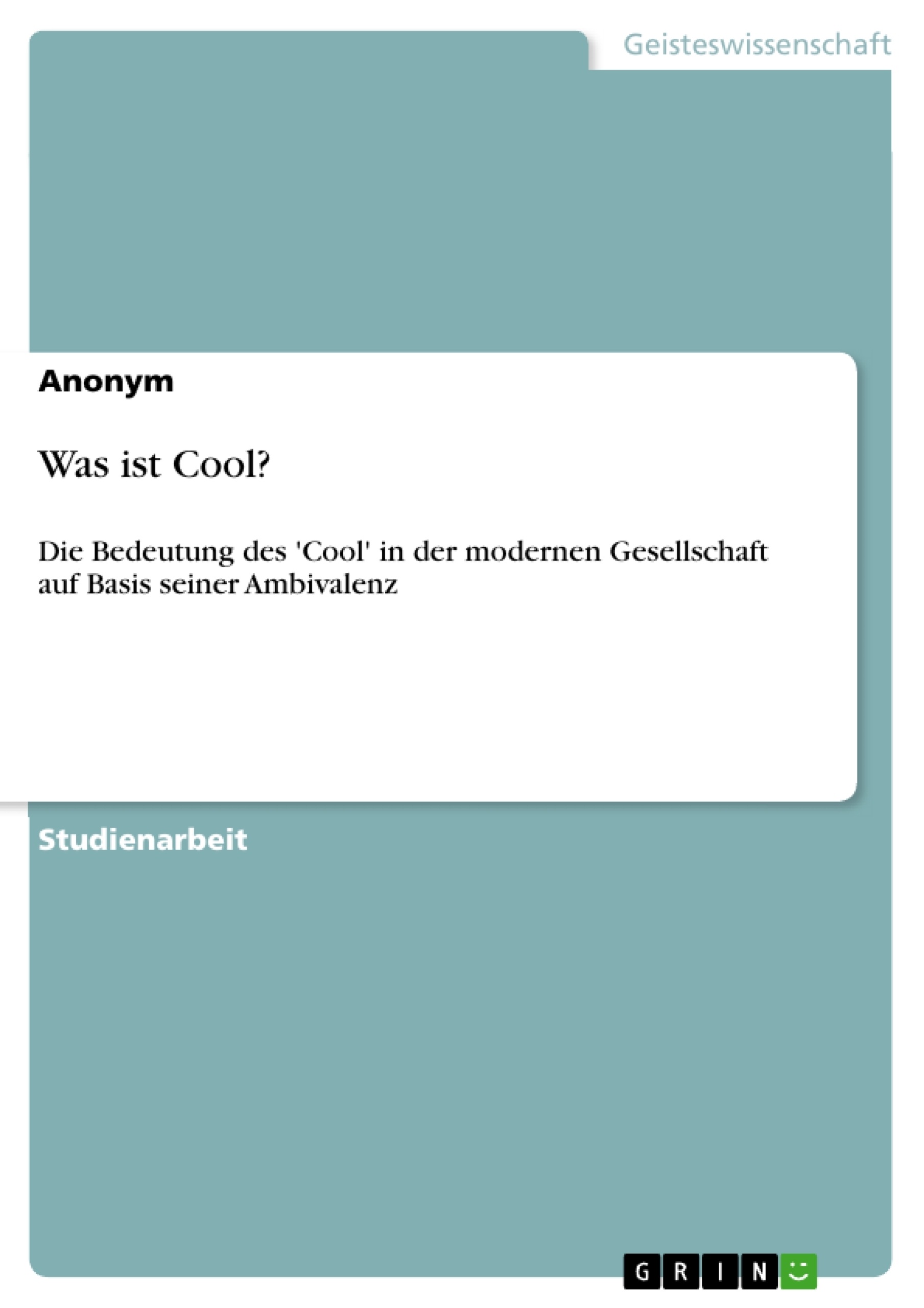Was ist Cool? Sind es etwa die neuen Trends, oder ist es das Alte, bereits da gewesene? Ist Vieles cool, oder doch nur Weniges? Bin ich selbst cool?
Diese Arbeit versucht dem Cool nachzuspüren, indem sie beide Facetten beleuchtet. Während zunächst die Bedeutung des Adjektivs cool im Fokus steht, behandelt der zweite Teil der Arbeit die Entwicklung der Coolness zum Leitbild der gesamten Gesellschaft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Cool als universales Abgrenzungsattribut
- 3. Der Habitus des Cool im Wandel der Zeit
- 3.1 Coolness als Überlebensstrategie
- 3.2 Wandel zum Leitbild der gesamten Gesellschaft
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung des Begriffs "cool" in der modernen Gesellschaft, insbesondere seine Ambivalenz als Abgrenzungsattribut und Verhaltensweise. Sie verfolgt das Ziel, die weitverbreitete Verwendung von "cool" in der Alltagssprache zu erklären und die Entwicklung von Coolness als gesellschaftliches Leitbild zu beleuchten.
- Die Ambivalenz des Begriffs "cool" als Abgrenzungsmerkmal und Verhaltensmuster
- Der Wandel des Begriffs "cool" im Laufe der Zeit
- Coolness als Überlebensstrategie marginalisierter Gruppen
- Die Entwicklung von Coolness zum gesellschaftlichen Leitbild
- Die kritische Betrachtung der Coolness als gesellschaftliches Phänomen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung von "cool" in der modernen Gesellschaft. Sie betont die Ambivalenz des Begriffs, der sowohl ein Abgrenzungsattribut als auch eine Verhaltensweise beschreibt. Die Arbeit kündigt an, beide Facetten zu beleuchten, beginnend mit der Bedeutung des Adjektivs "cool" und fortfahrend mit der Entwicklung der Coolness zu einem gesellschaftlichen Leitbild.
2. Cool als universales Abgrenzungsattribut: Dieses Kapitel analysiert den inflationären Gebrauch des Wortes "cool" in der deutschen Alltagssprache. Es beschreibt "cool" als universell einsetzbare Vokabel, die allgemeine Zustimmung ausdrückt und als Abgrenzungsattribut fungiert, das das Schöne, Moderne, Hippe und Erfreuliche beschreibt. Die Arbeit betont die fehlende präzise Definition von "cool" und dessen "leere Worthülse"-Charakter, der individuelle Interpretation zulässt. Sie verbindet den Aufstieg von "cool" mit seiner Verwendung als Zugehörigkeitskriterium in Jugend- und Subkulturen und dessen Ausweitung auf alle Gesellschaftsschichten aufgrund seiner "vagabundierenden Semantik".
3. Der Habitus des Cool im Wandel der Zeit: Dieses Kapitel untersucht Coolness als "habitualisierte Technik des Sich-Entziehens". Es beleuchtet die historische Entwicklung, fokussiert jedoch primär auf die Prozesse des letzten Jahrhunderts. Zentral ist die Frage, wie sich Coolness vom Habitus der Unterdrückten zum gesellschaftlichen Leitbild entwickelte und welche kritischen Aspekte diese Entwicklung aufweist. Das Kapitel verweist auf die antike Philosophie, besonders die stoische Apatheia, als Vorläufer der Coolness.
3.1 Coolness als Überlebensstrategie: Dieser Abschnitt betrachtet Coolness als Überlebensstrategie marginalisierter Gruppen. Emotionale Distanz und Gleichgültigkeit werden als Mechanismen dargestellt, um eine Distanz zur unterdrückenden Autorität zu schaffen und die eigene Würde zu bewahren. Es wird eine Parallele zu Michel de Certeaus Werk "Kunst des Handelns" gezogen, um die Coolness als eine Form des Widerstands gegen dominante Systeme zu interpretieren.
Häufig gestellte Fragen zum Text: "Cool" als universales Abgrenzungsattribut
Was ist das zentrale Thema des Textes?
Der Text untersucht die Bedeutung des Begriffs "cool" in der modernen Gesellschaft. Er analysiert seine Ambivalenz als Abgrenzungsattribut und Verhaltensweise, beleuchtet seine Entwicklung als gesellschaftliches Leitbild und betrachtet kritisch seine weitverbreitete Verwendung in der Alltagssprache.
Welche Aspekte von "cool" werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Ambivalenz von "cool" als Abgrenzungsmerkmal und Verhaltensmuster, den Wandel des Begriffs im Laufe der Zeit, Coolness als Überlebensstrategie marginalisierter Gruppen, die Entwicklung von Coolness zum gesellschaftlichen Leitbild und eine kritische Betrachtung der Coolness als gesellschaftliches Phänomen.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit beschreibt. Es folgen Kapitel, die "cool" als Abgrenzungsattribut analysieren, den Wandel des Begriffs im Zeitverlauf untersuchen und die Coolness als Überlebensstrategie und gesellschaftliches Leitbild beleuchten. Ein Fazit schließt die Arbeit ab.
Was wird im Kapitel "Cool als universales Abgrenzungsattribut" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert den inflationären Gebrauch von "cool" im Deutschen, beschreibt es als universell einsetzbare Vokabel zur Zustimmung und als Abgrenzungsattribut, betont den Mangel an präziser Definition und die individuelle Interpretation. Der Aufstieg von "cool" wird mit seiner Verwendung in Jugend- und Subkulturen und dessen Ausbreitung auf alle Gesellschaftsschichten in Verbindung gebracht.
Was ist der Fokus des Kapitels "Der Habitus des Cool im Wandel der Zeit"?
Dieses Kapitel untersucht Coolness als "habitualisierte Technik des Sich-Entziehens" und beleuchtet seine historische Entwicklung, vor allem im letzten Jahrhundert. Es analysiert die Entwicklung von Coolness vom Habitus der Unterdrückten zum gesellschaftlichen Leitbild und dessen kritische Aspekte. Es verweist auch auf die antike Philosophie, insbesondere die stoische Apatheia, als Vorläufer.
Wie wird Coolness im Abschnitt "Coolness als Überlebensstrategie" betrachtet?
Dieser Abschnitt betrachtet Coolness als Überlebensstrategie marginalisierter Gruppen. Emotionale Distanz und Gleichgültigkeit werden als Mechanismen zur Schaffung von Distanz zu unterdrückender Autorität und zur Bewahrung der eigenen Würde dargestellt. Eine Parallele zu Michel de Certeaus "Kunst des Handelns" wird gezogen, um Coolness als Widerstand gegen dominante Systeme zu interpretieren.
Welche Schlussfolgerung zieht der Text?
Der Text fasst die Ergebnisse seiner Analyse von "cool" als vielschichtiges und ambivalenten Begriff zusammen, der sich im Laufe der Zeit gewandelt und seine Bedeutung in der modernen Gesellschaft erlangt hat. Er verdeutlicht sowohl die positive als auch die negative Ausprägung von Coolness.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2009, Was ist Cool?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150698