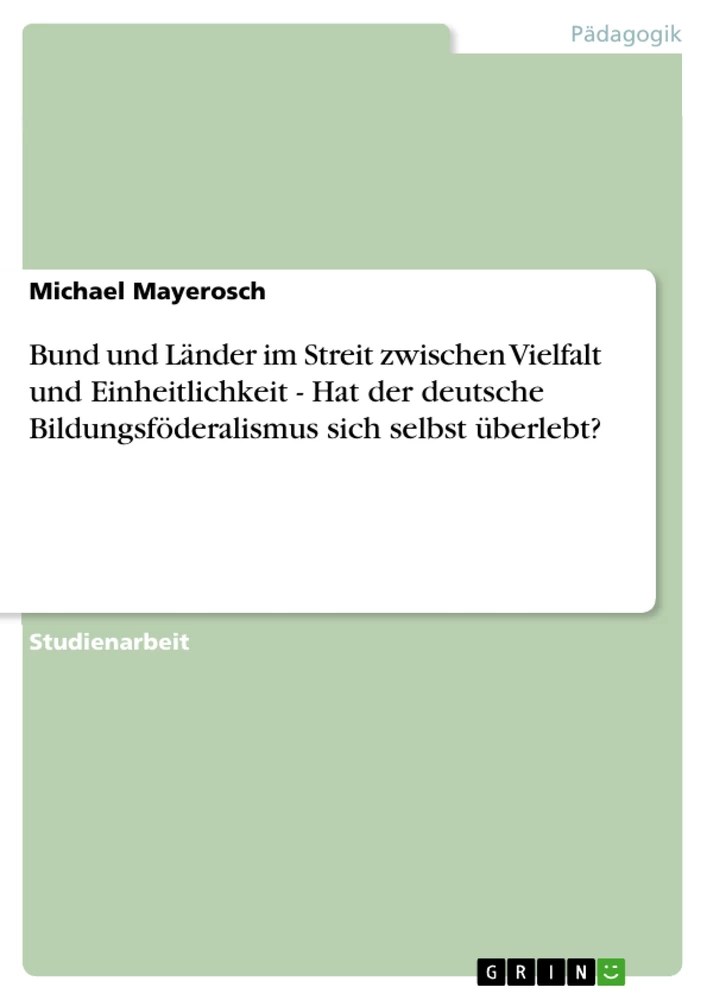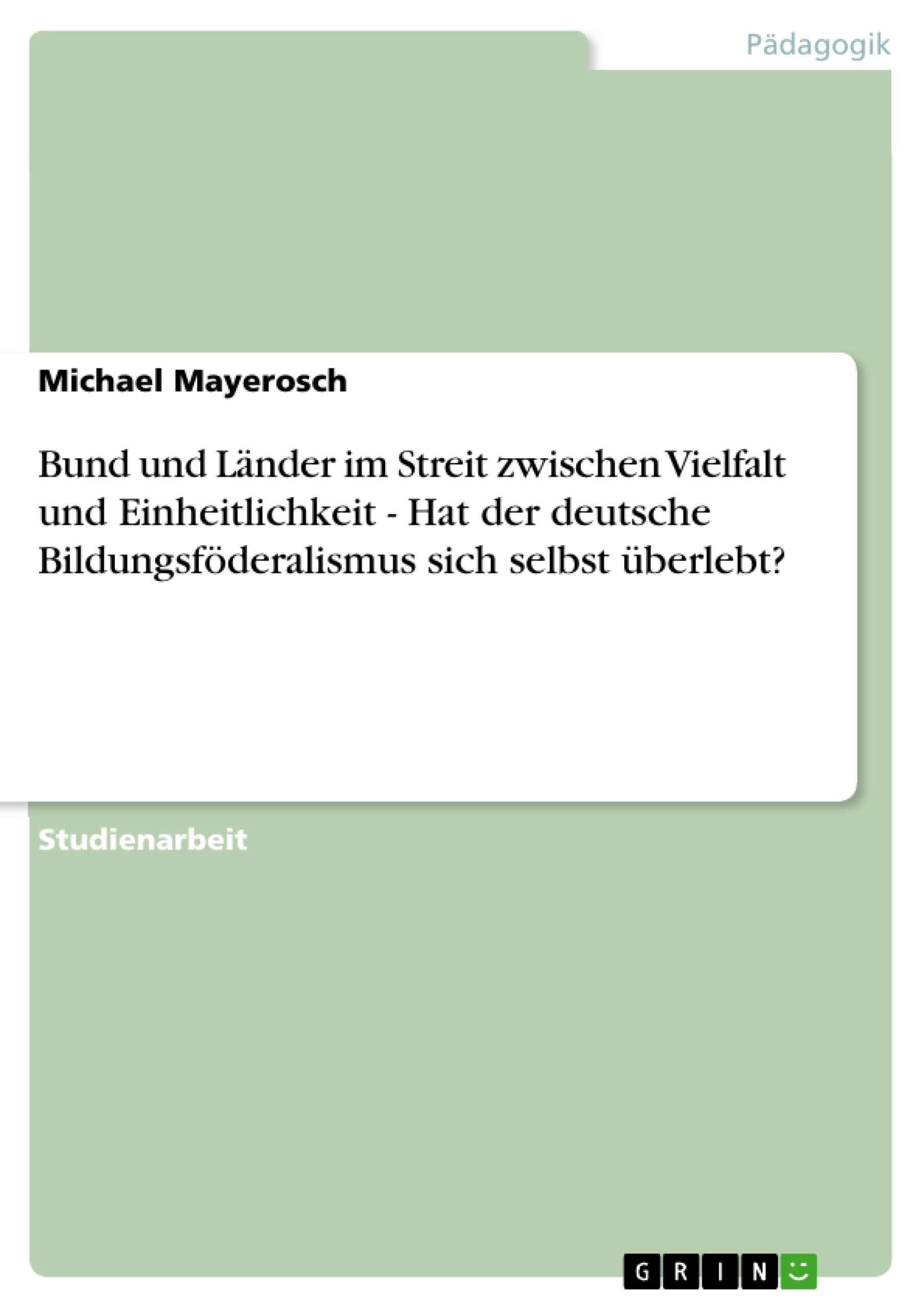Bezogen auf das deutsche Bildungssystem mit seinem föderalen Aufbau muss die Frage gestattet sein, warum genau dort, wo Bund und Länder die Möglichkeit haben, auf die Qualität und Quantität folgender Generationen von Human Ressources einzuwirken, sich die Umsetzung von Aspekten der Gleichheit und Gleichberechtigung so schwierig gestaltet. Andersherum stellt sich natürlich ebenfalls die Frage wo diese allgemeinen Grundrechte nun genau verletzt werden?
Kritiker behaupten, in einem zentralstaatlich gelenkten Bildungssystem hätten Fälle wie die ungleiche Anerkennung von Abiturzeugnissen (bspw. in Bayern) oder landesstaatlich verschiedene Mindestvoraussetzungen zum Erwerb des Abiturs nicht vorkommen können.
Bekanntermaßen gibt es aber Kritiker für Alles und Jeden, doch eben gerade beim Bildungsföderalismus ist die Frage nach dem Sinn oder Unsinn und die ständige Diskussionen über eine weitreichende Änderung des bestehenden Systems seit Jahrzehnten immanent. Seine Vorzüge stellen sich in der Argumentation eigentlich als sinnvoll und logisch dar und doch wurde bzw. wird immer wieder die Frage gestellt: Hat sich der Bildungsföderalismus selbst überlebt?
Um diese Frage zu klären muss man zuerst einen Blick auf die Strukturen der einzelnen Organisations- und Entscheidungsebenen von Bund und Ländern werfen. Der Fokus wird hierbei klar in der Verteilung der Kompetenzen, in den Mitteln zur Steuerung der Bildungspolitik und den -trotz weitreichender Autonomie der Länder- bestehenden Möglichkeiten der Kooperation zwischen bundes- und landesstaatlicher Ebene liegen. Diese grundsätzliche föderale Autonomie der Länder ist im Grundgesetz festgeschrieben und daher auch nicht Gegenstand dieser Arbeit. Die Möglichkeit auf weiten Teilen allein und bundesstaatlich unabhängig zu entscheiden, hat seit jeher hohe kulturelle Bedeutung, wenngleich diese in Diskussionen oftmals hinter die nicht zu verleugnenden Nachteile landeshoheitlicher Bildungsentscheidungen gestellt wird. Kapitel drei wird sich daher diesen Chancen und Kritikpunkten widmen. Dazu werden die Vorteile von Vielfalt und Wettbewerb ebenso berücksichtigt wie das notwendige Gebot auf dem gesamten Bundesgebiet einheitliche Grundstrukturen zu gewährleisten.
Dieser zugegebener Maßen komplizierte Drahtseilakt wurde bisher von den beteiligten politischen Akteuren weitestgehend vermieden, weshalb diese Arbeit zu einem gewissen Anteil als Kritik an der gängigen Praxis im deutschen Bildungssystem verstanden werden darf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überblick über die föderalen Ebenen deutscher Bildungspolitik
- Kompetenzen der Länder
- Kompetenzen des Bundes
- Koordinierung und Kooperationspartner
- Vorteile und Kritik am föderalistischen Bildungssystem in Zeiten schneller gesellschaftlicher Wandlungsprozesse
- Kulturhoheit als Chance eigenstaatlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Kompetenzverteilung und mangelnde Transparenz
- Gleichheit, Leistungsfähigkeit und geringer Wettbewerb
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem deutschen Bildungssystem und dessen föderalem Aufbau. Sie untersucht die Verteilung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern und analysiert die Vor- und Nachteile des föderalen Systems im Kontext der Herausforderungen der modernen Gesellschaft.
- Die Verteilung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern im Bildungswesen
- Die Auswirkungen des föderalen Systems auf die Qualität und Gleichheit der Bildung
- Die Rolle der Kulturhoheit der Länder im Bildungssystem
- Die Möglichkeiten und Grenzen der Kooperation zwischen Bund und Ländern im Bildungsbereich
- Die Herausforderungen des föderalen Bildungssystems in Zeiten schneller gesellschaftlicher Wandlungsprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des föderalen Bildungssystems in Deutschland dar und führt in die Thematik ein. Kapitel 2 gibt einen Überblick über die föderalen Ebenen der deutschen Bildungspolitik und die Kompetenzen von Bund und Ländern. Kapitel 3 beleuchtet die Vorteile und Nachteile des föderalen Bildungssystems in Zeiten schneller gesellschaftlicher Wandlungsprozesse.
Schlüsselwörter
Föderalismus, Bildungssystem, Kompetenzen, Länder, Bund, Kulturhoheit, Gleichheit, Leistungsfähigkeit, Wettbewerb, gesellschaftliche Wandlungsprozesse, Bildungspolitik.
- Quote paper
- Michael Mayerosch (Author), 2009, Bund und Länder im Streit zwischen Vielfalt und Einheitlichkeit - Hat der deutsche Bildungsföderalismus sich selbst überlebt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150486