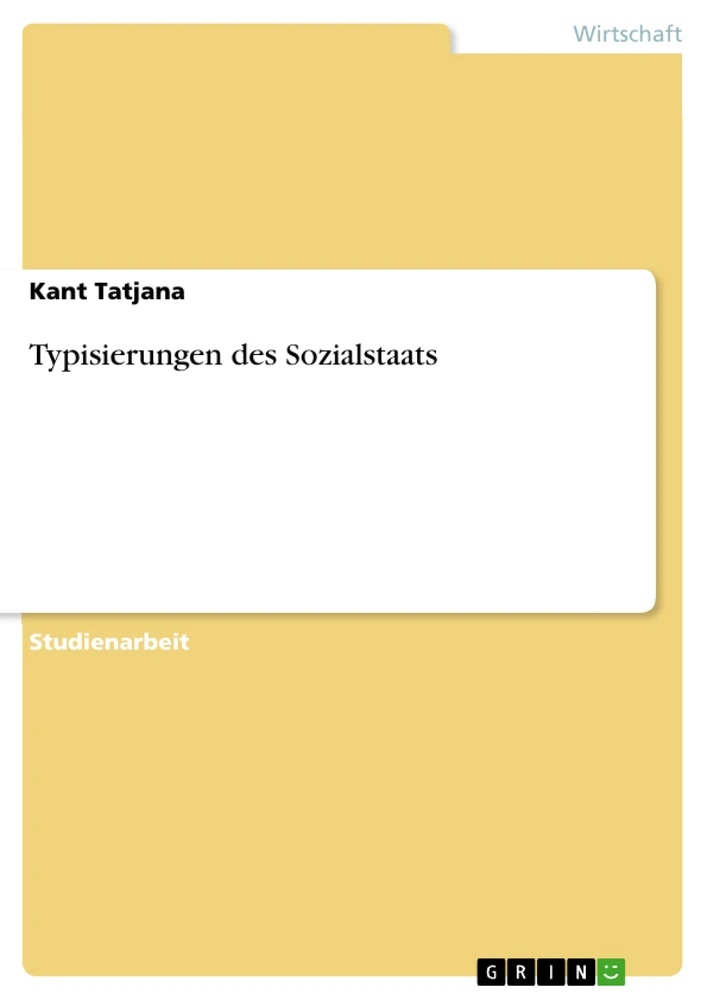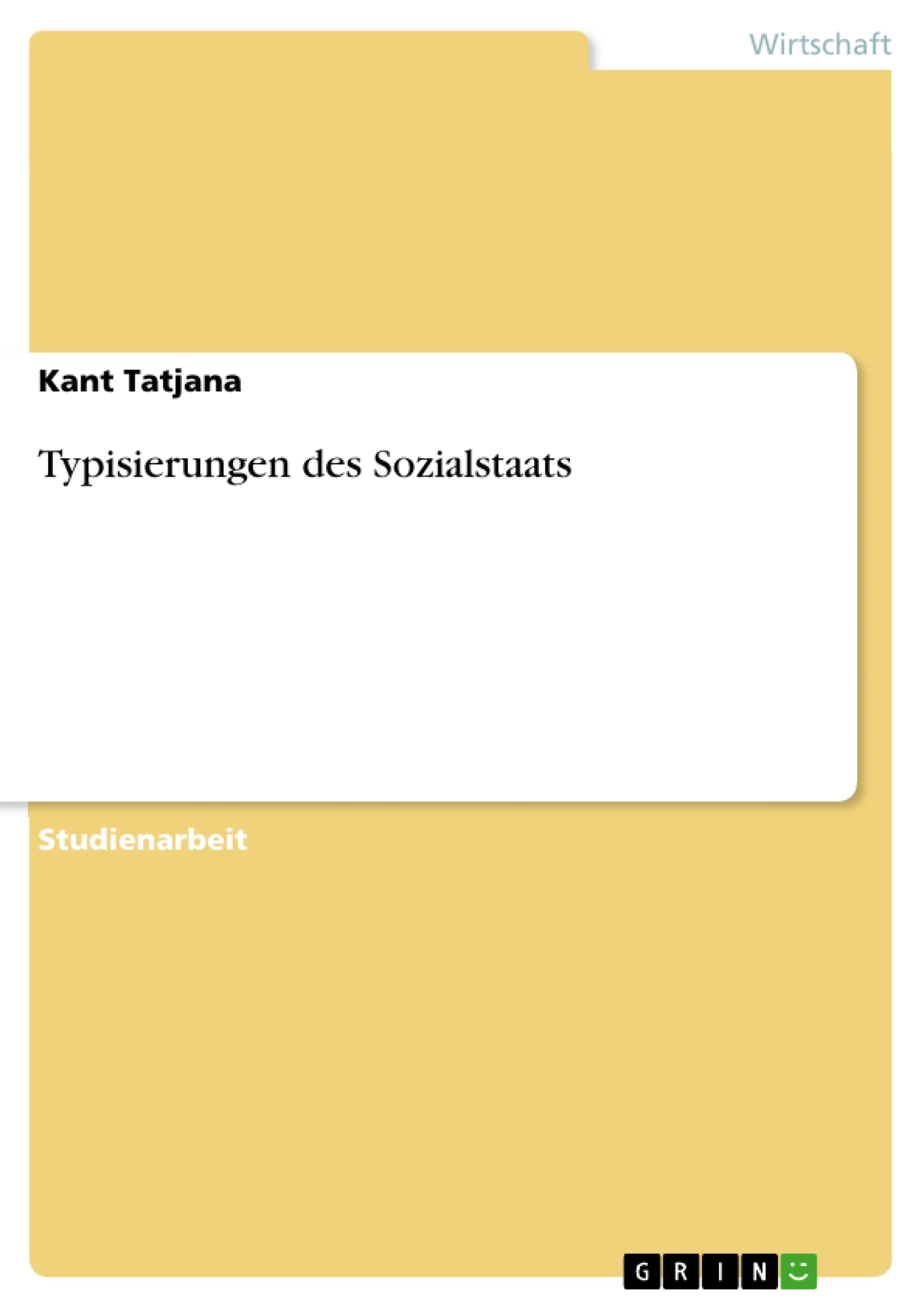1. Einleitung
„Ich will mich aus eigener Kraft bewähren, ich will das Risiko selbst tragen, will für mein Schicksal selbst verantwortlich sein. Sorge du,Staat, dafür, dass ich dazu in der Lage bin.“ (Ludwig Erhard,1957).
Diese Anforderung, wie sie Ludwig Erhard formuliert hat, stellt einen Staat vor eine große Herausforderung. Im Laufe der Zeit und insbesondere der unterschiedlichen politischen Entwicklungen und der damit verbundenen Gestaltung der Sozialversicherungen in den verschiedenen Ländern, haben sich um dieser Forderung nachzukommen, verschiedenste Systeme der sozialen Sicherung entwickelt. Je nach Zielsetzung des jeweiligen Staates können die Charakteristika eines Sozialstaats stark oder auch weniger stark ausgeprägt sein und von Land zu Land stark variieren. Die Frage die daher aufkommt ist zunächst jene nach den Möglichkeiten einer
aussagekräftigen Typisierung einzelner Wohlfahrtsstaaten, sowie auch den Ausgestaltungsmöglichkeiten der einzelnen Typen in der Realität.
In der vorliegenden Arbeit sollen daher zunächst verschiedene Sozialstaatsmodelle, wie sie der dänische Politikwissenschaftler und Soziologe, Gøsta Esping-Andersens formuliert hat, erläutert werden. Des Weiteren wird ein internationaler Vergleich zwischen Deutschland, England und Schweden bezüglich der Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung sowie der Rentenversicherung
durchgeführt.
2. Begriffsdefinition: Sozialstaat
Für den in der Literatur häufig beschriebenen Sozialstaat wird oft der Terminus „Wohlfahrtsstaat“ verwendet. Dabei handelt es sich aus international vergleichender Sicht
...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinition: Sozialstaat
- 3. Varianten des Wohlfahrtsstaats
- 3.1 Hintergründe der Typisierungen nach Esping-Andersen.
- 3.1.1 De-Kommodifizierung
- 3.1.2 Stratifizierung
- 3.2 Typologien des Wohlfahrtsstaats nach Esping-Andersen
- 3.2.1 Der liberale Wohlfahrtsstaat
- 3.2.2 Der konservative Wohlfahrtsstaat
- 3.2.3 Der sozialdemokratische Wohlfahrtsstaat
- 3.3 Reale Wohlfahrtsstaatstypen
- 3.2.1 Der liberale Wohlfahrtsstaat am Beispiel Englands
- 3.2.2 Der konservative Wohlfahrtsstaat am Beispiel Deutschlands
- 3.2.3 Der sozialdemokratische Wohlfahrtsstaat am Beispiel Schwedens
- 3.4 Der rudimentäre Wohlfahrtsstaat
- 3.1 Hintergründe der Typisierungen nach Esping-Andersen.
- 4 Der Sozialstaat im internationalen Vergleich nach Bereichen
- 4.2 Arbeitslosenversicherung
- 4.3 Krankenversicherung
- 4.4 Rentenversicherung
- 5 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Modelle des Wohlfahrtsstaates, insbesondere die Typologie nach Esping-Andersen. Ziel ist es, die Charakteristika verschiedener Wohlfahrtsstaatsmodelle zu erläutern und einen internationalen Vergleich anhand von Deutschland, England und Schweden durchzuführen, wobei die Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversicherung im Fokus stehen.
- Typologie des Wohlfahrtsstaats nach Esping-Andersen
- De-Kommodifizierung und Stratifizierung als zentrale Kriterien
- Internationaler Vergleich der Sozialversicherungssysteme
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten liberaler, konservativer und sozialdemokratischer Modelle
- Reale Wohlfahrtsstaatstypen im Vergleich zu theoretischen Modellen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der Typisierung von Wohlfahrtsstaaten und deren Ausgestaltung in der Realität. Sie führt in die Thematik ein, indem sie Ludwig Erhards Forderung nach Eigenverantwortung im Kontext unterschiedlicher politischer Entwicklungen und sozialer Sicherungssysteme diskutiert. Die Arbeit kündigt die Erläuterung verschiedener Sozialstaatsmodelle nach Esping-Andersen und einen internationalen Vergleich zwischen Deutschland, England und Schweden an, fokussiert auf Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversicherung.
2. Begriffsdefinition: Sozialstaat: Dieses Kapitel klärt den Begriff "Wohlfahrtsstaat" und differenziert ihn vom Begriff "Sozialstaat". Es basiert auf der Definition von Harry Girvetz, die den Wohlfahrtsstaat als institutionellen Ausdruck der gesellschaftlichen Verantwortung für das Wohlergehen seiner Mitglieder beschreibt. Zusätzliche Aspekte der Definition, wie die Zielsetzung eines Wohlfahrtsstaates, werden beleuchtet. Hier werden Ziele wie die Hilfe gegen Not und Armut, die Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums, der Abbau von Wohlstandsdifferenzen und die Gewährung von Sicherheit gegenüber Lebensrisiken thematisiert.
3. Varianten des Wohlfahrtsstaats: Dieses Kapitel befasst sich mit der Typisierung von Wohlfahrtsstaaten, basierend auf Esping-Andersens Arbeit. Es beleuchtet die Hintergründe seiner Typologie, ausgehend von Titmuss' drei Wohlfahrtsstaatsmodellen (residual, leistungsbasiert, institutionell). Die zentralen Kriterien von Esping-Andersen – Dekommodifizierung und Stratifizierung – werden ausführlich erklärt, und es werden die drei Wohlfahrtsstaatstypen (liberal, konservativ, sozialdemokratisch) vorgestellt. Die Kapitel erläutert, dass diese Typen theoretische Konstrukte sind, die reale Systeme nur annähern.
Schlüsselwörter
Wohlfahrtsstaat, Sozialstaat, Esping-Andersen, Typologie, Dekommodifizierung, Stratifizierung, liberaler Wohlfahrtsstaat, konservativer Wohlfahrtsstaat, sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung, internationaler Vergleich, Deutschland, England, Schweden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Varianten des Wohlfahrtsstaats
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Modelle des Wohlfahrtsstaats, insbesondere die Typologie nach Esping-Andersen. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf einem internationalen Vergleich der Sozialversicherungssysteme (Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversicherung) in Deutschland, England und Schweden.
Welche Modelle des Wohlfahrtsstaats werden behandelt?
Der Text behandelt vor allem die Typologie des Wohlfahrtsstaats nach Esping-Andersen, die drei Haupttypen: den liberalen, den konservativen und den sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat. Zusätzlich wird ein rudimentärer Wohlfahrtsstaat erwähnt. Die Charakteristika dieser Modelle werden erläutert und anhand von Beispielen (England, Deutschland, Schweden) veranschaulicht.
Welche Kriterien verwendet Esping-Andersen für seine Typologie?
Esping-Andersen verwendet die Kriterien "Dekommodifizierung" und "Stratifizierung". Dekommodifizierung beschreibt den Grad, in dem die soziale Versorgung unabhängig vom Marktgeschehen ist. Stratifizierung bezieht sich auf den Einfluss des Wohlfahrtsstaates auf die soziale Schichtung.
Wie werden die verschiedenen Wohlfahrtsstaatsmodelle im internationalen Vergleich dargestellt?
Der internationale Vergleich konzentriert sich auf Deutschland, England und Schweden. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der drei Modelle werden anhand der Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversicherungssysteme analysiert, um die realen Systeme mit den theoretischen Modellen von Esping-Andersen zu vergleichen.
Was sind die Zielsetzung und Themenschwerpunkte des Textes?
Die Zielsetzung ist die Erläuterung der Charakteristika verschiedener Wohlfahrtsstaatsmodelle und ein internationaler Vergleich anhand von Deutschland, England und Schweden, wobei die Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversicherung im Fokus stehen. Die Themenschwerpunkte umfassen die Typologie nach Esping-Andersen, die Kriterien Dekommodifizierung und Stratifizierung, sowie den internationalen Vergleich der Sozialversicherungssysteme.
Wie wird der Begriff "Wohlfahrtsstaat" definiert?
Der Text definiert den Wohlfahrtsstaat basierend auf Harry Girvetz, der ihn als institutionellen Ausdruck der gesellschaftlichen Verantwortung für das Wohlergehen seiner Mitglieder beschreibt. Zusätzliche Aspekte wie die Bekämpfung von Armut, die Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums und die Bereitstellung von Sicherheit gegenüber Lebensrisiken werden ebenfalls thematisiert. Der Unterschied zum Begriff "Sozialstaat" wird ebenfalls geklärt.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffsdefinition: Sozialstaat, Varianten des Wohlfahrtsstaats (inkl. Unterkapiteln zu den Typologien nach Esping-Andersen und realen Beispielen), Der Sozialstaat im internationalen Vergleich nach Bereichen (Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversicherung) und Schlussbetrachtung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Schlüsselwörter sind: Wohlfahrtsstaat, Sozialstaat, Esping-Andersen, Typologie, Dekommodifizierung, Stratifizierung, liberaler Wohlfahrtsstaat, konservativer Wohlfahrtsstaat, sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung, internationaler Vergleich, Deutschland, England, Schweden.
- Citation du texte
- Kant Tatjana (Auteur), 2010, Typisierungen des Sozialstaats, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150447