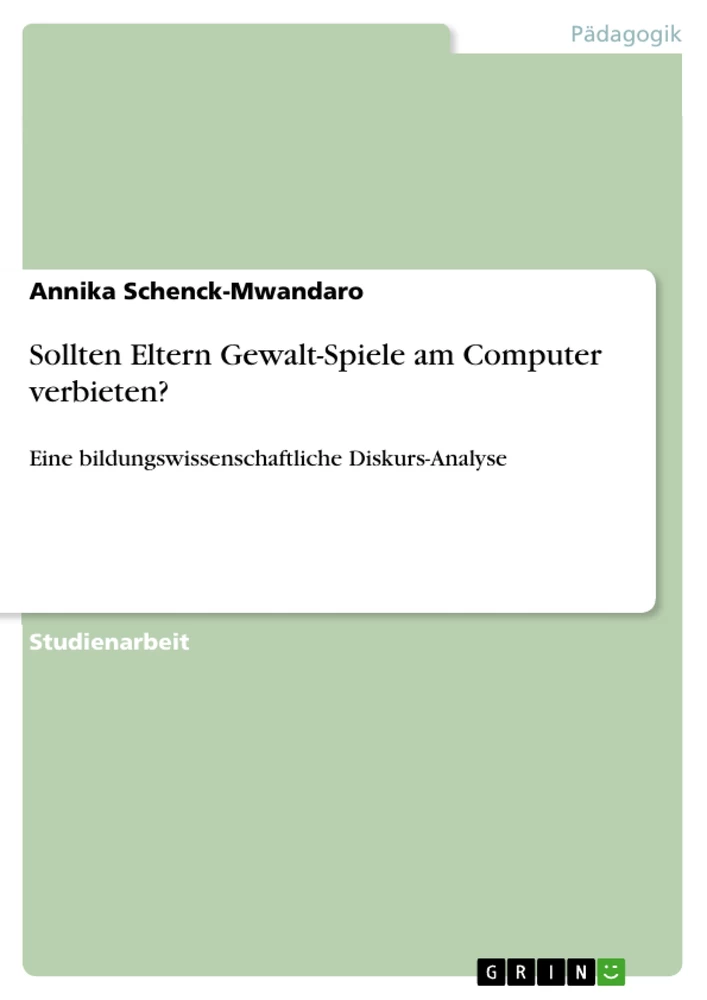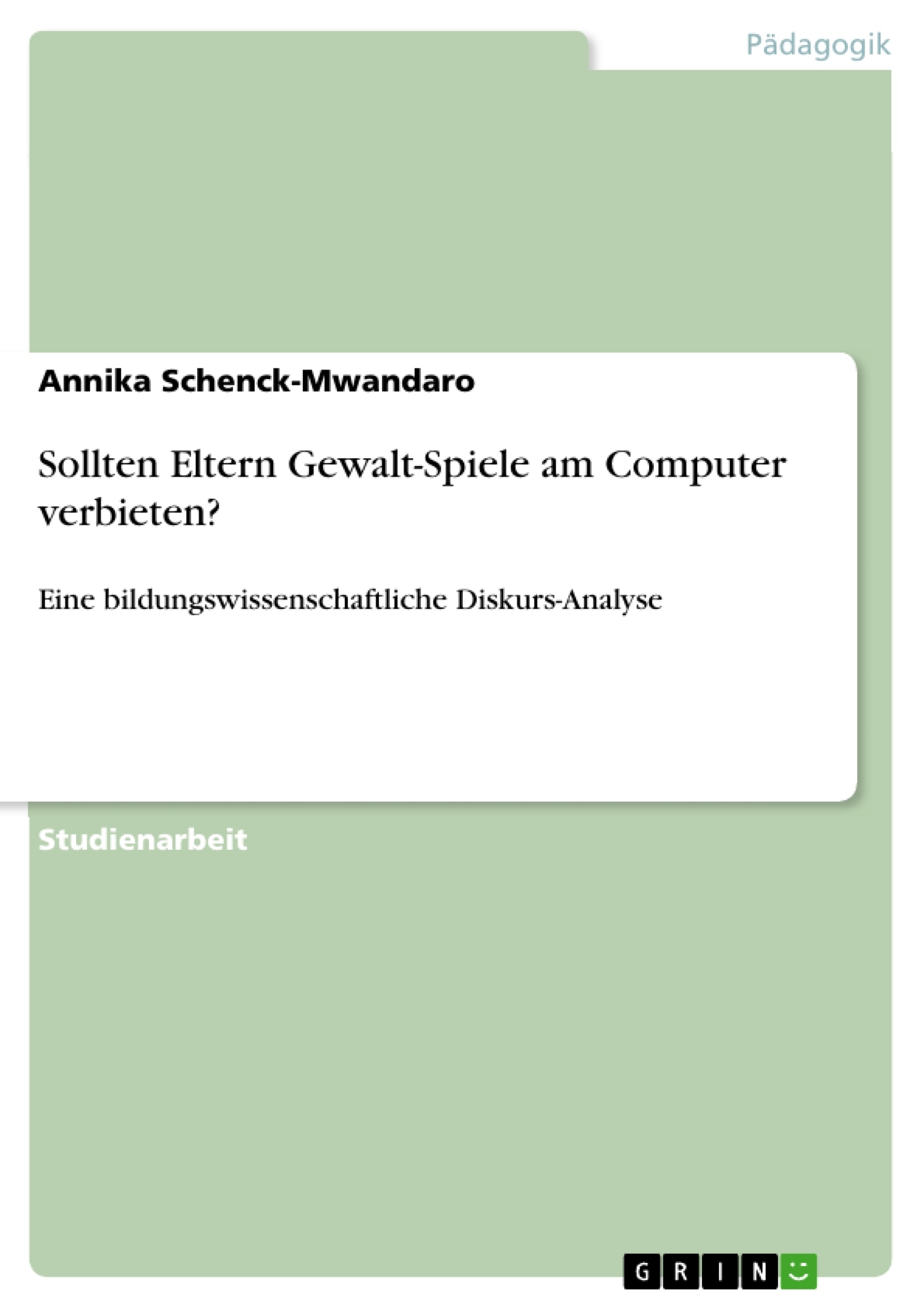Am unteren Rand des Bildschirms ragt der Lauf eines Maschinengewehres, mit hektischen Bewegungen wird die unheimliche und düstere Umgebung abgesucht. Plötzlich springt aus der Ecke ein grässliches Monster, welches sich sofort durch drei gezielte Schüsse in eine blutig spritzende Masse verwandelt.
Solche und ähnliche Szenen aus den sogenannten „Killerspielen“ lösen bei vielen Eltern und Erziehern Besorgnisse aus. Besonders nach den tragischen Amokläufen und der vermeintlichen Zunahme von Gewalt bei Kindern und Jugendlichen stellen sich viele Eltern die Frage, inwieweit die Beschäftigung mit solchen Spielen schädliche Auswirkungen auf die Entwicklung ihrer Kinder haben könnte und sind unsicher, ob sie ihren Kindern solche Spiele generell untersagen sollten. Die unterschiedlichen Ratgeber vertreten ihre jeweilige Meinung noch vehementer als jeder Politiker und stiften eher Verwirrung als dass sie eine wertvolle Hilfestellung geben.
Und so saß auch ich neben meinem sechsjährigen Nintendo-Wii-spielendem Sohn und fragte mich, ob es für seine Entwicklung schädlich sei, wenn er zunächst nur lustig irgendwelche Luftballons und Dosen abballerte, um dann später auch auf Aliens loszugehen? Als besorgte Mutter stellt sich dann die Frage, ob man selber ein wenig übertrieben ängstlich reagiert oder ob an den Befürchtungen etwas dran sein könnte. Vor allem wenn man selber der Generation angehört, denen immer eingetrichtert worden ist, dass jegliche Ausübung von Gewalt ein Tabu sei. Und auch ich gehörte bisher zu denen, die mit einem mulmigen Gefühl zusah, wenn ihre Kinder im Spaß mit Pistolen um sich schießen. Auch weigerte ich mich bisher strikt, irgendwelche waffenähnlichen Spielzeuge zu kaufen.
Um diesem Problem also auf den Grund zu gehen, beschloss ich, mich im Rahmen dieser Hausarbeit damit eingehend zu beschäftigen. Eventuell werde ich oder auch der Leser dieser Hausarbeit eines besseren belehrt oder auch in den Befürchtungen bestätigt.
In der vorliegenden Hausarbeit wird zunächst auf die Unsicherheit der Eltern eingegangen bezüglich ihres Verhaltens im Umgang mit gewalthaltigen Computerspielen. Im darauffolgenden Kapitel wird die Argumentation der Spiele-Befürworter vorgestellt, wobei zunächst auf deren Kernaussagen eingegangen wird. Zur Vertiefung werden die zugrundeliegenden Theorien erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Der Umgang mit „Killerspielen“ – Eine schwierige Erziehungsaufgabe
- 3 Pro-Argumentation: „Kinder müssen Aggressionen spielerisch ausüben.“
- 3.1 Kernaussagen
- 3.2 Theorien
- 4 Contra-Argumentation: „Gewaltspiele erhöhen die Gewaltbereitschaft.“
- 4.1 Kernaussagen
- 4.2 Theorien
- 5 Computerspiele als Sündenbock gesellschaftlicher und struktureller Probleme
- 6 Lösungsansätze
- 6.1 Können Verbote eine Lösung sein?
- 6.2 Medienkompetenz als Arbeitsfeld der Medienpädagogik
- 6.3 Medienkompetenz als Bildungs- und Erziehungsaufgabe
- 6.4 Medienkompetenz als gesellschaftliche Aufgabe
- 7 Zusammenfassung
- 8 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die elterliche Unsicherheit im Umgang mit gewalthaltigen Computerspielen ("Killerspielen"). Ziel ist es, die unterschiedlichen Argumentationslinien (Pro und Contra) zu beleuchten und Lösungsansätze zu diskutieren. Die Arbeit betrachtet dabei die gesellschaftlichen und pädagogischen Aspekte des Themas.
- Elterliche Unsicherheit im Umgang mit gewalthaltigen Computerspielen
- Pro- und Contra-Argumente zur Wirkung von Gewaltspielen auf Kinder
- Computerspiele als Sündenbock gesellschaftlicher Probleme
- Möglichkeiten der Medienkompetenzförderung
- Relevanz von Verboten im Umgang mit Computerspielen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Ausgangssituation: Eltern sind verunsichert über den Einfluss von "Killerspielen" auf ihre Kinder. Die Autorin schildert ihre eigene Unsicherheit und begründet die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit dem Thema. Sie skizziert den Aufbau der Hausarbeit und die behandelten Aspekte.
2 Der Umgang mit „Killerspielen“ – Eine schwierige Erziehungsaufgabe: Dieses Kapitel beschreibt die allgemeine Verunsicherung von Eltern beim Umgang mit gewalthaltigen Computerspielen. Es werden die gegensätzlichen Positionen von Computerkritikern und -befürwortern dargestellt, die oft zu widersprüchlichen Ratschlägen in der Ratgeberliteratur führen. Die Autorin beleuchtet die ambivalente Darstellung von Computerspielen in Medien und die oft mangelnde Medienkompetenz der Eltern, die zu vorschnellen Verboten oder fehlendem Regelwerk führt.
3 Pro-Argumentation: „Kinder müssen Aggressionen spielerisch ausüben.“: Dieses Kapitel präsentiert die Argumente der Befürworter von Gewaltspielen. Es wird die These vertreten, dass die gesellschaftliche Tabuisierung von Gewalt dazu führt, dass Kinder keine Möglichkeit haben, Aggressionen spielerisch zu verarbeiten. Früher akzeptierte Formen der Auseinandersetzung werden heute als Gewalt interpretiert. Das Kapitel argumentiert, dass Gewalt und Aggression zum menschlichen Leben gehören und spielerische Ausdrucksformen wichtig sein können.
4 Contra-Argumentation: „Gewaltspiele erhöhen die Gewaltbereitschaft.“: Hier werden die Gegenargumente präsentiert. Die Kritiker argumentieren, dass Gewaltspiele die Gewaltbereitschaft von Kindern erhöhen und schädliche Auswirkungen auf deren Entwicklung haben können. Es wird auf die potenziellen negativen Einflüsse von Gewaltdarstellungen auf die Psyche eingegangen. Die Kapitel beleuchtet vermutlich Theorien, die diese Argumentation stützen.
5 Computerspiele als Sündenbock gesellschaftlicher und struktureller Probleme: Dieses Kapitel analysiert die Tendenz, Computerspiele als Sündenbock für gesellschaftliche und strukturelle Probleme heranzuziehen. Es wird argumentiert, dass die Probleme, die oft Computerspielen zugeschrieben werden (wie Aggression oder Gewalt), komplexere Ursachen haben, die nicht allein auf die Spiele zurückzuführen sind.
6 Lösungsansätze: Das Kapitel diskutiert verschiedene Lösungsansätze für den Umgang mit gewalthaltigen Computerspielen. Es wird die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Verboten behandelt und die Bedeutung von Medienkompetenz als pädagogische, erzieherische und gesellschaftliche Aufgabe hervorgehoben. Das Kapitel erörtert verschiedene Strategien zur Förderung der Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen.
Schlüsselwörter
Killerspiele, Gewaltspiele, Computerspiele, Medienkompetenz, Eltern, Erziehung, Bildung, Aggression, Gewalt, Medienpädagogik, gesellschaftliche Verantwortung, Verbote, Diskussionsanalyse.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Der Umgang mit „Killerspielen“
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert die elterliche Unsicherheit im Umgang mit gewalthaltigen Computerspielen ("Killerspielen"). Sie beleuchtet die Pro- und Contra-Argumente zur Wirkung dieser Spiele auf Kinder und diskutiert mögliche Lösungsansätze unter Berücksichtigung gesellschaftlicher und pädagogischer Aspekte.
Welche Aspekte werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: elterliche Unsicherheit im Umgang mit gewalthaltigen Computerspielen, Pro- und Contra-Argumente zur Wirkung von Gewaltspielen auf Kinder, Computerspiele als Sündenbock gesellschaftlicher Probleme, Möglichkeiten der Medienkompetenzförderung und die Relevanz von Verboten im Umgang mit Computerspielen.
Welche Argumentationslinien werden dargestellt?
Die Hausarbeit präsentiert sowohl die Pro-Argumentation ("Kinder müssen Aggressionen spielerisch ausüben") als auch die Contra-Argumentation ("Gewaltspiele erhöhen die Gewaltbereitschaft"). Dabei werden jeweils Kernaussagen und zugrundeliegende Theorien beleuchtet.
Wie wird der Aspekt der Medienkompetenz behandelt?
Die Förderung der Medienkompetenz wird als zentraler Lösungsansatz dargestellt. Die Hausarbeit betrachtet Medienkompetenz als Arbeitsfeld der Medienpädagogik, als Bildungs- und Erziehungsaufgabe sowie als gesellschaftliche Aufgabe. Es werden Strategien zur Förderung der Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen diskutiert.
Welche Rolle spielen Verbote im Umgang mit Computerspielen?
Die Sinnhaftigkeit von Verboten im Umgang mit Computerspielen wird kritisch hinterfragt und im Kontext weiterer Lösungsansätze diskutiert. Die Hausarbeit geht der Frage nach, ob Verbote allein eine Lösung darstellen können.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Der Umgang mit „Killerspielen“, Pro-Argumentation, Contra-Argumentation, Computerspiele als Sündenbock, Lösungsansätze, Zusammenfassung und Fazit. Jedes Kapitel fasst die wichtigsten Punkte zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Killerspiele, Gewaltspiele, Computerspiele, Medienkompetenz, Eltern, Erziehung, Bildung, Aggression, Gewalt, Medienpädagogik, gesellschaftliche Verantwortung, Verbote, Diskussionsanalyse.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Zielsetzung der Hausarbeit ist es, die elterliche Unsicherheit im Umgang mit gewalthaltigen Computerspielen zu analysieren, die unterschiedlichen Argumentationslinien zu beleuchten und Lösungsansätze zu diskutieren. Der Fokus liegt auf den gesellschaftlichen und pädagogischen Aspekten des Themas.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Hausarbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, die die zentralen Inhalte und Argumentationslinien jedes Abschnitts beschreibt.
- Quote paper
- Annika Schenck-Mwandaro (Author), 2010, Sollten Eltern Gewalt-Spiele am Computer verbieten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150416