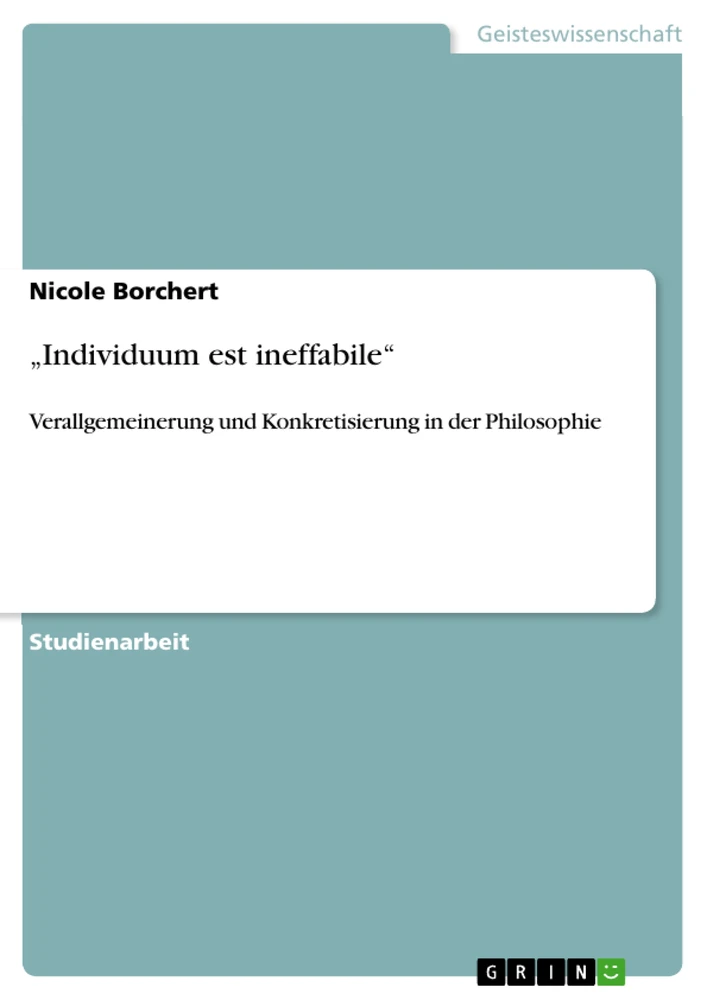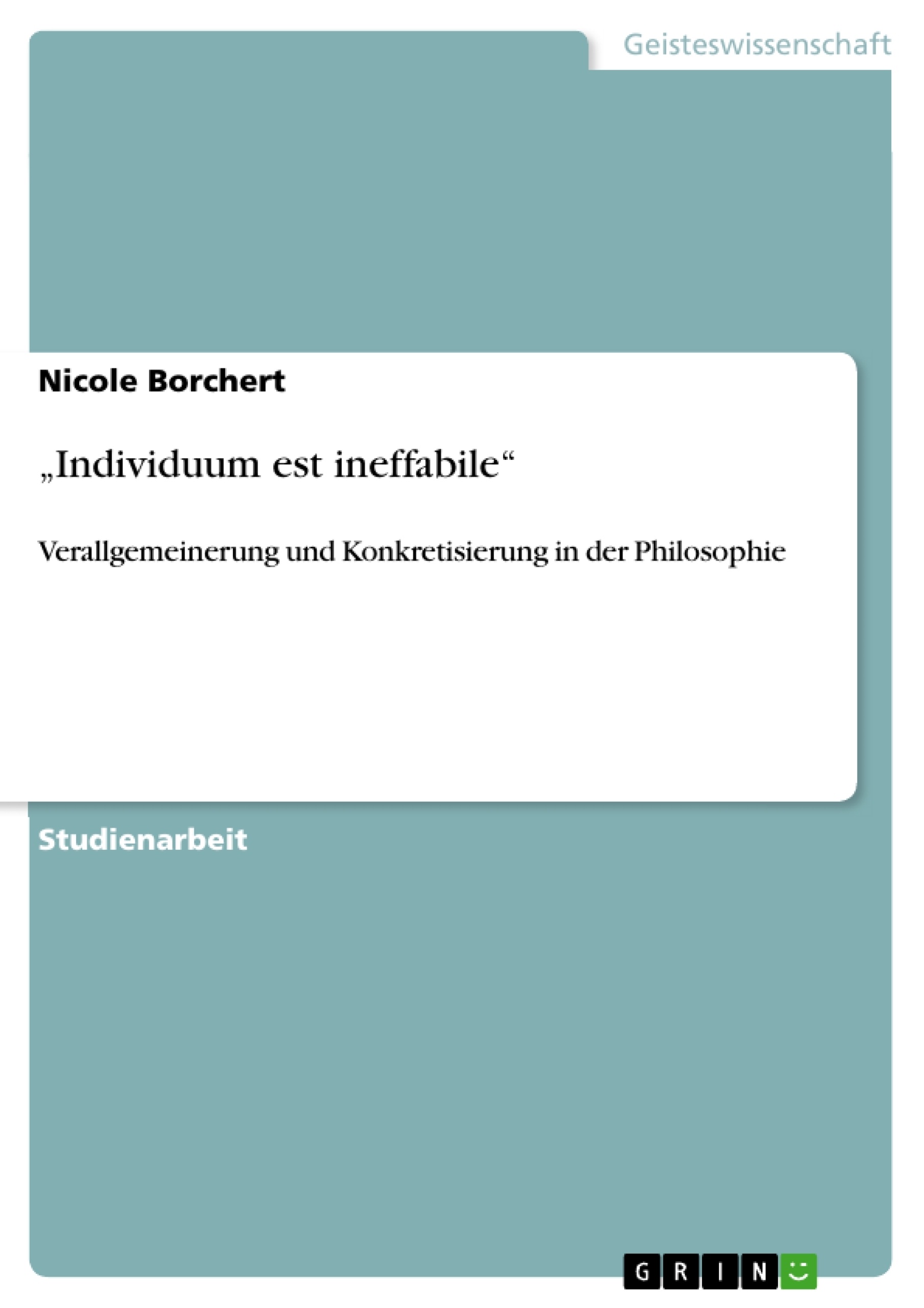Eines der Grundprobleme der Philosophie stellt seit je her das Verhältnis zum konkreten Leben dar. Die Schwierigkeit besteht zunächst im Bestreben der philosophischen Disziplin, die menschliche Existenz zu erfassen. Um dies zu ermöglichen, müsste sich der Philosoph allerdings gemäß Fichte aus der „Befangenheit des Lebens“ lösen.
Die subjektive Befangenheit verhindert eine wirkliche, objektive Erkenntnis. Die einzige annehmbare Möglichkeit für dieses Problem ist demnach, sich durch Reflexion ein Stück weit aus dieser natur-gemäßen Befangenheit zu lösen, um Abstand zum Gegenstand der Erkenntnis zu gewinnen. Da man sich jedoch niemals völlig distanzierten kann und auch als Philosoph selbst in der eigenen Existenz verhaften bleibt, ist das Resultat solcher Bemühungen im besten Falle Spekulation.
Im Anschluss daran stellt sich die Frage, wie die Philosophie überhaupt das Leben und die menschliche Existenz erfassen kann. Der Bezug zwischen Philosophie und Leben gilt als eines der bedeutendsten Themen philosophischer Diskurse im 19. und 20. Jahrhundert. Im Zuge dessen gewann die subjektive Existenz an Bedeutung und wurde zum wichtigsten Gegenstand der Philosophie. Im Gegensatz zum „Wesen“ der Menschen ging es vermehrt um den praktischen Lebensvollzug als Quelle der Erkenntnis, da sich nur darin seine Existenz äußere. So legte bereits Martin Heidegger den Fokus auf das konkrete „In der Welt-Sein“ der Menschen.
Die subjektive Wende in den Wissenschaften verstärkte allerdings das bereits bestehende basale Problem der Philosophie. Denken ist grundsätzlich immer abstrakt und kann niemals einen konkreten Gegenstand gänzlich erfassen. Auch Begriffe und theoretische Über-legungen sind notwendigerweise vom Ausgangspunkt abstrahiert. So gesehen kann die Philosophie nicht erfassen, worum es ihr eigentlich geht: Die konkrete menschliche Existenz. Da das Subjekt ständigen Veränderungen unterworfen ist, kann auf der gedanklichen Ebene eine Abstraktion nur unter Berücksichtigung der unveränderlichen Parameter erfolgen.
Die konkrete Einzelexistenz kann eben nicht „gedacht“ werden, nur das dieser Existenz Zugrundeliegende kann gedanklich erfasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Abstraktheit begrifflichen Denkens
- Zielsetzung und Herangehensweise
- Der Status von Allgemeinbegriffen
- Der Universalienstreit
- Universalien und Individuen
- Verallgemeinerung und Konkretisierung in der Philosophie
- Das Subjekt aus philosophischer Sicht
- Deduktion und Induktion
- ,,Individuum est ineffabile“
- Schlussbemerkungen
- Resümee und Stellungnahme
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich mit dem komplexen Verhältnis zwischen Philosophie und konkreter Lebenserfahrung auseinander. Sie beleuchtet das Problem der Abstraktheit des Denkens und wie es sich auf die Erfassung der individuellen Existenz auswirkt. Die Arbeit untersucht, wie Philosophen dieses Problem angegangen sind, insbesondere im Kontext des Universalienstreits, der sich mit der Frage beschäftigt, ob und wie allgemeine Begriffe (Universalien) in Beziehung zum Einzelnen stehen.
- Das Verhältnis von Philosophie und Leben
- Die Abstraktheit des Denkens und ihre Auswirkungen auf die Erfassung individueller Existenzen
- Der Universalienstreit und die Frage nach dem Status von Allgemeinbegriffen
- Die Bedeutung des Einzelnen in philosophischer Betrachtung
- Die Rolle von Induktion und Deduktion in der Erfassung von Wissen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die grundlegende Problematik des Verhältnisses zwischen Philosophie und Leben. Sie argumentiert, dass die Abstraktheit des Denkens es der Philosophie erschwert, die konkrete menschliche Existenz zu erfassen. Das Kapitel geht auf die subjektive Wende in den Wissenschaften ein und stellt die Bedeutung der konkreten Lebenserfahrung für die Erkenntnis heraus.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Status von Allgemeinbegriffen und dem Universalienstreit. Es werden die unterschiedlichen Positionen der Realisten, Nominalisten und Konzeptualisten im Mittelalter vorgestellt und analysiert, welche unterschiedliche Ansichten über die Existenz und den Bezug von Universalien zu Einzeldingen vertreten.
Im dritten Kapitel wird die Frage nach der Verallgemeinerung und Konkretisierung in der Philosophie betrachtet. Es werden verschiedene philosophische Ansätze zur Erfassung des Subjekts und zur Rolle des Einzelnen in erkenntnistheoretischen Zusammenhängen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen und Konzepten der Philosophie, darunter: Individuum, Existenz, Abstraktion, Verallgemeinerung, Konkretisierung, Universalien, Universalienstreit, Deduktion, Induktion, Subjekt, Erkenntnis, Philosophie und Leben.
- Quote paper
- Nicole Borchert (Author), 2010, „Individuum est ineffabile“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150279