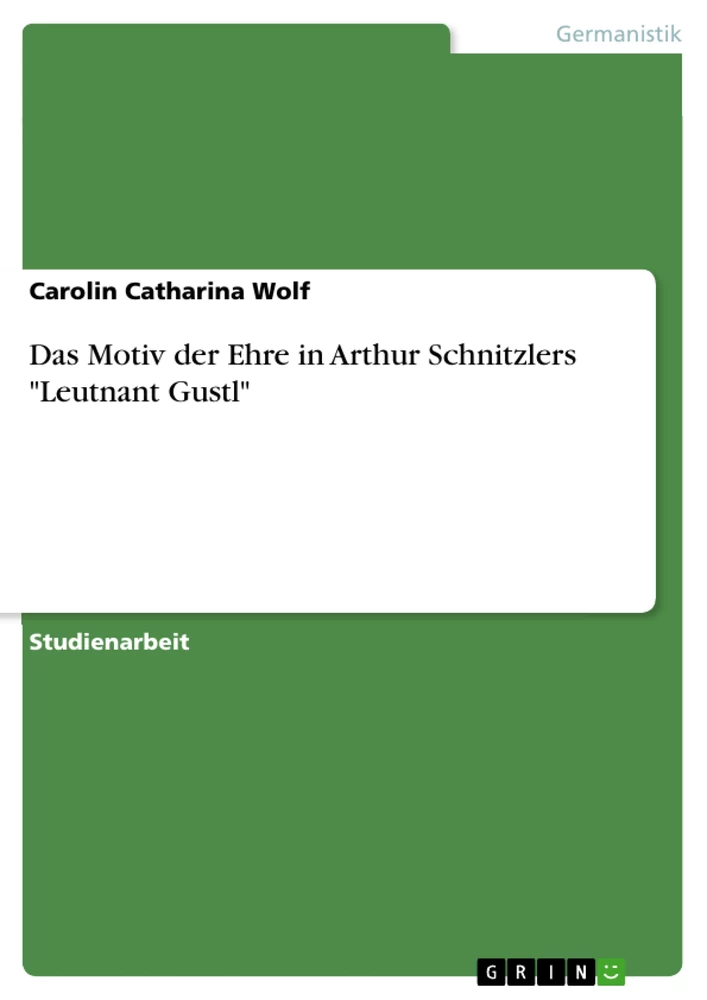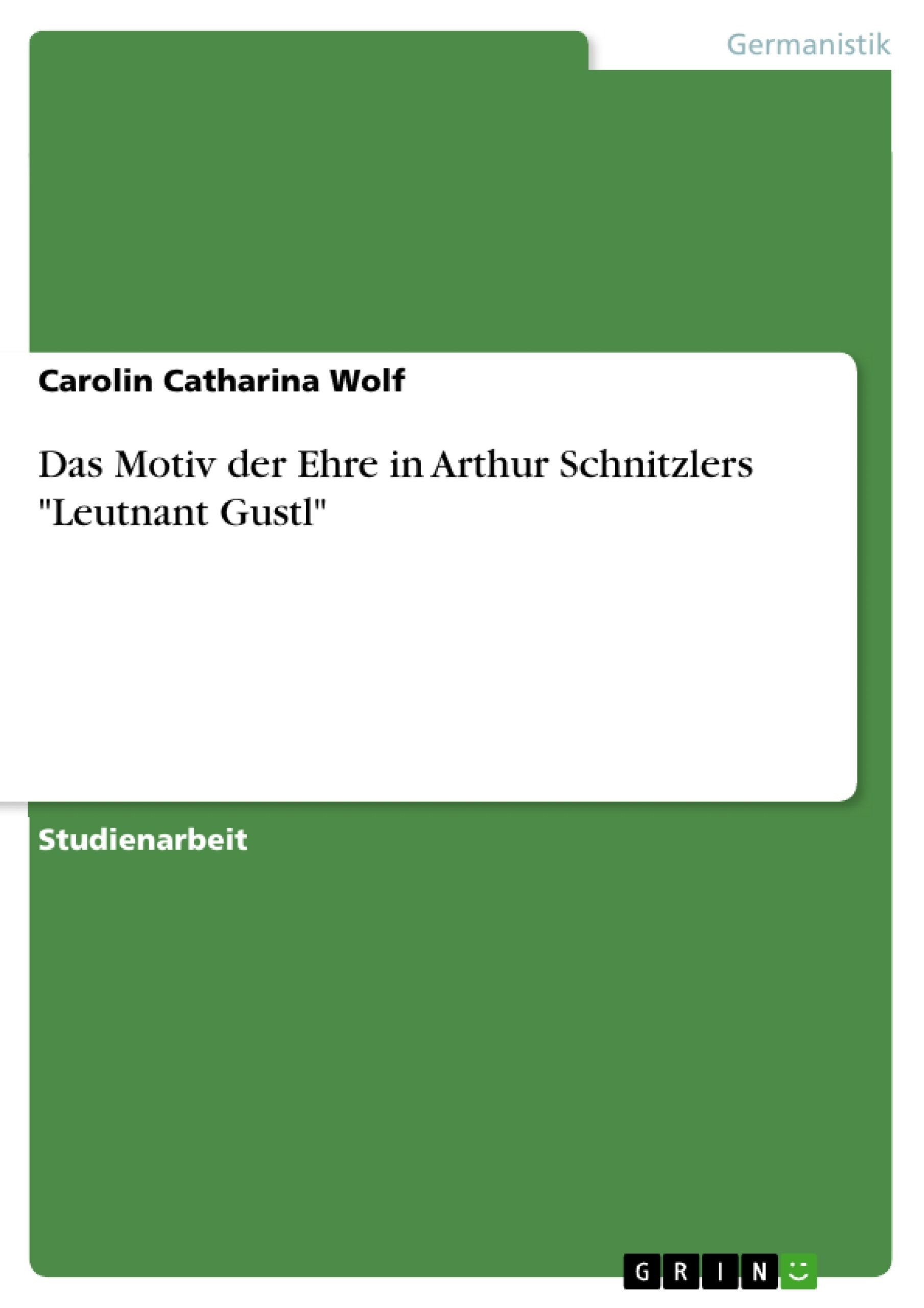Im Sommer 1900 schreibt Arthur Schnitzler (1862-1931) in Reichenau/ Rax
innerhalb von sechs Tagen die Novelle „Leutnant Gustl“1 nieder. Der Erstabdruck
des Textes erfolgt am 25. Dezember desselben Jahres in der Weihnachtsbeilage
der Neuen Freien Presse und erregt nicht wenig Aufsehen.
Binnen kürzester Zeit erfolgen negative Reaktionen aus Militärkreisen, welche
sich in erbitterten Angriffen gegen den Reserveoffizier Schnitzler äußern. Diese
Angriffe münden in einem ehrenrätlichen Verfahren, in dessen Ergebnis dem
Schriftsteller, weil er – so heißt es- die Standesehre verletzt habe, die
Offizierscharge aberkannt wird.
Aber nicht nur die Wirkungsgeschichte der vorliegenden Novelle ist einzigartig;
auch ihre Gestalt ist ungewöhnlich. Zum ersten Mal wird die Form des inneren
Monologs so unverkennbar in der deutschen Literatur verwendet.2
Sie bietet einen tiefen und direkten Einblick in die inneren Konflikte des
Protagonisten, die sich aus den Geschehnissen des 04.April 1900, dem
Handlungstag der Novelle, speisen.
Der Plot, welcher sich zwischen zehn Uhr abends und sechs Uhr morgens
abspielt, ist schnell geschildert: Leutnant Gustl besucht ein Oratorium3 des
Wiener Musikvereins am Karlsplatz, welches ihn verdrießlich stimmt, da er die
Andacht, die das Konzert seinem Publikum abverlangt, nicht aufbringen kann.
Als die für ihn ermüdende Darbietung ein Ende gefunden hat, beabsichtigt er an
der Garderobe seinen Mantel abzuholen, um rasch an die frische Luft treten zu
können. Bei der Kleiderabgabe angekommen drängt er den Bäckermeister Habetswallner
– ihn noch nicht als Bekannten identifizierend- mehrmals unsanft beiseite. [...]
==
1 Schnitzler, Arthur: „Leutnant Gustl“. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2001
2 Vorbild ist der Roman „Les lauriers sont coupés“ (1888) von Edouard Dujardin, der ebenfalls
den Modus des „inneren Monologs“ gewählt hatte.
Auch Hermann Bahr nahm 1891 in seinem Essayband „Die Überwindung des Naturalismus“ mit
der Forderung nach Aufzeichnung „der Vorbereitung der Gefühle, bevor sie sich noch ins
Bewusstsein hinein entschieden haben“ Schnitzlers formale Neuerung des durchgängigen inneren
Monologs theoretisch vorweg.
3 Bei diesem Oratorium handelt es sich nachgewiesenermaßen um „Paulus. Oratorium nach
Worten der heiligen Schrift“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehungs- und Rezeptionsgeschichtliches, Einführung ins Thema
- Die Ehre als ethischer Wert
- Ausführungen Fichtes, Hegels, Schopenhauers
- Die individuelle Disposition des Protagonisten
- Minderwertgefühle, Aggressionen und Antisemitismus
- Die Bestimmungen des Ehrenkodex
- Der Bäckermeister und die k.u.k. Armee
- Die Gedankenflüge eines Todgeweihten
- Ein Streifzug durch Wien und ein obdachloser Leutnant
- Die Ehre und der gute Ruf
- Die Ehre als abstraktes Prinzip
- Schlussbetrachtungen
- Individuelle und kollektive Lügen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Analyse befasst sich mit dem Motiv der Ehre in Arthur Schnitzlers Novelle „Leutnant Gustl“. Das Hauptziel der Untersuchung ist es, die Entstehung und Funktion des hohlen und falschen Ehrbegriffs, der in der Novelle deutlich wird, zu analysieren. Im Zentrum stehen die individuellen und gesellschaftlichen Faktoren, die den Protagonisten für die Propaganda einer Armee empfänglich machen, die einen solchen Ehrbegriff vermittelt.
- Die Rolle der k.u.k. Armee in der Gesellschaft
- Die Bestimmungen des Ehrenkodex
- Die individuelle Disposition des Leutnants Gustl
- Die Auswirkungen des Ehrbegriffs auf das Handeln des Protagonisten
- Die Gesellschaftskritik, die Schnitzler in der Novelle übt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Entstehungsgeschichte der Novelle „Leutnant Gustl“ dar und führt in das Thema der Ehre als ethischen Wert ein. Sie beleuchtet die philosophischen Ansätze von Fichte, Hegel und Schopenhauer, die den Begriff der Ehre aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten.
Das Kapitel „Die individuelle Disposition des Protagonisten“ untersucht die inneren Konflikte des Leutnants Gustl, die aus seinen Minderwertgefühlen, Aggressionen und antisemitischen Vorurteilen resultieren. Es wird deutlich, wie diese Dispositionen ihn für die Propaganda der k.u.k. Armee empfänglich machen.
Das Kapitel „Die Bestimmungen des Ehrenkodex“ beleuchtet die strikten Regeln und Erwartungen, die der Ehrenkodex der k.u.k. Armee an seine Mitglieder stellt. Es wird analysiert, wie dieser Kodex das Verhalten des Leutnants Gustl beeinflusst und ihn zu Entscheidungen treibt, die er später bereut.
Das Kapitel „Der Bäckermeister und die k.u.k. Armee“ beschreibt die Begegnung zwischen Gustl und dem Bäckermeister Habetswallner, die den Ausgangspunkt für die Handlung der Novelle bildet. Gustls Reaktion auf den Vorfall und seine daraus resultierende Entscheidung zum Freitod werden in diesem Kapitel ausführlich dargestellt.
Das Kapitel „Ein Streifzug durch Wien und ein obdachloser Leutnant“ zeichnet den inneren Monolog des Leutnants Gustl während seiner nächtlichen Irrfahrt durch Wien nach. Es wird deutlich, wie er mit seinen Erinnerungen und Rachegedanken ringt und gleichzeitig seinen Selbstmord plant. Das Kapitel beleuchtet auch die Rolle des öffentlichen Ansehens und den Einfluss der Standesehre auf Gustls Selbstbild.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Novelle „Leutnant Gustl“ sind Ehre, Standesehre, Militär, Selbstmord, Antisemitismus, Minderwertigkeit, innerer Monolog, Gesellschaftskritik. Die Untersuchung befasst sich mit der individuellen Disposition des Protagonisten, dem Einfluss des Ehrenkodex der k.u.k. Armee und der Rolle der öffentlichen Meinung in der damaligen Gesellschaft. Schnitzlers Novelle bietet einen scharfen Blick auf die gesellschaftlichen Normen und Konventionen des frühen 20. Jahrhunderts und die problematischen Auswirkungen eines hohlen Ehrbegriffs.
- Quote paper
- Carolin Catharina Wolf (Author), 2008, Das Motiv der Ehre in Arthur Schnitzlers "Leutnant Gustl", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150185